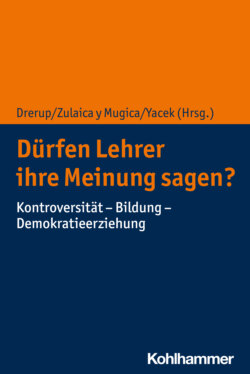Читать книгу Dürfen Lehrer ihre Meinung sagen? - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dürfen Lehrer ihre Meinung sagen? Einleitung Johannes Drerup, Miguel Zulaica y Mugica & Douglas Yacek
ОглавлениеDürfen Lehrer_innen ihre Meinung sagen?1 Inwieweit sind sie im Unterricht zu (partei-)politischer Neutralität verpflichtet? Wie sollen sie im Unterricht mit kontroversen und polarisierenden Themen, z. B. Migration, Klimawandel, COVID-19 Pandemie, umgehen? Wie sollen sie sich zu extremistischen, illiberalen und antidemokratischen Äußerungen von Schüler_innen verhalten? Und wie sollen sie als Vertreter_innen der Demokratie mit der Aussage umgehen, das Dritte Reich sei nur ein ›Vogelschiss‹ in der deutschen Geschichte? Wie lässt sich eine angemessene und zivilisierte Streitkultur in und außerhalb von öffentlichen Schulen kultivieren und wie könnte diese aussehen?
Diese Fragen zeigen bereits an, dass die Kontroversen über den angemessenen pädagogischen Umgang mit kontroversen Themen nicht nur von akademischer Relevanz sind, sondern in den letzten Jahren zunehmend wieder zu einem gesellschaftspolitisch brisanten Thema geworden sind. So wird im Zuge des Erfolgs rechtspopulistischer Parteien in der öffentlichen Debatte vermehrt über die ›Neutralität‹ von Lehrer_innen und über Indoktrinationsvorwürfe diskutiert, und es wird auch öffentlich politischer Druck auf Lehrkräfte ausgeübt, denen politische Parteilichkeit vorgeworfen wird (etwa Dienstaufsichtsbeschwerden der AfD in Hamburg, die Einrichtung von Online-Portalen zur Meldung AfD-kritischer Lehrer_innen sowie auch die kürzlich wieder entbrannte Diskussion über Berufsverbote für Lehrer_innen). Zugleich haben ideologiepolitisch beladene Themen wie ›safe spaces‹, ›cancel culture‹, ›political correctness‹, Redefreiheit in Schulen und Hochschulen und Entwicklungen in der polarisierenden und polarisierten digitalen Öffentlichkeit Dauerkonjunktur in Debatten, in denen die Grundlagen und Grenzen einer demokratischen Streitkultur verhandelt werden. Gestritten wird nicht nur über konkrete Inhalte, sondern auch über die Art und Weise, wie gestritten werden sollte, über metakommunikative Vorgaben für die Gestaltung von Kontroversen und für den Umgang mit Dissens (vgl. Pörksen & Schulz von Thun 2021), aber auch über die Frage, warum überhaupt in und außerhalb von Schulen über kontroverse Themen diskutiert werden sollte (vgl. Geuss 2019; Talisse 2019; Drerup 2021). Diese Debatten beschränken sich nicht auf pädagogische (vgl. etwa analoge Debatten in der Politik und im Sport) und nationale Kontexte (Deutschland, Europa oder die USA, vgl. Costa 2020) und haben – so der Tenor in Wissenschaft und Öffentlichkeit – zu einigen Verunsicherungen bei Lehrer_innen mit Bezug auf die Frage geführt, wie sinnvoller- und legitimerweise mit kontroversen Positionen umzugehen ist bzw. welche Positionen überhaupt als kontrovers zu gelten haben.
In der deutschsprachigen Debatte werden solche Problemvorgaben üblicherweise mit Rekurs auf den ›Beutelsbacher Konsens‹ und vor allem auf das Kontroversitätsgebot diskutiert. Der Beutelsbacher Konsens umfasst drei Prinzipien, die als »Kern der Berufsethik von Pädagogen in demokratischen Gesellschaften« (Grammes 2014, S. 266) gelten. Die drei Prinzipien – das Überwältigungsverbot (häufig auch Indoktrinationsverbot), das Kontroversitätsgebot und das Prinzip der Schülerorientierung – lauten in leicht gekürzter Form wie folgt:
1. Überwältigungsverbot: »Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit welchen Mitteln auch immer – im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbständigen Urteils zu hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen Politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der – rundum akzeptierten – Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers.«
2. Kontroversitätsgebot: »Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer nicht sogar eine Korrekturfunktion haben sollte, d. h. ob er nicht solche Standpunkte und Alternativen besonders herausarbeiten muss, die den Schülern (und anderen Teilnehmern politischer Bildungsveranstaltungen) von ihrer jeweiligen politischen und sozialen Herkunft her fremd sind. Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips wird deutlich, warum der persönliche Standpunkt des Lehrers, seine wissenschaftstheoretische Herkunft und seine politische Meinung verhältnismäßig uninteressant werden.«
3. Prinzip der Schülerorientierung: »Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. Eine solche Zielsetzung schließt in sehr starkem Maße die Betonung operationaler Fähigkeiten ein, was eine logische Konsequenz aus den beiden vorgenannten Prinzipien ist« (Wehling 1977, S. 179f.; Hervorhebung im Original).
Was jedoch aus diesen drei Prinzipien jeweils genau folgt, wie sie aufeinander bezogen, gewichtet und auf konkrete Erziehungs- und Bildungsziele theoretisch und praktisch abgestimmt werden sollen, und insbesondere wie das Kontroversitätsgebot genau verstanden und umgesetzt werden könnte, bleibt selbst Gegenstand anhaltender nationaler und internationaler Kontroversen (vgl. Yacek 2018; Drerup & Yacek 2020; Zulaica y Mugica 2019; Drerup 2021), in denen zugleich epistemologische, methodologische, ethisch-politische sowie curriculare und unterrichtspraktische Fragen verhandelt werden. Insbesondere in der Debatte in der angelsächsischen Philosophy of Education wurden unterschiedliche Kriterien der Kontroversität vorgeschlagen, die beanspruchen, kontroverse Themen (die mit offenem Ausgang und mit Bezug auf eine Pluralität von grundsätzlich angemessenen und legitimen Positionen zu unterrichten und zu diskutieren sind) von solchen Themen unterscheiden zu können, die nicht als kontrovers gelten können. Auf Basis eines sozialen Kriteriums sollten z. B. alle in Öffentlichkeit und Politik kontrovers diskutierten Themen auch im Unterricht kontrovers diskutiert werden. Verteidiger epistemischer Kriterien wenden dagegen ein, dass dies nur für hinreichend rational und empirisch begründete Positionen gelten dürfe.
Die Fragen nach einer angemessenen Bestimmung von Kontroversität und ihren Grenzen sind – analog zu gängigen Aufgabenbeschreibungen von Demokratieerziehung und demokratischer Bildung – eine fächerübergreifende Herausforderung, die sich in und außerhalb von Schulen auf je unterschiedliche Art und Weisen stellen. Kontroversen über politisch relevante Fragen und Themen – ob pädagogisch organisiert und intendiert oder nicht – können in allen Schulfächern – in naturwissenschaftlichen Fächern nicht weniger als in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, wie Geschichte, Wirtschaft und Sozialwissenschaften – und selbstverständlich auch außerhalb der Schule aufkommen.
Im Rahmen des Bandes wird der Komplexität der Problemvorgaben rund um das Thema Kontroversität dadurch Rechnung getragen, dass nicht nur die gängigen Kriterien, die in der Debatte zur Differenzierung zwischen kontroversen und nicht kontroversen Themen vorgeschlagen wurden, auf den Prüfstand gestellt werden (z. B. soziale, politische und epistemische Kriterien), sondern auch weitergehende Probleme diskutiert werden, die die Theorie, die Empirie und die Praxis des Umgangs mit kontroversen Themen im Unterricht betreffen. Zur Debatte stehen z. B. grundlegende theoretische Fragen nach dem Status und der Orientierungskapazität allgemeiner Kriterien, ihrem Zusammenhang und ihrer Abwägung und damit verbundene methodologische Kontroversen über das Verhältnis von systematischen, normativen Ansätzen und theoriegeleiteter empirischer Forschung, über den Geltungsbereich und über Anwendungsprobleme tradierter Kriterien auch jenseits des Politikunterrichts in anderen Fächern und Bereichen und über Hindernisse, mit denen auf Förderung von Kontroversen ausgerichtete, dialogorientierte Formate von Demokratieerziehung und demokratischer Bildung konfrontiert sind.
Das übergreifende Ziel des Bandes ist es, Vertreter_innen unterschiedlicher Disziplinen und Fächer zusammenzubringen, um diese und ähnliche – kontroverse – Fragen zur Kontroverse über Kontroversitätsgebote zu diskutieren und zu klären. Der Band ist in drei Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil werden zunächst theoretische Grundlagen der Kontroverse über Kontroversitätsgebote diskutiert. Im zweiten Teil folgt eine Analyse von fach- und domänenspezifischen Problemen im Umgang mit Kontroversität in pädagogischen Kontexten. Der dritte Teil bietet eine Auseinandersetzung mit aktuellen Themen, Problemvorgaben und Herausforderungen im Umgang mit Kontroversität.
Johannes Giesinger eröffnet mit seinem Beitrag den ersten Teil des Bandes und die Diskussion über den angemessenen Umgang mit kontroversen Themen im Unterricht. Auf Basis pädagogischer Überlegungen zur Differenz von Vermittlung, Mitteilung und Diskussion analysiert er Kriterien und Gründe für die Legitimität von Meinungsäußerungen von Lehrkräften. Im Rahmen seiner Analyse argumentiert er für eine differenzierte Position, in der professionelles Handeln und didaktische Zielvorstellungen die Grundlagen für begründete Entscheidungen der Lehrkraft bilden sollten.
Thomas Rucker diskutiert die Frage nach dem angemessenen Umgang mit Kontroversität im Unterricht aus einer dezidiert erziehungs- und bildungstheoretischen Perspektive. Schule und Unterricht treten hier in ihrer erziehenden Dimension hervor, die er als eine »Form des Miteinanderumgehens« in der Vermittlung von und Hinführung in die Kultur begreift. Er geht davon aus, dass Kontroversität überhaupt erst aufgrund des Bildungsanspruchs eines erziehenden Unterrichts für pädagogische Reflexion bedeutsam ist. Mit dem bildungstheoretisch begründeten Ziel – der Befähigung zu einer selbstbestimmten Lebensführung – verbindet er eine nichtaffirmative Erziehung, die Schüler_innen zum selbstständigen Werten und Urteilen befähigen soll. Rucker argumentiert, dass Entscheidungen über die Auswahl und Thematisierung von Kontroversen auf Basis eines demokratischen Freiheitsverständnisses und des jeweils aktuellen Stands des Wissens begründet werden sollen.
Die Frage, wie mit Kontroversität im schulischen Kontext umgegangen werden sollte, wird von Miguel Zulaica y Mugica vor dem Hintergrund der Wissenschaftsorientierung der Schule als bildungspolitische Entscheidung betrachtet. Er verteidigt die These, dass Fallibilität – verstanden als ein Bewusstsein der Fehlbarkeit im Rahmen eines reflektierten Wahrheitsverständnis – Bedingung für eine kommunikative Begegnung im Kontext von Kontroversen ist. Auf der Grundlage dieser These argumentiert Zulaica y Mugica für das bildungstheoretische Ziel eines nicht-naiven Wissenschaftsverständnisses, das auf die Ermöglichung von Urteilsfähigkeit in einer wissenschaftsdominierten Gesellschaft abzielt.
Der Beitrag von Ole Hilbrich eröffnet eine sozialtheoretische Perspektive auf das Thema Kontroversität im Unterricht in Form der Ausgestaltung einer demokratischen Streitkultur. Ausgangspunkt seiner Argumentation ist eine Kritik an der »Pseudoklarheit« der Diskussion über Kriterien der Kontroversität. Im Widerspruch zu dem liberalen Rationalismus, den Hilbrich diesem Diskurs attestiert, und zu einem instrumentellen Unterrichtsverständnis propagiert er eine radikaldemokratische Theorieperspektive. Ausgehend von Arendt und Rancière entfaltet er ein alternatives Interpretationsangebot der Kontroversität und des demokratischen Streits als agonales Geschehen, in dem emanzipatorisch die »Grundlosigkeit der herrschenden Ordnung demonstriert« werden könne. Hilbrich überführt diese Überlegungen in ein sozialtheoretisches Unterrichtsverständnis, in welchem Schüler_innen als den Unterricht mitbestimmende Subjekte anerkannt werden.
Der zweite Teil wird durch eine religionspädagogische Ausdeutung des Beutelsbacher Konsenses und des Kontroversitätsgebots von Jan Hendrik Herbst eingeleitet. Ausgehend von der Prämisse, dass der Religionsunterricht in die politische Bildung involviert sei, konstatiert Herbst einen politikdidaktischen Orientierungsbedarf und plädiert daher dafür, sich mit dem Beutelsbacher Konsens kritisch auseinanderzusetzen. In seinem Beitrag entwickelt er den Vorschlag einer »positionierten Kontroversität«, die auf einen multiperspektivischen Umgang mit kontroversen Themen im Religionsunterricht ausgerichtet ist und den Lehrkräften zugleich erlaubt, sich im Sinne der christlichen Ethik und der entsprechenden Gerechtigkeitskonzeptionen zu positionieren.
Anne Burkard widmet sich in ihrem Beitrag der philosophiedidaktischen Bedeutung von Neutralität und der Problematik von Neutralitätsforderungen im Zusammenhang mit nicht erstrebenswerten naiv-skeptischen und -relativistischen Einstellungen von Schüler_innen. Sie fokussiert nicht den naiven Skeptizismus als solchen, sondern die professionsethische Diskussion der Position der Lehrkräfte im Philosophieunterricht. So werde eine diskursive Dichotomie zwischen neutraler Repräsentation – »teaching the debate« – und positionierender Diskussion – »engaging the debate« – aufgespannt. Burkards Ansatz besteht darin, Handlungsspielräume jenseits dieser Extrempositionen im Kontext einer qualitativen Studie nachzuzeichnen, in der sie Ergebnisse aus Gruppendiskussionen mit Philosophie- und Ethiklehrkräften vorstellt. Auf dieser Basis rekonstruiert sie erfahrungsgestützte Hinweise für den professionellen Umgang mit Kontroversität, um reflexive Bezugnahmen auf das Thema der Neutralität und Kontroversität im Lehramtstudium und Referendariat zu ermöglichen.
Das Spannungsverhältnis von Neutralitätsforderungen, Werturteilen und der narrativen Struktur historischen Denkens ist Gegenstand des Betrags von Jörn Rüsen. In seiner Argumentation tritt er von der Frage, ob Lehrkräfte im Geschichtsunterricht ihre Meinung sagen dürfen, zunächst zurück und wendet sich einer theoretischen Bestimmung geschichtlichen Wissens und seiner Vermittlung zu. Konfrontiert mit dem Sachverhalt, dass Geschichtsschreibung vergangenen Geschehnissen Sinn zuschreibt, geht Rüsen der Verwicklung dieses Wissens mit Werturteilen in Auswahl, Präsentation und Erzählform nach. Die Multiperspektivität als Prinzip des Unterrichts und die Idee einer Autonomie der historischen Urteilsbildung von Schüler_innen seien pädagogische Antworten auf die wertbedingte Struktur geschichtlichen Wissens. Problematisch werde die Multiperspektivität dem Autor zur Folge aber dann, wenn diese mit ethnozentrischen Deutungsmustern konfrontiert werde, die antipluralistisch sind. Ausgehend von diesem Problemaufriss entwickelt Rüsen die Idee einer pluralistischen und auf dem Gedanken der Menschwürde basierenden »Leitkultur«, in der Geschichtsschreibung sich durch Diskursfähigkeit, qualitative Begründungskriterien und Selbstreflexivität auszeichnen müsse. Rüsen argumentiert so für eine Verlagerung der Frage vom Was auf das Wie des Erzählens in seinen geschichtspädagogischen Überlegungen.
Benedikt Widmaier beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der historischen Genese und kontemporären gesellschaftspolitischen Rolle des Leitbilds einer wehrhaften Demokratie. Ausgehend von einer historischen Rekonstruktion der Idee einer wehrhaften oder auch streitbaren Demokratie in den 1950er-Jahren entwickelt er eine Kritik der politischen und pädagogischen Funktion und Nutzung dieses Leitbilds, welches sich – so seine Argumentation – als latent anachronistische Orientierungsvorgabe nicht mehr als Grundlage für eine zeitgemäße politische Bildung eigne.
Dorothee Gronostays Beitrag analysiert theoretische Rahmungen und empirische Befunde zur Frage der Offenlegung politischer Ansichten von Lehrpersonen. Dabei wird die Offenlegungsfrage als professionelle und berufsethische Entscheidung von praktizierenden Lehrkräften verstanden, die Abwägungen erforderlich macht. In ihrem Beitrag diskutiert sie diese Frage ausgehend von einschlägigen empirischen Befunden, professionsethischen Überlegungen zum Lehramt als politischem Beruf und der hierfür zentralen Unterscheidung zwischen Parteinahme und Parteilichkeit.
Ausgangspunkt des Beitrags von Thomas Goll ist die inhaltliche Unterbestimmtheit und geringe Ergiebigkeit des Kontroversitätsgebots in der Beutelsbacher Version für fachdidaktische Fragestellungen. Dies Gebot könne – unprofessionell angewandt – problematische Einstellungen der Ratlosigkeit bis hin zur Politikverdrossenheit bei Schüler_innen hervorbringen, wenn etwa im Politikunterricht Positionen beliebig nebeneinander aufgereiht werden und ohne sachlichmethodische Behandlung bleiben. Gleichwohl verteidigt Goll die Ansicht, dass Kontroversität einen Beitrag zu einem gelingenden und guten Politikunterricht leisten kann, wenn dieses Gebot als ein diskursives Legimitationsprinzip reformuliert wird, das an einem fachdidaktischen Kriterium orientiert ist. Mit der Rückbindung an das fachdidaktische Kriterium sollen Entscheidungen über im Unterricht behandelte Positionen und Kontroversen der professionellen fachdidaktischen Expertise der Lehrkräfte zugewiesen werden, die ihren Unterricht wissenschaftsorientiert gestalten und die Bildung politischer Mündigkeit fördern müssen.
Im folgenden dritten Teil geht Christina Brüning aus von einer im schulischen und universitären Betrieb wahrnehmbaren Verunsicherung bezüglich der Akzeptabilität von Äußerungen und Kontroversen bei Schüler_innen, Studierenden und Lehrkräften als Folge eines Rechtsrucks der politischen und medialen Landschaft seit 2010. In ihrem Beitrag führt sie diese Verunsicherungen auf eine Fehldeutung und einen Missbrauch des Beutelsbacher Konsenses zurück, der als rechtliche Grundlage insbesondere von der AfD fehlinterpretiert werde, um Einfluss auf die unterrichtlichen Inhalte zu gewinnen. Diese Strategie sei deswegen erfolgreich, weil die historische Genese des Beutelsbacher Konsenses und dessen demokratische Orientierung selbst bei Fachkräften oftmals unbekannt sind. Mit Hilfe einer historischen Kontextualisierung des Konsenses weist sie auf die demokratische und menschenrechtliche Fundierung der historisch-politischen Bildung in der Schule hin, die in einer Demokratie nicht wertneutral sein könne. Zur pädagogisch-praktischen Orientierung erläutert sie Argumentations- und Handlungsoptionen im Umgang mit rechtsextremistischen, menschen- und wissenschaftsfeindlichen Aussagen anhand von Beispielen aus dem Geschichtsunterricht und aktuellen politischen Konflikten.
Für eine Didaktik des kritischen Denkens spricht sich David Lanius in seiner wissenschaftstheoretisch gestützten Beschäftigung mit Fake News, Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen aus. Mit einer Relationierung dieser Begriffe hinsichtlich der Fragen von Wahrheit vs. Lüge, Wahrhaftigkeit vs. Täuschungsversuch oder der Negation jedes Wahrheitsanspruchs – Bullshit – arbeitet er Kriterien für begriffliche Unterscheidungen heraus und entwickelt einen Rahmen für pädagogische Überlegungen zur Vermittlung von epistemischen und demokratischen Argumentationskompetenzen. Er konstatiert einen Zusammenhang zwischen der Komplexität des Wissens- und Wahrheitsbegriffs und der Wirkmächtigkeit und Gefährlichkeit von Fake News und Verschwörungstheorien und skizziert Vorschläge für die Auseinandersetzung mit demokratiefeindlichen Entwicklungen. Der weitestgehende Vorschlag von Lanius ist die Einführung eines eigenständigen Unterrichtsfachs für Kritisches Denken, in dem neben wissenschaftstheoretischen Begriffen und Einsichten, metakognitiven Kompetenzen und Medienkritikfähigkeit auch demokratische Handlungskompetenz gefördert werden sollten.
Ausgehend von schulpädagogischen und bildungstheoretischen Argumentationen zum Neutralitätsgebot kritisieren Christoph Haker und Lukas Otterspeer Forderungen der AfD nach einer »Neutralen Schule«. Die Meldeportale der AfD werden von den Autoren als Einschränkungen der Autonomie der Schule und des Unterrichts kritisiert, die Verunsicherungen schüren und Bildungsprozesse behindern sollen. Auf der Basis eines sozialtheoretischen Unterrichtsverständnisses kritisieren die Autoren Forderungen nach Unabhängigkeit und Distanziertheit, weil diese eine »teilnahmslose Haltung« der Lehrkräfte propagieren. Für eine demokratische Gesellschaft und eine entsprechende Streitkultur bedarf es aus ihrer Sicht einer »engagierten, subjektiven, parteiischen und involvierten« Lehrer_innenpersönlichkeit, die ihre Meinung sagen soll. Dem Problem der Überwältigung begegnen sie mit einer auf Foucaults Machttheorie rekurrierenden »Orientierungskategorie« der »bedingten Autonomie«, mit der sie die Bedingungen des Wie der Positionierung seitens der Lehrkraft formulieren. Sie sprechen sich dafür aus, Interaktionen im Unterricht als »Machtspiele« zu interpretieren, zur Selbstreflexion aufzufordern, Schüler_innen immer schon Autonomie zuzusprechen und ihnen so Gelegenheiten zu bieten, Formen der Wissensvermittlung zu hinterfragen und sich selbst zu positionieren.
Subin Nijhawan setzt sich in seinem provokant gehaltenen Essay mit der Frage auseinander, ob und inwieweit es sich um eine zu beanstandende Überwältigung im Sinne des Beutelsbacher Konsenses handelt, wenn Jugendliche angesichts unbestreitbarer globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel aufgefordert werden, sich in aktiver politischer Absicht zu engagieren. Er diskutiert die damit verbundenen Fragen nach der angemessenen und legitimen Rolle von Lehrkräften ausgehend von der Vorstellung des Projekts The Blue Planet und im Rahmen einer Konzeption von Bildung für nachhaltige Entwicklung, um so neue Perspektiven auf den Beutelsbacher Konsens zu eröffnen.
Herzlich danken möchten wir Tim Isenberg für seine Hilfe bei der Erstellung des Manuskripts.