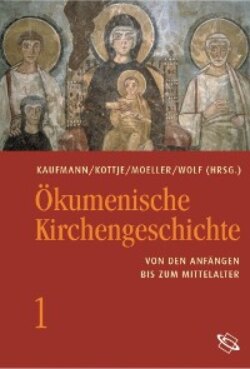Читать книгу Ökumenische Kirchengeschichte - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Vision Jesu und ihre Umsetzung nach Ostern
ОглавлениеHätte Jesus der Entwicklung, wie sie nach seinem Tod verlaufen ist, wirklich sein Plazet gegeben? Hätte er gutgeheißen, dass schon bald von einem Teil seiner Nachfolger das heilige Zeichen Israels, die Beschneidung, aufgegeben wird, „seine“ Gemeinden sich von den jüdischen Synagogalgemeinden absetzen und getrennte Wege gehen; dass sich Amtsstrukturen bilden, Unter- und Überordnungen entstehen? Mit anderen Worten: Ist die Entwicklung hin zur christlichen Kirche im Sinn Jesu verlaufen? Muss das berühmte Diktum von Alfred Loisy (1857–1940): „Jesus verkündigte das Gottesreich, und gekommen ist die Kirche“ im Sinn sich gegenseitig ausschließender Alternativen verstanden werden?
Keine Frage: Fluchtpunkt des Auftretens Jesu war die Gottesherrschaft. Sie war das zentrale Thema seiner Worte und das Gestaltungsmuster seiner Taten. Aber wir müssen bedenken: Im Horizont des Frühjudentums steht Gottesherrschaft als Chiffre für ein gesellschaftspolitisches Projekt, das sich als irdische Verwirklichung des theologischen Grundsatzes versteht: Gott herrscht als König. Es geht also um die konkrete Verfassung Israels, die beansprucht, in den irdischen Strukturen die Königsherrschaft Gottes als Prägemal sichtbar werden zu lassen. In diese Traditionslinie gestellt, stehen die beiden Größen „Gottesherrschaft“ und „Kirche“ nicht mehr wie sich ausschließende Alternativen gegenüber, sondern ergänzen sich wie Vision und Realisierungsversuch. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Jesus die Kirche gewollt hat, sondern inwiefern kirchliche Realisierungsversuche mit der Vision Jesu kongruent erscheinen.
Nehmen wir den Vorlauf über das Judentum, um Jesu Option besser einzeichnen zu können. Um die Konkretisierungsversuche von „Gottesherrschaft“ wurde in Israel immer gestritten. Vor allem ging es um die Frage, wer der eigentliche Souverän in der Gottesherrschaft auf Erden ist: ein König in Analogie zu König David, wie es von den monarchischen Kräften Israels propagiert wurde, oder eine aristokratische Gruppe mit dem Hohenpriester als Repräsentanten gemäß dem Modell, wie es sich nach dem Exil etabliert hat und um die Zeitenwende insbesondere von den Sadduzäern verfolgt wurde? Ein weiterer Streitpunkt betraf den Umgang mit den „Feinden“ Israels, also den jeweiligen Besatzern: Sollen sie mit militärischer Gewalt außer Landes geworfen und soll für die Selbstständigkeit Israels gekämpft werden, so wie es von den Hasmonäern erfolgreich in die Tat umgesetzt wurde, oder soll man, wie es sich die Sadduzäer und später die Herodianer auf die Fahne geschrieben haben, mit der Besatzungsmacht Rom Kompromisse eingehen? Da immer nur ein Modell in der Alltagswirklichkeit umgesetzt werden konnte, stritten in Israel die gesellschaftlichen Gruppen nicht nur generell um die Konzeption der Gottesherrschaft, sondern sie kämpften stets auch für die politische Durchsetzung ihrer eigenen Option. Die Hasmonäer wurden militärisch aktiv, die Sadduzäer und die Herodianer lavierten politisch, um ihr Modell zu verwirklichen.
Eine Machtpolitik besonderer Art verfolgten die so genannten Apokalyptiker. Sie setzten weder auf Politik noch auf Militär, sondern allein auf die Initiative Gottes: Er selbst ist es, der in einer kosmischen Katastrophe den Feinden Israels den Garaus macht und ein neues, von Feinden befreites Israel entstehen lässt. Wohlgemerkt: Das alles erwarten Apokalyptiker für die Zukunft. „Gottesherrschaft“ gibt es erst im neuen Äon, nach Abbruch der zu Ende laufenden Geschichte. Damit sprachen sie gegenwärtig praktizierten Herrschaftsmodellen die Legitimation rundweg ab. Allerdings blieben bei dieser gemeinsamen Grundoption die präzisen Verfassungsstrukturen noch völlig offen. Nach Dan 7 steht der „Menschensohn“, dem alle Gewalt und Macht von Gott übergeben wird, für Gesamtisrael, nach Dan 12 werden allein die Lehrer Israels, die zum rechten Tun angeleitet haben, ausgezeichnet, gemäß den sibyllinischen Orakeln werden die Propheten als gerechte Richter und Herrscher amtieren (Oracula Sibyllina III 781f.).
Die Vorstellung Jesu von der Gottesherrschaft ist prinzipiell in diesem apokalyptischen Strom zu verorten. Aber: (1) Nach Jesus hat die in der Zukunft erwartete Gottesherrschaft bereits begonnen und in Israel Fuß gefasst. Indiz dafür sind ihm die gelungenen Dämonenaustreibungen. Der Satan als eigentlicher Drahtzieher hinter den feindlichen Bedrohungen Israels ist bereits besiegt (vgl. Lk 10,18; 11,20). (2) Jesus dachte nicht nationalistisch, sondern mythologisch, nicht kosmisch, sondern fragmentarisch: Die Gottesherrschaft beginnt mitten in der alten Welt; nicht die Feinde werden aus dem Land geworfen, sondern Menschen von dämonischer Macht befreit; die Gottesherrschaft beginnt nicht universal auf einen Schlag, sondern punktuell – und sie wächst ständig; sie wird von einem außenpolitischen (Herrschaft Israels über die Heiden) zu einem innenpolitischen Thema (Menschen, die sich für die von Gott geschaffenen Möglichkeiten öffnen). (3) Souverän der Gottesherrschaft, wie sie sich Jesus vorstellte, sind die zwölf Stämme Israels. Dafür steht als symbolischer Akt die Auswahl der Zwölf. Nicht ihre Namen, die in den verschiedenen Listen wechseln (vgl. Mk 3,16–19; Mt 10,2–4; Lk 6,14–16), sind wichtig, sondern ihre Anzahl; nicht ihre Tätigkeit (auch die Siebzig werden zur Mission ausgesendet: Lk 10,1) ist entscheidend, sondern ihre sichtbare Erscheinung. Sie repräsentieren die zwölf Stämme Israels – und aus diesem Grund handelt es sich nur um Männer. Mit diesem Realsymbol griff Jesus auf ein vorstaatliches Verfassungsmodell zurück: auf Israel, wie es Gott im Anfang gewollt hat (vgl. Josephus, Antiqu. XI 107). Mit dieser Konzeption überstieg Jesus einerseits das innenpolitische Ränkespiel zwischen den einflussreichen Gruppen, zum anderen die außenpolitischen Absetzungsversuche etwa gegenüber den Samaritanern, die sich zwar selbst als Nachkommen der beiden Jakobsstämme Ephraim und Manasse betrachteten (vgl. ebd. XI 341), gemäß der offiziellen Sicht des Tempelstaates Judäa jedoch als Ausländer, Häretiker und Gewalttäter ausgegrenzt und nicht mehr zu Israel gezählt wurden (vgl. 2 Kön 17,24–41; Josephus, Antiqu. IX 277–291). Mit Bezug auf den prophetischen Gedanken von der Restitution Israels am Ende der Zeit (vgl. Jes 11,12; Mich 2,12f.) sah Jesus in der Gottesherrschaft die Verlorenen Israels gesammelt: sowohl die Gruppen, die im Laufe der Geschichte „verloren gegangen“ sind (Samaritaner, die „Zerstreuten“ in der Diaspora), als auch die Individuen, die durch ihre persönliche Geschichte „verloren gegangen“ sind und deshalb ausgegrenzt wurden (die Kranken; die Zöllner, die mit den kompromissbereiten Herodianern zusammenarbeiten).
Die Verfassung der Gottesherrschaft, wie sie Jesus vorschwebte, war zuallererst an seinem Verhalten ablesbar. Es kulminierte in den Mahlfeiern, in denen – im Fragment – nicht nur das für die Endzeit verheißene Mahl in der Gottesherrschaft (vgl. Jes 25,6–8) bereits erlebt wird, sondern auch „ganz Israel“ versammelt ist, wenn neben galiläischen Fischern auch Zöllner und neben Gesunden auch Kranke partizipieren. Mit Gleichnissen und Bildworten warb Jesus für seine Sicht der Dinge – und für seine Praxis. Er verstand sie als eine Reaktion auf die Vorgabe Gottes. Er war nicht der Akteur und auch nicht der Initiator der Gottesherrschaft, sondern deren Mediator, Interpret und Propagandist. Er praktizierte eine Verfassung der Gottesherrschaft, nach der das Volk in den zwölf Stämmen der Souverän ist – und das heißt: in die alle, die sich von Gott suchen und finden lassen, integriert werden.
Hat Jesus eine Kirche gegründet?
Schaut man auf das „Gottesherrschaftsprojekt“ Jesu, so zeigt sich: Jesus hat weder einen Gründungsakt vollzogen (denn die Initiative geht auf Gott zurück) noch eine bestimmte Verfassung abgesegnet. Aber: Er hat eine Magna Charta für seine Option des Gesellschaftsprojekts „Gottesherrschaft“ mit seinem eigenen Leben geprägt. Er hat weder eine Weisung für noch eine gegen die Heiden verabschiedet. Aber er hat in den kleinen Verhältnissen von Galiläa die Integration von scheinbar abtrünnigen Juden praktiziert. Damit sind weite Gestaltungsspielräume eröffnet. Allerdings: „Gottes Volk“ können Jesu Nachfolger niemals losgelöst von Israel sein, und sie können diesen Ehrentitel nicht exklusiv für sich in Anspruch nehmen. Zudem: Die Ausgestaltung der Amtsstrukturen im Gesellschaftsprojekt „Gottesherrschaft“ liegt immer in der Entscheidung des Volkes Gottes als des eigentlichen Souveräns. Wenn „Kirche“ sich in diesem Sinn als je neuer Konkretisierungsversuch der Gottesherrschaft in den Konturen Jesu versteht und sich verpflichtet weiß, den von Gott eröffneten Gestaltungsraum je neu zu nutzen, dann kann man allen Ernstes sagen: Sie führt die Intention Jesu fort.
Diese Sicht wird gerade durch Mt 16,18f. unterstützt – jedenfalls sobald man diese Stelle nicht isoliert für sich, sondern im Kontext des Gesamtevangeliums liest. Dann nämlich stößt man auf einen Konkretisierungs–, besser: Justierungsversuch innerhalb der matthäischen Gemeinde. Mit der Zusage: „Geben werde ich dir die Schlüssel der Herrschaft der Himmel, und was immer du bindest auf der Erde, wird gebunden sein in den Himmeln, und was immer du löst auf der Erde, wird gelöst sein in den Himmeln“ wird Petrus eine ungeheure Vollmacht zugesprochen: die letztgültige Verfügungsgewalt hinsichtlich der je neu fälligen Entscheidungen über religiöse Vorschriften. Im Duktus des Gesamtevangeliums gelesen wird diese einseitige Vorrangstellung des Petrus allerdings erheblich relativiert: (1) Das Bekenntnis: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“ (Mt 16,16), die eigentliche Basis für die folgenreiche Zusage Jesu in Mt 16,18f., spricht Petrus der Jüngergemeinde nach, der dieses Bekenntnis auszusprechen geschenkt wird, als sie die Rettung des im Sturm versinkenden Petrus erlebt und im Blick auf seinen Retter Jesus akklamiert: „Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn“ (Mt 14,33). (2) Die Souveränität der Gemeinde kommt zum Zug, wenn ihr in Mt 18,18 mit den gleichen Worten die gleiche Vollmacht zugesprochen wird wie Petrus in Mt 16,19, vielleicht stärker zugespitzt im Blick auf die disziplinarischen Maßnahmen. (3) Inhaltlich wird die Schlüsselgewalt des Petrus durch den dunklen Kontrast von Mt 23,13 gesteuert: Im Gegensatz zu den Pharisäern, den führenden Köpfen des Judentums zur Zeit des Matthäus, soll Petrus (durch seine Entscheidungen) den Menschen das Himmelreich aufschließen und sie hineingehen lassen – also im weitesten Sinne die rechtlichen Grundlagen für eine mögliche Integration legen. Gerade an Mt 16,18f. also, einer alten Tradition, die Petrus weit reichende Vollmachten zuschreibt, können wir exemplarisch den Prozess beobachten, wie einseitige Machtkonzentrationen korrigiert und an ursprünglich jesuanische Intentionen wieder herangeführt werden. Dieser Prozess des Ringens um die jeweils angemessene Verfassung unter je neuen gesellschaftlichen Bedingungen durchzieht die gesamte Geschichte des Urchristentums. Die heftigsten Streitigkeiten betreffen gerade die Punkte, zu denen Jesus nichts (Beschneidung/Heiden), Rätselhaftes (Reinheitsfrage: vgl. Mk 7,15) oder Ambivalentes (Tempel: vgl. Mt 5,23f. mit Mk 14,58) gesagt hat.