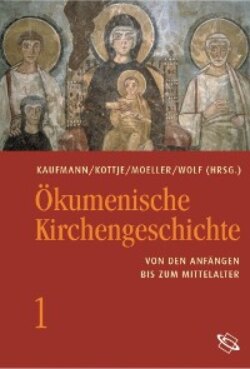Читать книгу Ökumenische Kirchengeschichte - Группа авторов - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Christen im Römischen Reich
ОглавлениеAußer der römischen Infrastruktur kam den urchristlichen Missionaren vor allem die jüdische zugute: die Synagogalgemeinden in der Diaspora. In den Städten des Römischen Reiches waren sie als collegia licita verfasst und genossen Privilegien, die außer dem Recht auf Versammlungen und die Einhaltung der Sabbatruhe vor allem die Befreiung vom paganen Kult, insbesondere vom Kaiserkult betrafen. Nachdem im antiken Herrschaftssystem die Loyalität zum jeweiligen Herrscher oder zur jeweiligen Kommunität über die Teilnahme am staatstragenden Kult demonstriert wurde, ist den jüdischen Gemeinden ein Kunststück gelungen: Sie waren von der kultischen „Gemeinschaft“ befreit – und doch als loyale Mitbürger anerkannt. Innerhalb der griechischen Städte lebten sie als die „Anderen“, klar erkennbar an ihrer Abstinenz vom paganen Kult auf der einen und durch ihre rituellen Vorschriften (Beschneidung, Speisegebote), durch die sie sich gesellschaftlich distanzierten, auf der anderen Seite. Dieser Status war das Ergebnis einer jahrhundertealten Erfahrung (seit dem babylonischen Exil; vgl. Jer 29,7) und zäher Verhandlungstaktik mit den jeweiligen Herrschern. Juden regelten ihre Beziehung zur Umwelt und zur jeweiligen Staatsmacht auf rechtlicher Basis: Ihrerseits brachten sie ihre Loyalität durch Gebet für die Herrschenden zum Ausdruck (gemäß dem Slogan: nicht dem Kaiser, sondern für ihn opfern; vgl. Philo, Legatio ad Gajum 357) – und konnten dafür mit Wohlwollen und Entgegenkommen rechnen.
Dieses klare Konzept wurde von denjenigen urchristlichen Missionaren durchkreuzt, die auf die Beschneidung als Tor und Grenzlinie zum Judentum verzichteten und z.T. (wie Paulus) sogar die durch die Speisegebote sichtbar „getrennten Tische“ aufgeben wollten. Weil mit diesem Vorstoß das staatsrechtliche Konstrukt, das Juden eine eigene, unterscheidbare Kultur innerhalb des Römischen Reiches und der Städte garantierte, ohne dass sie ihren Monotheismus aufgeben mussten, empfindlich gestört wurde, wehrten sich jüdische Gemeinden vehement gegen die Dekonstrukteure in ihren eigenen Reihen. Die „Unruhen“, von denen in römischen und neutestamentlichen Quellen die Rede ist, dürften genau diesen Konflikt spiegeln. Die Notbremse, die jüdische Gemeinden zu ihrem Selbstschutz zogen, bestand darin, auch das Verhältnis zu diesen neuen Gruppen auf eine rechtliche Basis zu stellen, d.h. sich offiziell von ihnen zu distanzieren, in Antiochien vermutlich zum ersten Mal. Über das Judenedikt des Claudius (49 n. Chr.) wissen wir von ähnlichen Konflikten in Rom, die Polemik des Paulus in 1 Thess 2,14–16 gegen die Juden dürfte mit einer lokalen Reaktion in Thessalonich auf die Maßnahme in Rom im Zusammenhang stehen. Der erste Eindruck, den römische Magistrate von christlichen Gruppen gewinnen mussten, war der von „Unruhestiftern“ – für die römische Staatsräson, deren oberstes Ziel Ruhe und Ordnung im Reich war, eine gefährliche Klassifizierung. Sie passte genau zum Idol der Christen: als Gekreuzigter war Jesus als Aufrührer gebrandmarkt. Dass er als „Christus“ verehrt wurde, missverstanden die Massen im Sinn des Sklavennamens „Chrestos“ – und nannten die Gruppe einfach „Chrestianer“/Sklavenpack (vgl. Sueton, Vitae V 25,4). Kein Wunder, dass es nicht schwer fiel, ihnen in der neronischen Verfolgung (64 n. Chr.) die Schuld am Brand Roms anzulasten (vgl. Tacitus, Ann XV 44,2–5).
Damit gerieten die „Christen“ zwischen die Fronten. Ohne die rechtliche Rückendeckung der jüdischen Gemeinden wurde das Fernbleiben vom Staatskult für sie zur lebensgefährlichen Provokation. Der Opfertest vor einem Bild des Kaisers, wie ihn Kaiser Trajan auf die Anfrage seines Statthalters Plinius hin etablierte (Plinius X 96f.), entsprach der römischen Staatsräson und machte den „Namen Christ“ – im Sinn verweigerter Loyalität – zum Kapitaldelikt (crimen maiestatis). Dass in der neutestamentlichen Tradition trotzdem nur wenige Märtyrer namentlich genannt werden können (vgl. Offb 2,13), dürfte damit zusammenhängen, dass Trajan nur zuließ, persönlichen Anzeigen gegen Christen nachzugehen, nicht aber anonymen – offensichtlich um Massenhinrichtungen zu vermeiden.
Nicht viel anders sieht die Sachlage im Land Israel, also im jüdisch dominierten, aber von den Römern besetzten Gebiet, aus. Auch hier hatte sich die jüdische Aristokratie einen sensiblen status vivendi mit dem Römischen Reich aufgebaut – mit dem Ehrgeiz, die Autonomie noch zu vergrößern. Die jüdischen Verantwortlichen standen unter dem permanenten Druck, auf der einen Seite mit den Römern zusammenarbeiten zu müssen, auf der anderen Seite ihre Treue zur jüdischen Nationalität unter Beweis zu stellen. Die beiden Jerusalemer Märtyrer, der Zebedaide Jakobus (43 n. Chr.) sowie der Herrenbruder Jakobus (62 n. Chr.), könnten Opfer dieser Gratwanderung geworden sein. Aufgrund seines vertrauten Umgangs mit Kaiser Claudius und seinen angeblichen Interventionen bei dessen Erhebung zum Kaiser gelang es Agrippa I., König von Gesamtisrael zu werden (41–44 n. Chr.) – wie sein Großvater Herodes der Große. Mit der Hinrichtung des Zebedaiden wehrte er sich einerseits gegen eine Gruppe, die mit ihrer eschatologischen Hoffnung auf das Erscheinen Gottes am Tempel (vgl. S. 18) seiner realpolitischen Taktik im Wege stand. Auf der anderen Seite konnte er durch die Praktizierung des wiedererlangten ius gladii (Recht zur Hinrichtung durch das Schwert) jüdischen Nationalstolz mobilisieren (vgl. Apg 12,1–5) – und mit seiner Person in Verbindung bringen. Die Hinrichtung des Herrenbruders steht im Kontext der veränderten politischen Situation kurz vor dem Jüdischen Krieg (66–70 n. Chr.): Im Land formierten sich Widerstandsgruppen gegen die römische Herrschaft, die erneut durch einen Prokurator wahrgenommen wurde. Jetzt war es der jüdische Hohepriester Ananus, der einerseits den Status quo nicht gefährden wollte, andererseits denen gegenüber, deren Ziel es war, das Land von den Römern zu befreien, unter Legitimationsdruck stand. Er nutzte ein römisches Machtvakuum, hinterging also die römische Kapitalgerichtsbarkeit, setzte die typisch jüdische Nationalstrafe, die Steinigung, ein und brachte einen Mann zu Fall, der mit Gruppen in Verbindung stand, die jüdische Identität in der Diaspora durch ihre beschneidungsfreie Missionspraxis untergruben.
Die beiden Grundpfeiler des Christentums, die eschatologische Botschaft des Jesus von Nazaret (vgl. S. 20f.), die mit der Vision des Gottesreiches prinzipiell herrschaftskritisch ist, sowie der Vorstoß des Stephanuskreises, die Beschneidung als jüdisches Identitätsmerkmal fallen zu lassen (vgl. S. 30f.), brachten christliche Gruppen in Schwierigkeiten, sowohl in Bezug auf das Judentum als auch den römischen Staat. Die Frage nach dem eigentlichen „Ort“ der christlichen Gruppen, d.h. ihrer spezifischen Identität, stand im Raum. Kein Wunder, dass intern um die Marschroute gerungen worden ist. Von den drei Richtungen, die bereits beim antiochenischen Zwischenfall sichtbar wurden, hat letztlich die paulinische gesiegt. Die Gegenposition, die auf „getrennten Tischen“ und damit auf den typisch jüdischen Grenzziehungen auch für die Jesusanhänger beharrte, sorgte zwar in paulinischen Gemeinden für einigen Wirbel, konnte sich aber auf Dauer gegenüber dem Mainstream des Judentums nicht profilieren. Die Mittelposition, die von Jerusalem aus mit dem Aposteldekret verfolgt wurde, war nur vorübergehend erfolgreich. Mit der Zerstörung Jerusalems 70 n. Chr. ging das geographische und symbolische Zentrum dieser Richtung verloren, die Idee des erneuerten Israel mit der christlichen Gemeinde am Zion als Vortrupp (vgl. S. 18) verlor an Stoßkraft. Das lukanische Doppelwerk, in dessen Einzugsbereich (vermutlich die Provinz Asia) die Jakobusklauseln galten, verlegt deshalb den wahren Tempel in den Himmel (vgl. Apg 7,44–50.55f.). Gemeinden im Einflussbereich des Matthäusevangeliums sahen in der Zerstörung Jerusalems ein Strafgericht über das „Volk“, das Jesus verurteilt hatte (Mt 22,7; 27,25). Insofern wäre ein neuer Anfang möglich gewesen, geworben wurde allerdings nur um das einfache Volk, nicht um die Eliten der Synagoge.
Die paulinische Variante setzte sich durch. Losgelöst vom Judentum musste sie einen Modus Vivendi mit dem römischen Staat suchen. In Röm 13,1–7 sind erste Spuren davon zu finden. Die Pastoralbriefe setzen diese Linie fort (Tit 3,1), stellen christliche Gemeinden als „braves“ Haus vor Augen, in dem selbstverständlich auch für die Herrscher gebetet wird (1 Tim 2,2), und passen sich mit der Verbannung der Frau aus der Öffentlichkeit der Gemeinde dem konservativen Mainstream der römischen Gesellschaftsvorstellung an.
Natürlich gab es auch vehemente, z.T. subversive Kritik gegenüber der Annäherung an den römischen Staat. Das herrschaftskritische Moment betont das Markusevangelium. Den „Evangelien“ vom Herrschaftsantritt der Flavier (69 n. Chr.; vgl. Josephus, Bellum Judaic. IV 618. 656) wird der „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus“ (Mk 1,1) entgegengestellt. Jesus sagt den Beginn der Gottesherrschaft an (Mk 1,14f.) und lässt deren Manifestation in seinen Machttaten in Erscheinung treten. Jesu „Karriere nach unten“ wird als Kontrastweg zum Aufstieg der Flavier stilisiert. In Jesu Gefolgschaft entsteht eine solidarische Gegengesellschaft ohne patriarchalische Herrschaftsstrukturen (vgl. Mk 3,31–35; 10,42–45). Sublim fällt dagegen die Kritik bei Lukas aus: Narrativ demaskiert er den „Retter“ Augustus, indem er von seinen angeblich unübertreffbaren Wohltaten einzig dessen Steuerpolitik auf der Grundlage des Zensus hervorhebt (Lk 2,1–14). Auf der anderen Seite jedoch zeichnet Lukas bereits die Vision einer gerechten Behandlung der Christen vor römischen Gerichten (vgl. Apg 18,12–17).
Am schärfsten fällt die Kritik sicher in der Offenbarung aus. Der römische Staatsapparat wird – wohl aus traumatischen Erfahrungen, die die Überlieferungsträger in Palästina im Jüdischen Krieg gemacht haben – mit einem unbarmherzigen und unberechenbaren Tier verglichen, das letztlich vom Satan gesteuert wird (Offb 13). Wer sich mit ihm einlässt, und sei es auch nur durch (innerlich distanzierte) Teilnahme am Kaiserkult, läuft Gefahr, von diesem Ungetüm zermalmt zu werden. Es sind diese Leute, derentwegen die Offenbarung zu solch drastischen Bildern greift. Es geht um den Feind im Innern, um alle, die den so genannten „weichen Kaiserkult“ praktizieren: die an den Vereinsmählern und städtischen Prozessionen teilnehmen, um ihre Loyalität gegenüber Stadt und Kaiser zu zeigen und durch die entsprechenden Verbindungen wirtschaftlich und gesellschaftlich zu profitieren, ohne ihrerseits in Konflikte mit dem Eingottglauben zu kommen. Bereits in den paulinischen Gemeinden wurde das Basisargument dafür zu Wort gebracht: Wenn die Götzen „Nichtse“ sind, kann man an deren Kult teilnehmen, ohne den Glauben an den einen Gott zu verleugnen (vgl. 1 Kor 8,1–4).
Sicher ist es in diesem Fall zu früh, von „Gnosis“ zu sprechen. Aber die Sache deutet sich in der Struktur bereits an: Politische Unauffälligkeit wird dadurch erreicht, dass der eigene Glaube in einer Art „Metareligion“ auf seine transzendenten Voraussetzungen hin überformt und Religion nicht an nach außen klar gezeigte Gruppenzugehörigkeit gebunden, sondern als privater Heilsweg verstanden wird. Das Denksystem tritt deutlicher in Erscheinung im Umkreis der johanneischen Gemeinde und der Pastoralbriefe. Im einen Fall geht es um die Abwehr doketischer Christologie (1 Joh 4,2f.; 2 Joh 7), im anderen um das Einstehen für die gute Schöpfung (1 Tim 4,1–4): Wird Jesus zum himmlischen Erlöser stilisiert, der nur einen Scheinleib besitzt bzw. dessen Double gekreuzigt wird, ist das Paradigma dafür geschaffen, sich selbst über diejenigen zu erheben, die für die Bezeugung ihres Glaubens das Martyrium auf sich nehmen. Werden Welt und Schöpfung als ein himmlischer Betriebsunfall und die eigentlich erstrebenswerte Wirklichkeit in der Rückkehr ins Lichtreich gesehen, verlieren bestimmte Fragen, beispielsweise die Teilnahme an paganen kultischen Feiern betreffend, ihre Bedeutung.
Bereits in der Geschichte des Urchristentums bis etwa 150 n. Chr. zeichnen sich die Linien ab, die sich als wegweisend erwiesen haben und im Kanon dokumentiert worden sind. Während christliche Gruppen gegenüber dem Judentum und dem Römischen Reich differenzierte Abgrenzung bzw. Anpassung praktizierten, zogen sie gegenüber der gnostischen Versuchung einen klaren Trennstrich. Alles konnte im Kanon seinen Platz finden, nur nicht die Abwertung der Schöpfung oder die Infragestellung der vollen Menschlichkeit Jesu bis in seinen Tod. Die Haltung der religiösen Privatisierung, der Rückzug in eine Vernunftreligion, die auf die Auseinandersetzung mit anderen Richtungen und auf die Anbindung an bestimmte soziale Gruppen mit den entsprechenden Verpflichtungen verzichtet, wurde nicht akzeptiert. Im Blick auf das Judentum wurden zwar die strukturellen Identitätsmerkmale Beschneidung und Speisegebote abgelehnt und stattdessen ein eigener, völlig unauffälliger, dafür viel gesellschaftsfähigerer Ritus gesetzt, die Taufe, aber die theologische Grundoption des Judentums blieb die gemeinsame Basis: die geschichtstheologische Sicht nämlich, dass der eine Gott nicht nur die Welt gut geschaffen hat, sondern sein Wirken auch in der Geschichte, in den Strukturen der materiellen Welt zeigt und auch weiterhin manifestieren wird. Während Paulus seine heidenchristlichen Gemeinden lediglich als auf den edlen Ölbaum Israels aufgepfropfte wilde Zweige gesehen und um die Rettung Israels theologisch gerungen hatte (Röm 9–11), wurde zwei Generationen später Israel theologisch enterbt (Barnabasbrief) bzw. christliche Identität durch Absetzung vom Judentum definiert (Markion). Erneut war es der zweiteilige Kanon, der für Klärung sorgte: Das alttestamentliche Erbe blieb Basis für das orthodoxe Christentum. Im Blick auf den römischen Staat erwiesen sich die theologischen Positionen zwar als unvereinbar (Monotheismus, d.h. Abstinenz vom paganen Kult), strukturell jedoch waren Christen zur Anpassung bereit, um Anerkennung zu finden. Die Pastoralbriefe bauten das Haus der Gemeinde bereits entsprechend um (vgl. S. 44); trotz Ablehnung und Diskriminierung von Seiten der paganen Umwelt mahnt 1 Petr die fraglose Unterordnung unter Kaiser und Statthalter an. Christen sollen sich – obwohl sie in dieser Welt als Fremde leben – aufgrund ihres praktizierten Glaubens als die besseren Römer erweisen und so für ihre eigene Sache werben (2,11–17). Trotz dieser Bemühungen blieb die prinzipielle Rechtsunsicherheit der christlichen Gemeinden bestehen. Erst unter Konstantin dem Großen wurde sie geklärt (313 n. Chr.). Im Unterschied zu den jüdischen Diasporagemeinden, die die rechtliche Anerkennung durch den römischen Staat dafür nutzen, um sich durch Verehrung des einen Gottes und die Praktizierung einer eigenen Kultur von der römischen Gesellschaft abzugrenzen, ließen sich christliche Gruppen durch die Anerkennung ihrer Religion in die Reichsstrukturen integrieren: Der Christengott wurde zum Reichsgott, zunächst sogar neben den paganen Staatsgöttern, die Leiter ihrer Gemeinden zu staatlichen Beamten. Allein im Kanon sind die widerständigen Schriften (Offb, Mk, Lk) ein ständiger Stachel im Fleisch geblieben.
* Mit dem Sigel „Q“ ist der rekonstruierte Q-Text (vgl. Hoffmann/Heil) in der Zählung des Lk gemeint.