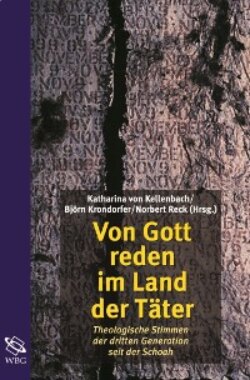Читать книгу Von Gott reden im Land der Täter - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nachkriegs- oder Post-Shoah-Generation?
ОглавлениеDer Ruf nach einem Abschied von familiengeschichtlicher Unschuld bedeutet für Theologen und Theologinnen der dritten Generation zunächst einmal, sich dem in der Familie überlieferten Material an Erzählfragmenten mit kritischer Vorsicht zu nähern. Es ist inzwischen bekannt, wie stark der intergenerationelle Dialog in Mitläufer- und Täterfamilien vom Schweigen und Verschweigen gekennzeichnet ist. Daher mag es verständlich sein, dass sich Kinder und Enkel an die wenigen Geschichten klammern, die ihnen überliefert wurden. Aus den Fragmenten versuchen wir, ein Bild von unseren Eltern, Großeltern und dem weiteren Familienkreis zu gewinnen. Es sind aber gerade diese tradierten Fragmente, die es zu reflektieren gilt und die einer „Hermeneutik des Verdachts“ unterzogen werden müssen. Denn das erinnernde Erzählen orientiert sich an transindividuellen Mustern und Strategien, die unter gesellschaftlichen Legitimationszwängen stehen.
Eine dieser diskursiven Strategien ist bereits in den oben angeführten Beispielen deutlich geworden: Die Rekonstruktion von Lebensgeschichten nichtverfolgter Deutscher setzt beispielsweise nicht mit dem Januar 1933, sondern typischerweise mit den letzten Kriegsjahren und ersten Nachkriegsjahren ein. Damit rücken Geschichten von Flucht und Vertreibung, von alliierten Bombenangriffen und Kriegsgefangenschaft, von Hunger und Kälte in den Vordergrund. In ihnen sind Deutsche Subjekte des Leidens – eine Strategie, die auch von der deutschen Geschichtsforschung der 50er Jahre forciert worden ist (vgl. Moeller 1996). Ausgeblendet bleiben die Jahre vor 1944. Deshalb tauchen – und dies ist ein zweites Muster – Juden oder andere rassisch Verfolgte in Familiengeschichten nie oder nur selten auf. Ob, wie lange und in welcher Weise die eigene Familie Kontakt mit der jüdischen Bevölkerung hatte, ob sie tatenlos beim Abtransport zusah oder tatkräftig bei der Verfolgung mithalf, inwieweit sie als Zivilisten oder Soldaten an dem blutigen Geschehen vor allem in Osteuropa beteiligt waren – all diese Fragen sind, mit wenigen Ausnahmen, nicht Teil der erinnerten Erzählfragmente.
Wenn Juden in deutschen Familiengeschichten erwähnt werden – dies ist ein drittes präventiv-defensives Muster –, dann meist im Zusammenhang einer Hilfeleistung, die man ihnen zukommen ließ. Solche „guten“ Geschichten, die auch vor 1944 zurückreichen, zirkulieren nicht nur in Familien, die sich im Umfeld der Bekennenden Kirche oder des politischen Widerstands bewegten. Auch in anderen Familien gibt es sie; denn die selektive Erinnerung klammert sich gerne an den einen Moment in zwölf Jahren nationalsozialistischer Diktatur, wo möglicherweise eine helfende Hand einem Bedürftigen entgegengestreckt wurde. Menschliche Regungen des Mitgefühls waren punktuell selbst unter eingefleischten Antisemiten möglich. Nach dem Krieg wurde diese angebliche Hilfe strategisch zur Verteidigung von NS-Verbrechern eingesetzt und hat zur populären Mythologisierung einer „guten“ Familiengeschichte beigetragen.
Wie andere in meiner Generation habe ich diese Muster in der eigenen Familie kennen gelernt – nicht etwa, weil meine Eltern absichtlich verheimlichen wollten, sondern weil sie und ich an einem kulturellen Diskurs beteiligt waren, den zu durchschauen und zu durchbrechen aktiver Erinnerungsarbeit bedarf. Was ich beispielsweise von meinem Vater wusste, der den gleichen Jahrgängen wie Moltmann und Metz zugehört, hat sich für lange Zeit auf wenige Geschichten über seine Jugend beschränkt, die er im Zwiespalt zwischen katholischer Kirche und Hitlerjugend verbrachte. Dazu gesellten sich ein paar Episoden aus den letzten Kriegsmonaten und seiner Haft im tschechoslowakischen Gefängnis. Erst ein Zufall, der sich über meine Freundschaft mit einem (heute in den USA lebenden) jüdischen Überlebenden aus dem polnischen Sosnowiec ergab, öffnete einen Teil seiner bisher verdeckten Geschichte. Plötzlich stand mein Vater, der damals 17-Jährige, in unmittelbarer Nähe eines jüdischen Arbeitslagers in Oberschlesien. In einem mehrjährigen Prozess, den ich an anderer Stelle ausführlich beschrieben habe (Krondorfer 2000b; 2002), entwickelte sich meine Familiengeschichte weg von einer selektiven Kriegs- und Nachkriegsgeschichte hin zu einer Erinnerung, die die Judenverfolgung nicht mehr ausblenden konnte. Dazu gehörte eine mehrtägige Reise mit meinem Vater an die Orte seiner Vergangenheit, einschließlich unserer Suche nach den Resten von Blechhammer, einem vergessenen Konzentrationslager im heutigen Polen, in dessen Nähe er an Flugabwehrkanonen ausgebildet wurde. Während unserer gemeinsamen Reise stellte sich mein Vater seiner Geschichte ohne Vorbehalte: Erstmals tauchten Juden und ein jüdischer Kindheitsfreund in seinem ehemaligen sudetendeutschen Heimatort auf, sowie jüdische Häftlinge, die er nicht nur in Sträflingskleidung in Blechhammer gesehen hatte, sondern mit denen er auch einen Tag nach der Befreiung in Theresienstadt konfrontiert war.
Es bedarf solch einer aktiven Erinnerungsarbeit, um sich nicht nur als Nachkriegs-, sondern auch als „Post-Shoah-Generation“ zu begreifen. Diese Begrifflichkeit klingt in der deutschen Sprache etwas unbeholfen, vielleicht sogar wie eine Anmaßung: Wenn wir uns als eine deutsche „Post-Shoah-Generation“ bezeichnen, eignen wir uns dadurch die Opfergeschichte an? Tatsächlich aber geht es mir hier um eine Durchbrechung und Erweiterung des selektiven „Nachkriegs“-Erinnerns, das familiäre Verbindungen zum Völkermord von vornherein ausschließt. Zugespitzt formuliert: Warum wird mit dem Jahr 1945 beginnend allgemein von der „deutschen Nachkriegszeit“ geredet, aber nicht von „Deutschland nach dem Judenmord“? Die Geschichten über die Nachkriegszeit brauchen als Korrektiv nicht nur die Zeugenschaft der Opfer und Überlebenden, sondern auch ein Bewusstwerden unserer eigenen Verknüpfungen mit dem genozidalen Antisemitismus, so dass die Shoah nicht mehr als geschichtliche Größe oder rein intellektuelle Herausforderung vom emotionalen Erleben und der lebensgeschichtlichen Herkunft abgespalten werden kann. Nach Jahren der gesellschaftlichen Verdrängung wird die Shoah durch unser aktives Nachfragen und Nachforschen wieder Teil der eigenen Geschichte, die sie ja immer schon gewesen ist – häufig in intimerer Weise als zuvor bekannt. Kinder jüdischer Überlebender mussten dies viel früher erkennen, da sie vom Holocaust existentiell betroffen waren. Sie schlössen sich (vor allem in den USA) als „second generation“ oder „children of survivors“ zusammen; inzwischen bringen sie ihre Erfahrungen auch in die intellektuellen Debatten ein. Beispielsweise hat die Literaturwissenschaftlerin Marianne Hirsch, selbst Kind jüdischer Überlebender, das Konzept der postmemory entwickelt, womit sie darauf hinweisen will, wie sehr die gelebte Erinnerung ihrer Eltern zu einem lebendigen Teil ihrer selbst wurde, obwohl sie die Erinnerungen ihrer Eltern nur aus Erzählungen kennt (Hirsch 1998). Diese Lebendigkeit bzw. dieses Lebendig-Machen der Erinnerung an die Shoah fehlt weitgehend unter den Nachkommen der ehemaligen Tätergesellschaft. Ironischerweise gehört es zum „Privileg“ einer Tätergesellschaft, sich den Täteranteilen in der eigenen Familiengeschichte nicht stellen zu müssen. Deshalb besteht zwischen den Nachkommen von Opfern und (Mit-)Tätern ein bleibendes Ungleichgewicht, eine gegenwärtige und nachhaltige Ungerechtigkeit, die mit dem historischen Unrecht der Shoah begonnen hat.
Als Nachkriegsgeneration bleiben nicht-verfolgte Deutsche einem familienbiographischen Erinnern verhaftet, das das Leiden und den Opferstatus der Deutschen (unreflektiert und vorbewusst) zum Ausgangspunkt der Erfahrung und des Denkens macht. Eine deutsche Post-Shoah-Generation dagegen stellt sich auch den eigenen Anteilen einer Tätergeschichte. Sie arbeitet einer Abspaltung zwischen einer historisierenden, politischen Aufarbeitung des Holocaust und der emotional erlebten Tradierung von Nachkriegsgeschichten im Familienkreis entgegen. Davon zeugen in diesem Band auch die Beiträge von Britta Jüngst und Katharina von Kellenbach. Sie machen u.a. deutlich, welche schwer zu bewältigende Aufgabe vor uns liegt – emotional, intellektuell, theologisch.
Eine aktive Erinnerungsarbeit, die in Deutschland auf das persönliche und emotionale Einbeziehen der Shoah insistiert, kann verhindern, dass „Kinder und Enkelkinder … jeden noch so entlegenen Hinweis in den Familienerzählungen auf gute Taten ihrer Eltern oder Großeltern [nutzen], um Versionen der Vergangenheit mit ihnen als gute Menschen zu erfinden“ (Korn 2001). Positiv formuliert: Theologen und Theologinnen, die sich als eine Post-Shoah-Generation verstehen lernen, gründen ihr Wissen über ihre Herkunft nicht auf Halb- und Teilwahrheiten, auf Verdrehungen, Verleugnungen oder gar Lügen, sondern auf dem Versuch einer realistischen Einschätzung der Täteranteile in der eigenen Familie. Damit, so wäre zu hoffen, werden sie weniger anfällig für Vermeidungsstrategien, theologische Vereinnahmungen und falsche Identifizierungen.
Darf man den anekdotischen Erfahrungen derjenigen in der dritten Generation trauen, die diesen Schritt in Ansätzen vollzogen haben, so hören wir beispielsweise, es gelänge ihnen, die Last vager Schuldgefühle abzustreifen zugunsten von Fragestellungen nach juristischer Gerichtsbarkeit und moralischer Gerechtigkeit. Erstaunlicherweise scheint gerade der Abschied von familienbiographischer Unschuld eine menschliche Öffnung gegenüber den Zeugnissen der Opfer und gegenüber Überlebenden und deren Nachkommen möglich zu machen. Sie fühlen sich besser gegen eine Instrumentalisierung der Opfer gewappnet. Begegnungen mit den „Anderen“, in der Differenzen bestehen bleiben können, werden wichtiger als theologische Vereinnahmungen, in denen Unterschiede verwischt werden.