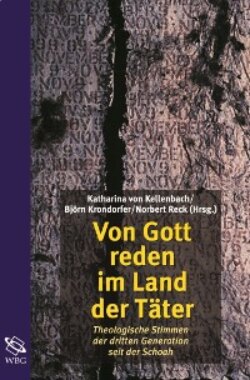Читать книгу Von Gott reden im Land der Täter - Группа авторов - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der stellvertretende Sühnetod Christi
ОглавлениеNatürlich sind die evangelischen Kirchenvertreter und Autoren der EKD-Denkschrift weit von dieser Nazitheologie entfernt. Dennoch spielt auch in der Denkschrift der stellvertretende Sühnetod Christi eine problematische Rolle. Denn er begründet über die Zitate des Römerbriefs im Epilog das kirchliche Amnestie- und Revisionsanliegen. Römer 3,21, „Nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart“, was wohl heißen soll, dass die Strafe als Gebot des „Gesetzes“ mit Verweis auf das Evangelium außer Kraft gesetzt werden soll. Damit werden theologische Begriffe der Versöhnungslehre in politisch-juristische Diskussionen über Strafbemessung eingeführt. Es wird behauptet, Christi sühnender Opfertod mache (harte) Strafe unnötig. Dieses Argument wurde schon 1939 von Karl Barth in Rechtfertigung und Schrift eingeführt, in der er sich gegen die Todesstrafe aussprach. Er schreibt:
Die vergeltende Gerechtigkeit Gottes hat sich nach christlicher Erkenntnis schon ausgewirkt, die von ihm geforderte Sühne für alle menschliche Übertretung ist ja schon geleistet, die geforderte Todesstrafe des menschlichen Rechtsbrechers ist ja schon vollzogen. Eben da hat Gott seinen eigenen Sohn hingegeben … Bedeutet das Ergebnis dieses gerechten Gerichts nicht: Barmherzigkeit, Vergebung für alle? (Barth, zit. in Janssen 1959, 148)
Wohl gegen seinen Willen begünstigte Barths christozentrisch begründetes Wort der „Vergebung für alle“ die Tendenz, NS-Täter jeglicher Verurteilung und Bestrafung zu entziehen (Barth 1945). In der bundesdeutschen Nachkriegsdiskussion erlangte diese Sühnetheologie, nach der Jesus Christus den Strafanspruch menschlicher Verbrecher schon abgeleistet hat, eine Vorrangstellung und führte zu einer Liberalisierung des Strafvollzugs. In der Strafrechtsdebatte nahm die evangelische Kirche liberale Positionen ein (vgl. Dombois 1959). In jüngeren kirchlichen Verlautbarungen wird Strafe hauptsächlich als pädagogische und rehabilitierende Maßnahme für die Täter gesehen. So schreibt zum Beispiel Joachim Track in seiner Rezension der EKD-Denkschrift zum Strafvollzug aus dem Jahre 1990: Nun „heißt es Abschied nehmen von der Orientierung an Rache und Vergeltung“. Stattdessen bedürfen Straftäter „zuallererst unserer Zuwendung, unserer Hilfe und unserer Solidarität“ (Track 1991, 30).
Aber was bedeutet das für die Opfer? Sollen die Opfer aufgefordert werden, auf ihren Anspruch auf Strafe und Wiedergutmachung zu verzichten? Werden in dieser Solidarität mit den Tätern nicht die Opfer vergessen? Und welche Verbindungen bestehen zwischen Deutschlands liberaler Strafvollzugspolitik und den Anfängen der Bundesrepublik? Gibt es Kontinuitäten von der EKD-Denkschrift – die 1949 forderte: „we wish to call attention in the name of the righteous and merciful God to the fact that the highest expression of justice is not necessarily sentence and punishment. As servants of God we ask that in suitable cases mercy be shown“ (Denkschrift 1949, 22) – zur heutigen „liberalen“ Sensibilität gegenüber Straftätern?16 Warum soll die Härte des Gesetzes im Lichte des Evangeliums revidiert werden?
Dahinter steht eine antijüdische Konzeption des Evangeliums als Offenbarung des liebenden und vergebenden Gottes, die das Alte Testament des richtenden und strafenden Gottes ablöst. Dies trifft allerdings den biblischen Befund in keiner Weise. Wie das Bibeltheologische Wörterbuch feststellt, ist
der Gerichtsgedanke … im NT konstitutiv. Das Verbum krinein begegnet 114mal, das Nomen krisis 47mal. Die seit Marcion beliebte Entgegensetzung: ein Gott des Zorns und Gerichts im AT und Judentum, ein Gott der Gnade und Liebe im NT, verfehlt den Textbefund völlig. Das Gegenteil ist eher der Fall. Der Ernst und die Härte des Gerichts bis hin zu ewiger Verdammnis und dem ewigen Feuer (Mt 25,41) zieht sich durch alle Schichten des NT. (Bauer 1994, 225)
Der barmherzige Gott, den Jesus von Nazareth verkündete, vergibt nicht alles und jedem. In der Nachfolge darf auch die christliche Gemeinde den Tätern des Bösen nicht bloß mit Nächstenliebe und Solidarität begegnen. Für bestimmte Täter gilt in den Worten des Matthäusevangeliums:
Gehet hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränkt. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank oder gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht … Was ihr nicht getan habt einem unter diesen geringsten, das habt ihr mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. (Mt 25,41–46)
Christliche Theologen hätten auch auf Texte wie diesen zurückgreifen können, um der fast unerträglichen Arroganz und Selbstgefälligkeit einiger NS-TäterInnen zu begegnen. Natürlich sind biblische Strafandrohungen des Jüngsten Gerichts für Fragen menschlicher Jurisprudenz und Ethik ebenso wenig brauchbar wie die oben zitierten Vergebungspassagen. Aber Texte wie diese sollten davor warnen, das Richten als „unchristlich“ aus dem moralischen und theologischen Vokabular zu entfernen. Der allzu schnelle Verzicht auf Strafe und der christliche Ruf nach Vergebung hat zur Folge, dass die legitimen Ansprüche der Opfer ignoriert und vorschnell Schuldeinsicht oder Reue auf Seiten der Täter vorausgesetzt werden. An Reue war aber in den meisten Fällen nicht zu denken. Ganz gleich wie nah, leidenschaftlich und aktiv die Täter an der Ermordung von Kranken im Euthanasieprogramm, der „Vernichtung durch Arbeit“ in den Konzentrationslagern und der Tötung jüdischer Menschen in den Einsatzgruppen beteiligt waren, sie fühlten sich allesamt als ehrenhafte Befehlsempfanger, tadellose Beamte, anständige Staatsdiener, die völlig zu Unrecht verurteilt worden waren.
Viele der zum Tode Verurteilten NS-Verbrecher hielten sich für „gerecht“ und sahen keinen Grund zur Reue. Ihre letzten Worte unter dem Galgen, die von amerikanischen Beamten festgehalten wurden, beteuern noch einmal ihre Rechtschaffenheit und Unschuld (z.B. zit. in Klee 1991).17 Der General der Waffen-SS und Chef des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der SS, Oswald Pohl, ist sich zum Beispiel seiner Unschuld sicher: „Ich war 54 Jahre alt, hatte 33 Jahre meinem Vaterland makellos gedient und war mir keines Verbrechens bewußt.“ (Koch 1988, 154) „Es empört mich“, schreibt Adolf Eichmann, „daß versucht wird, mich für die Massenvernichtung haftbar zu machen.“ (Aschenauer 1980, 489) Eichmann möchte nur die politische Lösung der Auswanderung vorangetrieben haben, alles andere sei wiederum von Pohl gekommen, „dem die Konzentrationslager unterstanden, dessen Offiziere die Auswahl zwischen jenen vornahmen, die vernichtet, und denen, die zur Arbeit eingesetzt wurden“ (489). Noch 1957 meint Eichmann, eine Kommission zur Untersuchung seiner Dienstzeit als Referent IV B 4 „müßte mich freisprechen, selbst wenn [sie] … zusammentreten sollte, um mich zu verurteilen.“ (501) Pohl wiederum muss in seiner religiösen Konversionsgeschichte, die kurz vor seiner Hinrichtung als Credo. Mein Weg zu Gott (1950) mit kirchlicher Druckerlaubnis erscheint, sehr tief in sich gehen, um „den Anteil meiner persönlichen ‚Schuld‘ zu finden. Ich hatte zwar niemanden totgeschlagen, noch andere dazu aufgefordert oder ermuntert, ich war zwar Unmenschlichkeiten, sofern ich von ihnen Kenntnis erhielt, nachweisbar energisch entgegengetreten – aber sprach mich das von ‚Schuld‘ frei?“ (Pohl 1950, 43) Der ursprünglich protestantische, dann „gottgläubige“ Nationalsozialist lässt sein Leben vor seiner ersten katholischen „heiligen Kommunion“ Revue passieren, kann aber „Schuld“ (ein Wort, das er nur in Anführungsstrichen benutzt) nur in der „moralischen und sittlichen Versumpfung“ seiner früheren Mitstreiter sehen, die ihn vor dem Nürnberger Tribunal verraten haben (45). Reue für den massenhaften Mord an unschuldigen Menschen taucht in Credo. Mein Weg zu Gott nicht auf. Dies war offensichtlich auch keine Vorbedingung für seine (Wieder-)Aufhahme in eine christliche Kirche oder für die Teilnahme an der Eucharistie.
Es kann davon ausgegangen werden, dass NS-Täter nach 1945 alles taten, um ihre Schuld zu verleugnen, zu verdrängen und abzuwälzen. Sie stellten sich selber als Opfer von Führer und NS-Ideologie, der Umstände, der Siegermächte oder der Justiz dar. Sie verschwiegen ihre Beteiligung und hüllten die Jahre 1933–1945 in großes Schweigen. Das Fehlen persönlichen Schuldbewusstseins bei so vielen Beteiligten, von den obersten Planern durch das mittlere Management bis hin zu den ausführenden Mördern, frustriert traditionelle Mechanismen der Schuldbewältigung: Weder kirchliche Rituale von Schuldbekenntnis, Reue und Vergebung noch juristische Modelle des Strafvollzugs, der Sühne und Wiedereingliederung greifen bei gesellschaftlich integrierten, sich schuldlos fühlenden Tätern. Hannah Arendt brachte diese Erkenntnis in einer kleinen Schrift über die Organisierte Schuld 1945 auf den Punkt:
Wie an dem „Verwaltungsmassenmord“ der politische Verstand des Menschen still steht, so wird an der totalen Mobilisierung für ihn das menschliche Bedürfnis nach Gerechtigkeit zuschanden. Wo alle schuldig sind, kann im Grunde niemand mehr urteilen. Denn dieser Schuld gerade ist auch der bloße Schein, die bloße Heuchelei der Verantwortung genommen. Solange die Strafe das Recht des Verbrechers ist – und auf diesem Satz beruht seit mehr als zweitausend Jahren das Gerechtigkeits- und Rechtsempfinden der abendländischen Menschheit – gehört zur Schuld ein Bewußtsein, schuldig zu sein, gehört zum Strafen eine Überzeugung von der Verantwortungsfanigkeit des Menschen. (Arendt 1945, 339–340)
Die wichtigste Aufgabe im Umgang mit NS-Tätern wäre also gewesen, sie zu einem Bewusstsein ihrer Schuld zu befähigen. Dies war aber nicht das Anliegen der EKD-Denkschrift von 1949. Im Gegenteil, sie kam dem fehlenden Schuldbewusstsein der TäterInnen ideologisch entgegen, indem sie ihr Verhalten entschuldigte und sie vor gerichtlicher Feststellung ihrer Verantwortung schützte. Der Verweis auf die „Gerechtigkeit … im Glauben“ (Rom 3,22) begünstigt dabei die Tendenzen der Täter, die Verbrechen und das resultierende Leiden der Opfer nicht ernst zu nehmen.
Gerade bei staatlich sanktioniertem Systemunrecht darf auf individuelle Schuldfeststellung, Verurteilung und Strafe nicht verzichtet werden, da nur so das Unrecht als solches markiert wird. Gesellschaftlich legitimierte Gewalt, auch wenn sie von ausnahmsloser Brutalität ist, erscheint den Akteuren gerechtfertigt und erzeugt kaum Schuldbewusstsein. Die politisch, verwaltungstechnisch und militärisch verantwortlichen Männer moderner Staatsverbrechen sind ja oft „ehrenwerte Männer“, die den Stereotypen gesetzloser Verbrecher nicht entsprechen. Wie Howard Ball in seiner Analyse der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen und Völkermorden im 20. Jahrhundert bemerkt, gab es „in allen diesen Völkermorden die Erscheinung der ‚reuelosen Teilnahme‘ von der überwältigenden Mehrheit normaler Männer und Frauen“ (Ball 1999, 222). Um dieser „reuelosen Teilnahme“ entgegenzuwirken, muss auf der Feststellung individueller Zuständigkeiten in Massenverbrechen bestanden werden. Eine richtende und richterliche Bestrafung individueller Beteiligter an staatlich durchgeführten Verbrechen wie Völkermord ist unverzichtbar. Sie ist ein zwingendes Gebot der Gerechtigkeit und hat nichts mit Rache oder Vergeltung zu tun. Strafe ist ein symbolischer Akt der Sühneleistung, in dem die Opfer in ihrer Menschenwürde rehabilitiert und die TäterInnen mit den Konsequenzen ihrer Taten konfrontiert werden. Erst dies ermöglicht Schuldbefreiung und Umkehr. Wo dies nicht stattfindet, breitet sich „guilt by association“ (Ball 1999) aus und kontaminiert die ganze Gesellschaft. Für die Täter wie für ihre (nationalen, ethnischen, religiösen) Gemeinschaften führt das in eine lähmende „Solidarität der Schuld“, die Buße, metanoia, Umkehr, tschuvah verhindert.
Das hat auch die evangelische Kirche eingesehen, als sie in den frühen sechziger Jahren ihre Position ohne Bezug auf die Geheime Denkschrift von 1949 revidierte. So heißt es im Wort des Rates der EKD zu den NS-Verbrecher-prozessen vom 13. März 1963: „In den Grenzen, in denen menschliche Rechtsprechung möglich ist, muß in jeder Gemeinschaft um ihrer selbst willen das Unrecht als verwerflich gekennzeichnet und bestraft werden. An einen Akt der Begnadigung kann der Staat erst denken, wenn zuvor dem Recht Genüge getan ist.“ (zit. in Henkys 1965, 339) Dieses kirchliche Wort wurde in die Zeit der politischen Verjährungsdebatten und der skandalös niedrigen Strafurteile vor bundesdeutschen Gerichten hinein gesprochen. So verjährten 1960 alle Totschlagsdelikte, die während des Dritten Reiches verübt worden waren, und die endgültige Verjährung aller Mordvergehen drohte am 8. Mai 1965. Diese Verjährung wurde zunächst auf den 8. Mai 1969 verschoben. Die kirchliche Stellungnahme spiegelt also die Wandlung der gesellschaftlichen Stimmung in den sechziger Jahren wider, in denen die Forderung nach einer angemessenen Bestrafung von NS-TäterInnen lauter wurde. Bei dieser Kehrtwendung der evangelischen Kirche muss aber mitbedacht werden, dass nach der Verjährung aller Delikte – außer vorsätzlichem Mord und mit Ausnahme der Personen, die schon von alliierten Behörden verfolgt worden waren (auch wenn sie mangels Beweisen freigesprochen worden waren) – nur noch die kleineren Schergen des Naziregimes übrig geblieben waren. Die „Schreibtischtäter“, jene bürgerlichen und adeligen Generäle, Minister, Juristen, Industrielle und Mediziner, die in Nürnberg am Pranger gestanden hatten, waren freigekommen.