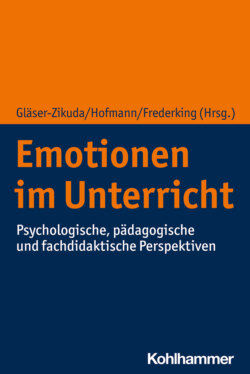Читать книгу Emotionen im Unterricht - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.6 Gliederung des Bandes bezogen auf den pädagogischen und psychologischen Teil
ОглавлениеMit dem vorliegenden Band wollen wir gleichermaßen pädagogische, psychologische sowie fachdidaktische Perspektiven, die bislang kaum thematisiert wurden, auf die Bedeutung des Emotionalen im schulischen Unterricht hin akzentuieren. Die Beiträge nehmen sowohl schulstrukturelle als auch lehr-lernbezogene und akteursbezogene Perspektiven ein. Dabei sind die pädagogischen, psychologischen bzw. erziehungswissenschaftlich-empirischen Perspektiven im vorliegenden Sammelband folgendermaßen strukturiert:
Tina Hascher und Gerda Hagenauer ( Kap. 2) geben aus Sicht der empirischen Lehr-Lernforschung einen grundlegenden Überblick zur Bedeutung von Emotionen in Schule und Unterricht. Sie beschreiben zentrale Erkenntnisse aus der empirischen Lehr-Lernforschung, die als wichtiges Grundlagen-, Handlungs- bzw. Orientierungswissen zu Emotionen im Kontext guten Unterrichts zu verstehen sind.
Wie die ersten Schuljahre das emotionale Erleben in Bezug auf Lernen, Unterricht und Schule generell beeinflussen, thematisiert Katrin Lohrmann ( Kap. 4). Sie gibt einen Überblick zu empirischen Befunden und diskutiert, wie die Grundschule insbesondere mit ihren spezifischen institutionellen Rahmenbedingungen zum Erhalt und zur Förderung positiver Emotionen beitragen kann.
Die Bedeutung von Lern- und Leistungsemotionen im Kontext schulischer Transition heben Simon Meyer, Ramona Obermeier und Michaela Gläser-Zikuda hervor ( Kap. 5). Empirische Befunde zu Bedingungen emotionalen Erlebens, deren Bedeutung für schulisches Lernen sowie Implikationen für die Gestaltung des Übergangs von Primar- in Sekundarstufe werden vorgestellt und diskutiert.
Mit Emotionen im inklusiven Unterricht beschäftigen sich Carmen Zurbriggen und Philipp Schmidt ( Kap. 6). Sie zeigen, dass Binnendifferenzierung, Individualisierung und kooperatives Lernen – als zentrale Merkmale eines inklusiven Unterrichts – sich positiv auf das emotionale Erleben von Schüler*innen auswirken und somit Bildungsprozesse wesentlich unterstützen.
Der Beitrag von Thomas Knaus und Nastasja Bohnet ( Kap. 7) beleuchtet das Verhältnis von Emotion und (digitalen) Medien aus einer allgemein pädagogischen sowie einer spezifisch medienpädagogischen Perspektive. Im Fokus stehen Medien im Unterricht sowie konkrete Unterrichtsbeispiele zu lebensweltbezogenen Lehrmedien, Handlungsorientierung sowie interaktionistisch-konstruktivistische Unterrichtsmethoden.
Gerda Hagenauer und Tina Hascher machen in ihrem Beitrag ( Kap. 16) auf das Erleben von vielfältigen Emotionen bei Lehrkräften aufmerksam und verdeutlichen, wie sie das Unterrichtsverhalten (z. B. die Schülerzentrierung) beeinflussen und welche Bedeutung der Emotionsregulation auf Seiten der Lehrperson für Emotionen von Schüler*innen, aber auch mit Blick auf das berufliche Wohlbefinden von Lehrkräften zukommt.
Marc Kleinknecht beschäftigt sich mit der Rolle von Emotionen beim Einsatz von Unterrichtsvideos in der Lehrer*innenbildung ( Kap. 17). Der Beitrag hebt die Bedeutung von Emotionen als Mediator für Lernprozesse von Lehrkräften in Fortbildungen hervor. Zudem wird die Qualität von Feedback und dessen Einfluss auf Emotionen dargestellt, um Konsequenzen für die Lehrerfortbildung zu skizzieren.
Der Beitrag von Stefan Markus, Katharina Fuchs, Florian Hofmann, Barbara Jacob, Melanie Stephan und Michaela Gläser-Zikuda ( Kap. 18) zeigt basierend auf einer empirischen Studie mit Lehramtsstudierenden die Bedeutung von autonomieunterstützenden Lehr-Lernumgebungen für das Erleben von Lern- und Leistungsemotionen auf.