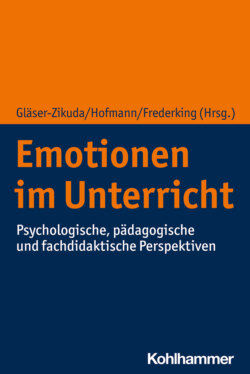Читать книгу Emotionen im Unterricht - Группа авторов - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.3 Wie werden Emotionen in Modellen der Lehr-Lernforschung aufgegriffen?
ОглавлениеAls ein Vorreiter- und wegweisendes Modell zu Emotionen in der Lehr-Lernforschung kann das Modell von Bloom (1974/1976) bezeichnet werden. Bloom ging es darum, sowohl die Eingangsbedingungen als auch die Effekte des schulischen Lernens zu systematisieren. Dabei berücksichtigte er Emotionen zweifach: als affektive Eingangscharakteristika der Lernenden (z. B. Angst vor Mathematik) und affektive Lernergebnisse (z. B. Erleichterung bei einem weitgehend korrekt gelösten Aufgabenblatt). Die Entstehung dieser Emotionen begründet er einerseits in Vorerfahrungen zum Lernen, andererseits mit der Vielzahl spezifischer Lernerlebnisse, in denen Schüler*innen Erfolge und Misserfolge erfahren.
Blooms explizite Berücksichtigung der Rolle der Emotionen für das Lernen setzte sich in der Lehr-Lernforschung bisher allerdings nicht durch, was sich am derzeit sehr populären Angebot-Nutzungs-Modell von Helmke (2012) illustrieren lässt: Emotionen werden in diesem Modell lediglich indirekt unter den Kategorien Voraussetzungen auf der Lehrpersonen- bzw. der Schüler*innenseite thematisiert, wohingegen z. B. Intelligenz und Lernmotivation unter »Lernpotenzial« subsummiert werden. In leicht modifizierten Modellen ( Abb. 2.2) wird immerhin direkt auf »emotionale Voraussetzungen des Lernens« sowie »Lernfreude« als Lernergebnis verwiesen (Hascher & Kittinger, 2014; Lipowsky, 2006). Der Fokus liegt dabei aber klar auf den Emotionen der Lernenden und weniger auf den Emotionen der Lehrenden.
Abb. 2.2: Vereinfachtes Angebot-Nutzungsmodell (Lipowsky, 2006, S. 48)