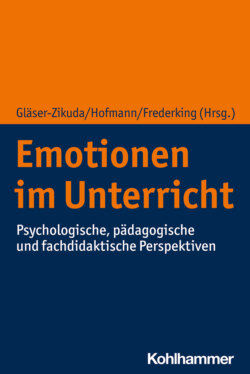Читать книгу Emotionen im Unterricht - Группа авторов - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.2 Fachlich evozierte Emotionen. Vergleichende Beobachtungen zum aktuellen Forschungsstand auf Basis der Fachbeiträge
ОглавлениеFachlich evozierte Emotionen auf der Subjektseite des Fachunterrichts sind in vielen Fachdidaktiken seit der Jahrtausendwende in den Fokus theoretischer wie empirischer Forschung gerückt. Dabei haben auch personal-selbstreflexive Emotionen Berücksichtigung gefunden. Die Beiträge des vorliegenden Bandes vermitteln ein differenziertes Bild des aktuellen Forschungsstandes in acht Fachdidaktiken. Auf dieser Basis sind vergleichende objekttheoretische Beobachtungen (vgl. dazu Rothgangel, 2020) aus allgemeiner fachdidaktischer Perspektive möglich.
Für die Biologiedidaktik gibt Christian Randler einen detaillierteren Überblick über Forschungen zu den fachlich evozierten Emotionen Angst, Ekel, Interesse, Wohlbefinden und Langeweile ( Kap. 8). Ein funktionaler Fokus herrscht hier vor. Dieser zeigt sich in der biologiedidaktischen Interessenforschung wie auch in Untersuchungen zu fachspezifischen Formen von Interesse, Wohlbefinden und Langeweile. Forschungen zu negativen Emotionen wie Ekel und Angst im Zusammenhang mit biologischen Methoden wie dem Sezieren verweisen auf weitergehenden Forschungsbedarf. Gerade Untersuchungen zur verstärkten Einbeziehung lebender Tiere, die in ihrem Verhalten beobachtet werden, könnten, wie der Artikel zeigt, Ansatzpunkte liefern, um das fachspezifische emotionale Selbstkonzept von Lernenden im Biologieunterricht auch personal zu verbessern.
Vor dem Hintergrund emotionaler Manipulationen von Schüler*innen in Zeiten des deutschnational geprägten Deutschunterrichts des späten 19. Jahrhunderts, im Wilhelminismus und zur Zeit des Dritten Reiches stand in der Deutschdidaktik vor allem nach 1968 zunächst der Aufbau kritisch-rationaler Analysefähigkeiten im Zentrum, ehe Mitte der 1980er Jahre emotionale Aspekte stärker in den Fokus deutschdidaktischer Forschung rückten, wie Christian Albrecht und Volker Frederking in ihrem Beitrag zeigen ( Kap. 9). Sprachdidaktisch sind emotionale Faktoren wie Schreiblust im Grundschulbereich und evozierte Gefühle beim Hörverstehen empirisch mit funktionalen und personalen Akzenten untersucht worden. Lesedidaktisch wurden Leselust und Lesefreude in Verbindung mit Genuss-, Kompetenz- bzw. Leistungsaspekten in den Blick genommen. In der Literaturdidaktik rückten emotionale Involviertheit und ihr Einfluss auf kognitive Verstehensprozesse in den Fokus empirischer Erforschung. Aber auch literarisch evozierte Emotionen und das emotionale Aktivierungspotenzial ästhetischer Kommunikation im Sinne personal ausgerichteter literarischer Bildung haben Berücksichtigung gefunden. Dabei zeigt der Beitrag, dass literarisch evozierte Emotionen auf der Subjektseite oft in spezifischer Weise mit der Objektseite der literarisch verarbeiteten Emotionen verbunden sind und sowohl für funktionale als auch für personale fachliche Bildungsprozesse Bedeutung haben können.
In der Fremdsprachendidaktik ( Kap. 10) rücken Clarissa Blum und Thorsten Piske eine andere Facette fachbezogener Emotionsforschung auf der Subjektseite ins Blickfeld. Mit der auch in der Biologiedidaktik fokussierten Angst wird hier als Schwerpunkt eine spezifische Emotion gewählt, die für den Fremdsprachenunterricht aus funktionaler, kompetenzorientierter Perspektive von Bedeutung ist. Fremdsprachenangst wird als komplexe Einheit definiert, die aus fachbezogenen Gefühlen, Annahmen, Verhaltensweisen und Selbsteinschätzungen besteht. Anders als in der Biologiedidaktik sind es aber nicht fachspezifische Untersuchungsmethoden, die Angst auslösen, sondern die Anwendung fremdsprachlichen Wissens in der Gesprächspraxis. Dabei setzt sich die Fremdsprachenangst aus Beunruhigung bzw. Anspannung, Kommunikationsangst, Prüfungsangst und der Angst vor negativer Beurteilung zusammen. Ihre selbstreflexive Verarbeitung eröffnet Ansatzpunkte für bessere Leistungen, aber auch für ein neues fremdsprachliches Selbstkonzept der Lernenden in personaler Perspektive.
Jan Schubert und Romy Hofmann arbeiten in ihrem Beitrag heraus, dass in der Geographiedidaktik evozierte Emotionen in Lehr- und Lernprozessen bislang vor allem mit Blick auf Lernvoraussetzungen, motivationale Aspekte und subjektive Bewertungen theoretisch und empirisch in den Fokus gerückt sind ( Kap. 11). Hinzu kommen Forschungen zu emotionalisierenden Settings und positiven affektiven Wirkungen von Exkursionen. Sinnlich-ästhetische Zugänge zu Emotionen auf der Subjektseite sind bislang hingegen fast ausschließlich theoretisch-konzeptionell reflektiert worden. Empirische Forschungen zum Themenfeld fehlen noch. Im Urteil von Schubert & Hofmann könnten interdisziplinäre Kooperationen z. B. mit der Deutschdidaktik hier helfen, die skizzierten Desiderate zu beseitigen und personale wie funktionale Aspekte von fachlich evozierten Emotionen empirisch in den Blick zu bekommen.
In der Geschichtsdidaktik ist die Subjektseite fachbezogener Emotionen bislang vor allem auf theoretischer Ebene erforscht worden, wie Juliane Brauer und Martin Lücke in ihrem Beitrag verdeutlichen ( Kap. 12). Dabei stehen Fragen der Kompetenzorientierung im Mittelpunkt. Ähnlich wie im Fach Deutsch hat die emotionale Manipulation der Lernenden im Geschichtsunterricht im Wilhelminischen Kaiserreich und im Nationalsozialismus dazu geführt, dass der Aufbau kritisch-rationaler Analysefähigkeit lange Zeit im Fokus geschichtsdidaktischer Konzeptionen gestanden hat. Erst Mitte der 1990er Jahre fanden Emotionen im Lernprozess stärker Berücksichtigung. In der Geschichtsdidaktik lässt sich mithin wie in der Deutschdidaktik ein ›emotional turn‹ konstatieren, der die Modellierungen historischen Lernens zunehmend beeinflusst. Dabei werden Emotionen auf der Subjekt- und auf der Objektseite deutlich unterschieden. Formen emotionaler Aktivierung der Schüler*innen sind z. B. über Berichte von Zeitzeug*innen der Shoah in Video-Interviews möglich. Hier treten Emotionen historischer Aktanten auf der Objektseite ins Blickfeld, die emotionales Erleben auf der Subjektseite der Schüler*innen auslösen. Dieses soll reflexiv verarbeitet werden. Dabei stehen sachbezogen-funktionale Ziele im Zentrum, die allerdings mit selbstreflexiv-personalen Aspekten verbunden werden könnten.
Die empirische Forschung zu evozierten Emotionen im Fach Mathematik bewegt sich im Hinblick auf Differenzierungsgrad und generierte Wissensbestände auf hohem Niveau ( Kap. 13). Leistungsaspekte stehen dabei im Zentrum, wie Claudia Sutter und Tina Hascher in ihrem Beitrag aufzeigen. Weil Mathematik im Ruf steht, besonders schwierig zu sein, besitzt das Fach ein hohes Potenzial für negative Emotionen. Wie in Biologie und in den Fremdsprachen ist Angst deshalb eine oft in Bezug auf den Mathematikunterricht genannte negative Emotion. Allerdings sind auch hier die Auslöser fachspezifisch, insofern Angst vor allem im Zusammenhang mit Prüfungssituationen auftaucht. Aber auch Ärger und Langeweile wurden empirisch oft beobachtet – zu Lasten fachlich evozierter Freude. Allerdings wird mit Blick auf den Forschungsstand zugleich betont, dass die gezielte Förderung positiver Emotionen im Mathematikunterricht auf der Basis entsprechender Lehr-Lern-Arrangements möglich ist.
Wie die Geschichtsdidaktik hat auch die Religionspädagogik fachspezifisch evozierte Emotionen auf der Subjektseite bislang vor allem als theoretisches Phänomen untersucht. Dabei finden personale und funktionale Aspekte emotionaler Bildung Berücksichtigung, wie Manfred Pirner herausarbeitet ( Kap. 14). Drei Leitfragen einer Theologie bzw. Religionsdidaktik der Gefühle werden von ihm zentral gewichtet. Diese richten sich auf die Besonderheit religiöser Gefühle, auf das Verhältnis von Gefühl und Vernunft und ethische Rahmungen religiöser Gefühle. Religionspädagogische Konsequenzen werden im Anschluss an Ansätze zu einer erfahrungsorientierten und performativen Religionsdidaktik und einer Ethik des Mitgefühls als Ziel religiös-ethischer Bildung erläutert. Damit zeichnen sich Ansatzpunkte für eine ethisch-normative Reflexion des Umgangs mit Emotionen ab, die für andere Fachdidaktiken und eine fachdidaktische Emotionstheorie fruchtbare Anregungen bieten können, weil der personal-selbstreflexive Horizont ethischer fachlicher Bildung mit Blick auf Emotionen hier deutlich konturiert wird.
Günter Amesberger und Mareike Susanne Ahns zeigen auf, dass sich in der Sportpädagogik wie in der Biologie- und Mathematikdidaktik früh ein empirischer Zugang zu fachlich evozierten Emotionen herausgebildet hat ( Kap. 15). Dabei werden Emotionen auf der Subjektseite der Lernenden und Lehrenden sowohl unter Leistungs- als auch unter Persönlichkeitsaspekten untersucht. Empirische Befunde liegen vor allem zu Einflussfaktoren emotionalen Erlebens wie Freude oder Angst vor. Aber auch Emotionen wie Glück, Spaß, Leidenschaft, Zufriedenheit, Erleichterung, Stolz, Vertrauen, Überlegenheit, Spannung, Trauer, Schwäche, Hilflosigkeit, Körperangst, Enttäuschung, Unzufriedenheit, Scham, Demütigung, Wut, Aggression, Zorn, Feindseligkeit oder Langeweile sind mittlerweile als fachspezifische Phänomene des Lernens identifiziert und teilweise mit Blick auf ihren Einfluss auf sportliche Leistungen und das fachliche Selbstkonzept empirisch erforscht worden. Desiderate werden vor allem im Hinblick auf empirisch geprüfte didaktische Ansätze zum emotionalen Erleben und zum lern- und leistungsfördernden Umgang mit fachspezifischen Emotionen gesehen.