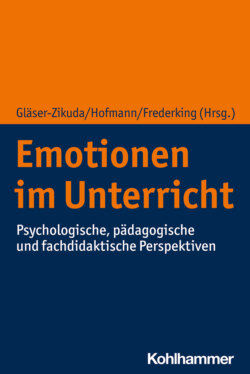Читать книгу Emotionen im Unterricht - Группа авторов - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1.1 Emotionen aus fachdidaktischer Sicht
ОглавлениеUm die Bedeutung von Emotionen aus fachdidaktischer Sicht zu diskutieren, ist zunächst zu klären, was Emotionen sind. Der psychologische Emotionsdiskurs liegt dafür als Ausgangs- und Bezugspunkt nahe, zumal er pädagogisch wie fachdidaktisch intensiv rezipiert wurde.
Erste wichtige Impulse hat die psychologische Forschung durch Wilhelm Wundts Klassifikation von Affekten erhalten. Wundt differenzierte zwischen Gefühlen als kurzzeitigen und Affekten als einer Abfolge von zusammenhängenden Gefühlen, die ein länger fortbestehendes Ganzes bilden, »das im allgemeinen zugleich intensivere Wirkungen auf das Subjekt ausübt als ein einzelnes Gefühl« (Wundt, 1896, S. 120). In Anknüpfung an die Aristotelische Ethik unterschied Wundt »Lust- und Unlustaffekte« und ordnete diese nach Stärke und Dauer, Körperreaktionen usw. Eine fachdidaktische Emotionsforschung könnte hier frühe Anknüpfungspunkte für eine Analyse von Lust- und Unlustgefühlen im Zusammenhang mit schulischem Unterricht bzw. fachlichem Lehren und Lernen finden – in Übereinstimmung zu philosophischen Ansätzen in der Tradition des Aristoteles, an die Wundt explizit anschloss.
Allerdings orientieren sich Erziehungswissenschaft und Fachdidaktiken wie die moderne Psychologie im Unterschied zu Wundt heute zumeist nicht mehr am Affekt-, sondern am Emotionsbegriff. Der Emotionsbegriff, der sich in der amerikanischen Psychologie bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts etablierte, hatte entscheidende Impulse durch Charles Darwins Studie ›The expression of the emotions in man and animals‹ (1872) erhalten. Emotionen wie Liebe, Freude, Vergnügen, Ärger oder Hass, die Darwin bei Menschen wie bei vielen Tierarten beobachtete, wurden hier erstmals systematisch in ihrer evolutionären Verwurzelung und physiologischen Basis aufgearbeitet. Dieser Sachverhalt ist aus fachdidaktischer Sicht interessant, weil hier erkennbar wird: Die moderne Emotionsforschung hat ihren Ausgang nicht in der Psychologie, sondern in der Biologie genommen. Mehr noch – die psychologische Forschung hat durch die biologische ihren entscheidenden Anstoß erhalten. William James hat Darwins evolutionstheoretische Sicht in seinem grundlegenden Artikel ›What is an emotion?‹ (James, 1884, S. 188–204) aufgegriffen und psychologisch appliziert. In seinem Fokus stand die physiologische Basis von Emotionen: »emotions […] have a distinct bodily expression« (ebd., S. 188), so James’ Kernthese, die über »perception« und Verankerung im »cortex« bis zur physischen Manifestation verläuft: »An object falls on a sense-organ and is apperceived by the appropriate cortical centre«, komplexe physiologische Prozesse überführen dann »an object-simply-apprehended into an object-emotionally-felt« (ebd., S. 203). Mit dieser These antizipierte James das moderne Verständnis von Emotionen, das sich in der Psychologie nach einer zwischen 1920 und 1980 durch den Behaviorismus bedingten Randstellung des Themas mittlerweile fest etabliert hat. Dies gilt auch für den deutschsprachigen Raum. Die Fülle an aktuellen psychologischen Forschungsarbeiten verdeutlicht dies eindrucksvoll ( Kap. 2).
Wie aber lässt sich das psychologische Emotionsverständnis fachdidaktisch anwenden und theoretisch verorten? Exemplarisch soll dies an den empirischen Forschungen von Ulrich Mees (1991; 2006) veranschaulicht werden. Nach Mees sind Emotionen aktuelle Gefühlszustände, die im Unterschied zu Stimmungen auf etwas als »Objekt« gerichtet sind bzw. von diesem Objekt ausgelöst werden. Dieser Objektbezug von Emotionen eröffnet Ansatzpunkte für eine genuin fachdidaktische Emotionstheorie. In dieser avanciert das Fachliche bzw. Fachliches zu dem Objekt, auf das die Emotionen gerichtet sind. Ein heuristisches Raster solcher fachbezogenen Emotionen könnte in Anwendung einer von Mees entwickelten Typologie (vgl. 1991, S. 86–168; 2006, S. 4–7) folgende Elemente aufweisen:
• ›Ereignisbezogene‹ Emotionen in Bezug auf fachliche Inhalte, fachliche Fragen und fachliche Methoden (Freude, Glück, Entzücken, Leid, Trauer, Hoffnung, Befriedigung, Erleichterung, Furcht bzw. Angst, Enttäuschung);
• ›Handlungsbezogene‹ Emotionen in Bezug auf fachliches Lehren und Lernen, fachlichen Wissens- und Kompetenzerwerb und fachbezogene Interaktionsprozesse (Stolz, Billigung, Scham, Zorn, Selbstzufriedenheit, Dankbarkeit, Unzufriedenheit, Ärger);
• ›Beziehungsbezogene‹ Emotionen in Bezug auf fachlich Lehrende und (Mit)Lernende, Fachkolleg*innen bzw. Mitschüler*innen (Bewunderung, Verachtung; Liebe, Hass, Mitfreude, Mitleid, Schadenfreude, Neid; Eifersucht, Schuld, Genugtuung).
Darüber hinaus lassen sich »selbstbezügliche« Emotionen mit Blick auf das eigene fachliche Selbstkonzept (z. B. Selbstwertschätzung, Selbstmitleid) und Lust-Unlust-Emotionen (z. B. Langeweile, Interesse, Faszination) unterscheiden.
Hierbei handelt es sich allerdings nur um eine heuristische Modellskizze, die der empirischen Überprüfung bedarf. Überdies wird das nachfolgende Kapitel zeigen, dass das Modell aus fachdidaktischer Perspektive unvollständig ist und erweitert werden muss.