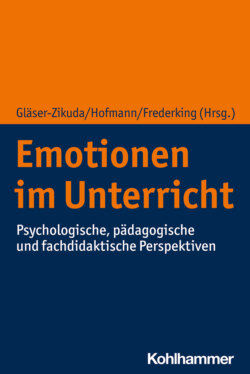Читать книгу Emotionen im Unterricht - Группа авторов - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3.2 Fachlich kodierte bzw. intendierte Emotionen im fachdidaktischen Blick
ОглавлениеFachdidaktische Forschungen zu Emotionen, die fachlich kodiert bzw. teilweise intendiert sind, nehmen die Frage in den Blick, in welchen Kontexten Emotionen als Teil des fachspezifischen Gegenstandes bzw. Forschungsfeldes in Erscheinung treten. Wie dies geschieht bzw. geschehen kann und welche fachlichen Bildungsziele damit verknüpft sind, soll am Beispiel der im vorliegenden Band enthaltenen Forschungsübersichten veranschaulicht werden, in denen fachlich kodierte bzw. intendierte Emotionen behandelt wurden. Zunächst rücken mit Geographie, Geschichte und Religion jene Fachdidaktiken in den Fokus, in denen dies mit theoretischem Schwerpunkt geschehen ist. Mit Sportpädagogik und Deutschdidaktik folgen anschließend jene beiden Fachdidaktiken, in denen auch empirische Zugänge verstärkt genutzt werden, wie die Fachdarstellungen zeigen.
Für die Objektseite von Emotionen ist aus geographiedidaktischer Perspektive die mit Alexander von Humboldt verbundene Vorstellung zentral, »dass Geographie nicht nur objektiv feststellende Naturwissenschaft ist, sondern auch sinnlich-ästhetischer Zugänge bedarf, um den Raum als Ganzes zu erkennen«, wie Jan Schubert und Romy Hofmann in ihrem Beitrag aufzeigen ( Kap. 11). Es ist mithin die Wahrnehmung des Raumes als ästhetisches Phänomen, mit der Emotionen zu einem zentralen Element geographischer Bildung in einem reflexiv-personalen Sinne werden und erklären, warum geographiedidaktische Forschung eine besondere Offenheit für personale Aspekte fachlicher Bildung besitzt. Die für den Geographieunterricht zentrale Unterscheidung von vier Raumbegriffen – Raum 1. als »Wirkungsgefüge natürlicher und anthropogener Faktoren«, 2. »als System von Lagebeziehungen«, 3. »in der Wahrnehmung unterschiedlicher Akteure und 4. als gesellschaftliche Konstrukte« (ebd.) – macht nämlich deutlich: Während die ersten beiden Aspekte eher dem Aufbau von geographischem Weltwissen in einem funktionalen Sinne dienen, stellen die beiden letztgenannten Aspekte einen Konnex zwischen Raum und subjektiver Wahrnehmung her. Dies schließt Emotionen ein. Durch den Wahrnehmungsaspekt besitzt geographische Emotionsforschung deshalb auch auf der Objektseite einen personal-(selbst-)reflexiven und Emotionen als Phänomen adressierenden Fokus.
In der Geschichtsdidaktik wird explizit zwischen einer Subjekt- und einer Objektseite fachlich in Erscheinung tretender Emotionen unterschieden. Zum Forschungsgegenstand auf der Objektebene werden Emotionen vor allem im Zusammenhang mit dem »Fühlen historischer Akteur*innen als Antriebskräfte der Geschichte«, wie Juliane Brauer und Martin Lücke in ihrem Beitrag herausarbeiten ( Kap. 12). Die Kontexte, in denen Emotionen auf der Objektebene historisch beobachtbar werden, sind vielfältig und bieten unterschiedliche Anknüpfungspunkte für den Geschichtsunterricht. Zu fragen ist beispielsweise, »welche Emotionen auf welche Weise Menschen in der Vergangenheit motivierten, antrieben, ansteckten, welche emotionalen Regeln das soziale Miteinander strukturierten, welche emotionalen Stile in bestimmten Zeiten und Gesellschaften bestimmend wurden oder wie sich Gemeinschaften über das Teilen bestimmter Emotionen ausbildeten.« (ebd.) Dabei werden Kompetenzaufbau und Persönlichkeitsbildung im Feld des Historischen so miteinander verbunden, dass historische Bildung die (selbst)reflexive Durchdringung evozierter Emotionen bei den Lernenden fördert, sie auf diese Weise zu Facetten der Objektseite macht und so in den Dienst historischen Erkennens und Denkens stellt.
Der Beitrag von Manfred Pirner macht deutlich, dass es in der Religionspädagogik ebenfalls eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit Emotionen als Teil des fachlichen Gegenstandes in personaler und funktionaler, (selbst-)reflexiver und kompetenzorientierter Perspektive gibt ( Kap. 14). Die Leitfragen einer »Theologie der Gefühle« umreißen das Spektrum fachlicher Emotionen auf der Objektseite. Zu fragen ist in diesem Horizont, ob es so etwas wie spezifisch religiöse Gefühle gibt, inwiefern Gefühle von elementarer Bedeutung für Religion sind und ob es einer Ethik des religiösen Gefühls bedarf. Zumindest die ersten beiden Fragen sind positiv zu beantworten, wie der Überblicksartikel zeigt. Auch für manche Ansätze in der Religionspädagogik bzw. -didaktik ist das religiöse Gefühl Teil religiöser Praxis und damit fester Bestandteil der Religion als unterrichtlichem Gegenstand und Forschungsfeld, wie mit Blick auf die performative Religionsdidaktik und das Konzept aktiv-engagierten Mitgefühls im Sinne von Compassion verdeutlicht wird. Auch mit Bezug auf die Objektseite religiös kodierter Emotionen ergeben sich mithin spezifische personal-selbstreflexive Zugänge.
In der Sportpädagogik gibt es theoretische wie empirische Forschungszugänge zum Verhältnis von Fachlichkeit und Emotionalität ( Kap. 15). Günter Amesberger und Mareike Susanne Ahns zeigen auf, dass und wie sportliches Handeln auf die »Überwindung künstlicher, meist selbstgewählter Hindernisse« ausgerichtet ist und neben »Motivation und Anstrengungsbereitschaft« (ebd.) auch den Umgang mit Emotionen voraussetzt. Diese werden auf komplexe Weise Gegenstand des Sportunterrichts und sportpädagogischer Forschung: als subjektives Erleben, als (neuro)physiologische Aktivierung, als kognitive Verarbeitung und Steuerung sowie als motorischer Ausdruck. Beim Erlernen von Sportarten und motorischen Fertigkeiten werden Emotionen als Teil des fachlichen Gegenstandes wichtig, wenn sie zur Handlungs- und Leistungsoptimierung genutzt werden. Schüler*innen sollten herausfinden, »welche Emotionen dysfunktional und welche funktional für die Leistungserbringung sind« (ebd.). Aber auch identitätstheoretische Implikationen emotionalen Erlebens und damit personale Aspekte des sportlichen Selbstkonzepts sind beim sportlichen Handeln bedeutsam, wie der Artikel verdeutlicht.
In der Deutschdidaktik gibt es in einzelnen Teildisziplinen wie der Literaturdidaktik ebenfalls theoretische und empirische Forschungen zu Emotionen als Teil der fachlichen Gegenstände mit funktional-sachbezogenem und personal-selbstreflexivem Fokus, wie die Ausführungen von Christian Albrecht und Volker Frederking verdeutlichen ( Kap. 9). Deutschdidaktische Emotionsforschung mit dem Fokus auf die Objektseite konnte und kann dabei auf literaturwissenschaftliche Aufarbeitungen zur literarischen Kodierung von Emotionen und linguistische Forschungen zum Konnex von Sprache und Emotion rekurrieren. Auf dieser Basis war die theoretische Modellierung und systematische empirische Erfassung von literarisch präsentierten, thematisierten und textseitig intendierten Emotionen im Rahmen eines Kompetenzmodells zum literarischen Textverstehen möglich, wie der Beitrag verdeutlicht. Damit liegen empirische Befunde zu textseitig bedingten Kompetenzanforderungen vor, Emotionen auf der Objektebene literarischen Lernens in einem funktional-kognitiven Sinne zu erfassen. Gleichzeitig sind auch emotionale Valenzen literarischer Texte und ihre didaktischen Implikationen empirisch untersucht worden, d. h. die Frage, in welchem Ausmaß positive wie negative Emotionen durch unterschiedliche Texte ausgelöst werden und inwieweit dabei die vom Text intendierten Emotionen und die bei Leser*innen evozierten Emotionen miteinander korrelieren und einen Beitrag zum Aufbau evozierter Emotionen und ihrer personal-reflexiven Verarbeitungen im Sinne einer Haltung leisten. Auch der Zusammenhang von evozierten Emotionen und politisch-demokratischer Wertebildung ist auf dieser Basis empirisch untersucht worden ( Kap. 20).