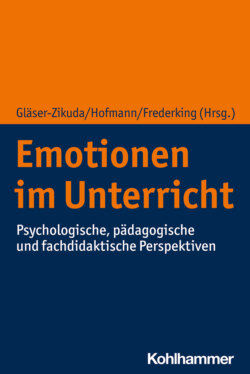Читать книгу Emotionen im Unterricht - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Emotionen bzw. Gefühl – Merkmale, Entstehung und grundlegende Funktionen
ОглавлениеEmotionen erfüllen nicht nur im Bildungskontext, sondern in allen Bereichen des menschlichen Lebens grundlegende biologische und soziale Funktionen, wie bspw. die Antizipation zukünftiger Ereignisse, das Bereitstellen von Handlungsempfehlungen oder die Zuschreibung von Absichten und Zuständen in sozialen Interaktionen. Dabei werden Emotionen durch den biologisch gesteuerten Impuls bestimmt, Lust, Befriedigung und Wohlbefinden zu suchen sowie Schmerz, Gefahr und Ungleichgewicht zu meiden (Damasio, 2010). In interkulturellen Studien wurden schon früh mehrere Basisemotionen ermittelt: Überraschung, Ärger, Abscheu/Ekel, Furcht/Angst, Trauer und Freude/Glück (Ekman & Davidson, 1994). Auch aktuelle Emotionstheorien gehen davon aus, dass es basale, somatische Reaktionen, sogenannte core affects (Barrett, 2015) bzw. primäre Emotionen gibt. Als primäre (und damit angeborene) Emotionen wurden Furcht, Wut, Glück/Freude, Trauer, Ekel, Überraschung und Interesse identifiziert (z. T. auch Verachtung; vgl. für einen Überblick Tracy & Randles, 2011). Erziehung und Sozialisation sowie kulturelle Einflüsse (Ulich & Mayring, 1992) bedingen die Entwicklung von Emotionen und ihre individuelle Ausprägung. Diese sogenannten sozialen oder sekundären Emotionen treten allerdings erst auf, sobald systematische Verknüpfungen zwischen Kategorien von Objekten oder Situationen und den primären Emotionen gebildet wurden (Huber, 2013). Hierzu zählen bspw. Mitgefühl, Verlegenheit, Scham, Stolz, Eifersucht, Liebe, Neid, Dankbarkeit oder Bewunderung.
Eine weitere strukturelle Eigenschaft von Emotionen ist darin zu sehen, dass sie zum einen als momentane Zustände (Zustands- bzw. state-Komponente) und zum anderen als dispositionelle Reaktionstendenzen (Bereitschafts- bzw. trait-Komponente verstanden werden können (Otto, Euler & Mandl, 2000). Folglich rufen nicht die Ereignisse selbst, sondern die subjektive Interpretation von Ereignissen bei Menschen Emotionen hervor (z. B. Scherer, Schorr & Johnstone, 2001). Damit tritt die Bedeutung von Verarbeitungs- und Reflexionsprozessen ins Blickfeld. Zum Teil sind Emotionen evolutionsbiologisch überlebensnotwendig; man denke nur an die Fluchtreaktion in gefährlichen Situationen. Überwiegend reagieren Menschen aber sehr unterschiedlich in ähnlichen Situationen. Übertragen auf Lehr-Lern-Kontexte heißt das z. B., dass in einer Lerngruppe einmal Freude über den Wissenszuwachs, ein anderes Mal Langeweile oder Ärger entstehen kann. Als eine Erklärung hierfür kann der sogenannte Appraisal-Ansatz (Scherer, Schorr & Johnstone, 2001) herangezogen werden ( Kap. 1.2). Pekrun (2000) hat in der Folge den in der Bildungsforschung häufig herangezogenen ›Kontroll-Wert-Ansatz für Lern- und Leistungsemotionen‹ entwickelt. Kontrollappraisals (im Sinne einer Einschätzung, wieviel Kontrolle man darüber hat, ob Erfolg in einer Situation herbeigeführt werden kann) und Valenzappraisals (im Sinne einer Einschätzung der positiven bzw. negativen Bedeutsamkeit oder des Werts von Erfolg bzw. Misserfolg in der jeweiligen Situation) sind für die Entstehung von Leistungsemotionen relevant. Sowohl Kontroll- als auch Valenzappraisals bestimmen die Qualität und Intensität der erlebten Emotionen (Frenzel, Götz & Pekrun, 2009; Kap. 3.3).
Besonders Emotionen in der Schüler-Lehrer-Interaktion bzw. mit Blick auf die soziale Beziehung werden systematisch untersucht (z. B. Wild, Hofer & Pekrun, 2006). Vermehrt werden auch Emotionen von Lehrkräften fokussiert (Becker, Götz, Morger & Ranellucci, 2014). So kann sich eine Lehrkraft bspw. über störende Verhaltensweisen von Schüler*innen im Unterricht ärgern. Auch auf Seiten der Lehrkräfte spielen Kontroll- und Valenzappraisals eine Rolle (Frenzel, Götz & Pekrun, 2008). Darüber hinaus kommt der Emotionsregulierung von Lehrkräften eine wesentliche Bedeutung zu (Krause, Philipp, Bader & Schüpbach, 2008). Neben der Beeinflussung der Emotionen einer Gesprächspartnerin bzw. eines Gesprächspartners (in der überwiegender Zahl der Fälle einer Schülerin bzw. eines Schülers) durch das eigene Verhalten und gezeigte Emotionen zählen auch die Kontrolle und der Umgang mit den eigenen Gefühlen zum professionellen Handeln einer Lehrkraft (Krause et al., 2008; Kap. 3.1).