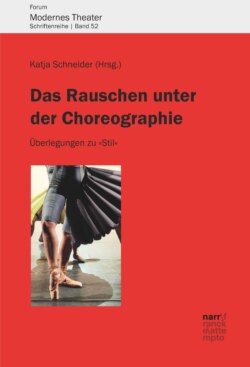Читать книгу Das Rauschen unter der Choreographie - Группа авторов - Страница 14
Generischer und persönlicher Stil nach Duchamp
ОглавлениеDas Ready-made Fountain, das Duchamp 1917 zur Ausstellung der Society of Independent Artists in New York einreichte, weist keinen klaren generischen Stil mehr auf, denn es handelt es sich um ein Serienprodukt industrieller Fertigung. Seine Gestaltungsprinzipien und Herstellungstechniken wurden außerhalb des Feldes der Kunst bestimmt und vorrangig wohl nach außerkünstlerischen Kriterien wie Haltbarkeit, Nützlichkeit, Marktakzeptanz etc. ausgerichtet. Der Künstler ist also nicht an der Herstellung des Objektes beteiligt, wohl aber an der Auswahl und seiner Ausstellung im Feld der Kunst. Denn, wie sich später herausstellt, veranlasst Duchamp, dass dieses Serienprodukt für eine Ausstellung eingereicht wird und erklärt es damit entsprechend seiner künstlerischen Strategie zur Kunst. An die Stelle eines generischen Stils tritt ein persönlicher Stil.
Mit dieser Geste aber bringt Duchamp die Jury der »Gesellschaft der Unabhängigen Künstler«, die über die Hängung der Exponate entscheidet, in eine unmögliche Situation. Hatte die Gesellschaft noch im Geiste der Sezession sich dazu verpflichtet, alle Einsendungen in alphabetischer Reihe auszustellen, so muss sie nun darüber entscheiden, ob dieses Alltagsobjekt kunstwürdig ist, wiewohl es offensichtlich nicht vom Künstler hergestellt, wohl aber dezidiert signiert ist: Am oberen Rand ist mit schwarzer Farbe der Name »R. Mutt« aufgebracht. Das war nicht zu übersehen. R. Mutt allerdings war als Künstler nicht in Erscheinung getreten.
Geht man davon aus, dass die Signatur eines Kunstwerkes lesbar sein sollte, so verlieh dieser Akt der Signatur dem Objekt eine wundersame räumliche Drehung um 90 Grad und führte natürlich eine gesittete Benutzung als Pissoir ad absurdum. Die Frage war nun: Reichen diese Eingriffe aus, das Objekt zum Kunstwerk zu machen und es damit auch den tradierten Kunstwerken und Kunststilen zur Seite zu stellen?
Bekanntlich wurde das Objekt zunächst von der Kommission, der Duchamp zwar selbst angehörte, bei deren Entscheidung er aber nicht zugegen war, abgelehnt und verschwand hinter einem Vorhang. Es wurde niemals ausgestellt, so dass die Geste der Einreichung als künstlerische Äußerung von der Genese des Werkes und einer stark verzögerten Rezeptionsgeschichte zu differenzieren ist. Das Werk, die künstlerische Autorisierung und die Rezeption weisen dabei sehr unterschiedliche Valenzen auf.
Was geschah mit dem Werk? Der in den Coup eingeweihte Mäzen Duchamps, Walter Arensberg, verlangte es nach der Ablehnung zu sehen und erstand es kurzerhand. Diese erste Version gilt freilich als verschollen (was für einen Massenartikel natürlich eine einigermaßen komische Anmerkung darstellt). Es wurde allerdings zuvor von Alfred Stieglitz fotografiert. Seinen Ausstellungscharakter bekam das Objekt zunächst wohl eher über diese Fotografie, positioniert in Bildmitte auf einem Sockel und in einer Perspektive, die der gebräuchlichen diagonalen Draufsicht auf ein Pissoir widerspricht. Hervorgehoben sind vielmehr die geschwungene, dem körperlichen Organ entgegenkommende Form des Beckens im oberen Bildteil sowie die dunklen Zu- und Abflusslöcher in der Bildmitte, denen vorne links die Signatur zur Seite steht. So inszeniert und von Stieglitz als »Fountain by R. Mutt«, also mit ›Brunnen‹, ›Wasserspiel‹, ›Quelle‹ oder ›Ursprung‹ betitelt, scheint das Objekt weniger eine Flüssigkeit aufzunehmen, als dass ihr etwas entspringt. Repliken des Fountain wurden 1951 und 1964 gefertigt, ein Modell dieses Ready-mades war bereits Teil des von Marcel Duchamp gefertigten Koffermuseums Boîte-en-Valise (1941)1.
Wie verhält es sich mit der Autorschaft? Der Künstler Marcel Duchamp gibt sich erst sehr verzögert und indirekt als derjenige zu erkennen, der den Coup lancierte, eigentlich erst in der Zeit der verstärkten musealen und publizistischen Aufmerksamkeit, die seinem Œuvre in der Nachkriegszeit gewidmet wurde. Weder in der Zeitschrift The Blind Man (1917), in der der Fall Richard Mutt besprochen wurde und die von Beatrice Wood, Henri-Pierre Roché und Duchamp, der unter dem Pseudonym »Totor« fimierte, herausgegeben wurde, noch in dem von Guillaume Apollinaire geschriebenen Artikel Le Cas de Richard Mutt (1918) wird Duchamp oder das Fountain namentlich erwähnt. Hervorgehoben wird vielmehr die Geste des Ready-made an sich, betont wird die Wahl und die Idee der Umfunktionierung, also die neue Form einer Autorschaft und eines persönlichen Stils losgelöst vom Kunstprodukt.
Wenn die Autorenstrategie und die Werkgenese quasi ihr Eigenleben führen, verwundert es wenig, dass die Rezeption von Fountain und die sich daran anknüpfenden Verweise erst allmählich ihre Wirkung entfalteten – in diesem Fall über Dekaden hinweg. Thomas Zaunschirms Anfang der 80er Jahre vorgelegte ikonografische Lesart jener Ready-mades, die er parallel zu Duchamps erstem Hauptwerk, Le Grande Verre (Das Große Glas, 1915 – definitiv unvollendet 1923) liest, legt nahe, in Fountain mehr als nur die Geste einer paradoxalen Autorisierung zu sehen. Dazu gäbe es zu viele Verweise auf andere Ready-mades und Werke Duchamps. Bereits 1918 werde ja, so Zaunschirm, von Duchamp mittelbar in der Zeitschrift The Blind Man enthüllt, dass hinter dem »R.«, dem Vornamen des unbekannten Künstlers, der Name »Richard« stecke. Mit Duchamps Interesse an Sprache und ihren Übersetzungen und Homonymen, so Zaunschirm, werde Richard somit lesbar als ›rich art‹ oder als ›richard‹, was französisch ›ein reicher Kauz‹ ist, welche/r ›Mutt‹, englisch für Trottel, lautsprachlich aber auch für französisch ›mat‹ (= matt, müde, ermüdet sein) steht, oder auch für ›matt gesetzt‹, französisch ›échec et mat‹, wenn man Duchamps Karriere als Schachspieler in die Waagschale wirft, auf die er immer wieder in seinem Werk verweist. Oder ist es ein Verweis auf ›mud‹ im Sinne von Dreck, Schlamm, wenn man der Analogie von ›art‹ und ›merde‹ folgt, die Duchamp in seinen Notizen von 1914 anstellt?2
Die kunstphilosophische Rezeption dieses Falls durch Thierry de Duve3 hingegen interessiert sich nicht für die ikonografischen Bedeutungen und Verweise auf Duchamps Werk. In dieser Interpretation steht der Coup stellvertretend für die Tendenz der modernen Kunst, die Theorie des ästhetischen Urteils nach Kant auf die Probe zu stellen. Wenn jeder Mensch und nicht nur professionelle Künstler dazu in der Lage seien, so de Duve, einen Alltagsgegenstand zu signieren und zur Kunst zu erklären, so verweise das auf eine radikale Demokratisierung des Kunsturteils. Nicht Jurys, Experten, Künstler und professionelle Kräfte des Kunstmarktes, sondern eben jeder sei notwendig verpflichtet, im Akt der Rezeption ein Urteil zu fällen, bzw. bestehende Urteile zu übernehmen oder zu verwerfen. Die Stilfrage wird in dieser Linie der Rezeption nun radikal an den Betrachter zurückgespielt, wobei dann über Ästhetik und Stil notwendig gestritten werden muss.
Vielleicht aber muss man auch die Rezeption noch einmal nach Interessengruppen differenzieren. Niemand, nicht einmal Duchamp, empfand es als stillos, dass das Werk verschollen und die Aufregung um den Fall von relativ kurzer Dauer war. In der ihm eigenen Haltung der Indifferenz hatte Duchamp zwar spezifische Fährten für die Rezeption der Ready-mades ausgelegt, deren Rezeption als Kunstwerk und seine Autorschaft daran jedoch sicher nicht forciert, weil er sie als eine Form ansah, »Ideen abzuladen«4 und nicht als neuen Stil propagierte. So muss also angenommen werden, dass die Künstlerszene, in der Duchamp verkehrte und in der er als etwas enigmatischer Kollege hohe Aufmerksamkeit genoss, das Fountain und das Motiv der Alltagsgegenstände in der bildenden Kunst auch von anderen Künstlern her kannte, wie etwa in Francis Picabia Amorous Parade (1917), Morton Schambergs God (1918) oder Man Rays Man (1918). Ein Alltagsgegenstand im Feld der Kunst erregte also bei Insidern möglicherweise keine besondere Beachtung. Von einer breiteren Öffentlichkeit wurde Fountain erst aufgenommen durch eine sich selbst verstärkende Rezeption, in der der Coup einmal mehr kolportiert wurde und sich die diversen Bezüge allmählich herauskristallisierten, die hinter der Signatur steckten. Damit wurde allerdings zugleich deutlich, dass weniger die Herstellungstechnik, sondern mehr die Zuschreibung eines persönlichen Stils auf Duchamp ein Kriterium der Kunstbewertung geworden war.
Für die Frage nach der Funktion des Stilbegriffs hat dieser Coup zwei gravierende Folgen: Seit Duchamps Ready-made verliert das von Wollheim aufgemachte Bestimmungsmerkmal, die Beherrschung einer anerkannten Technik, zunehmend an Bedeutung. Die Serialität in der Pop Art, das Sampling in der Musik, die soziale Plastik bei Beuys oder die Institutionskritik in der Body Art wären weitere Beispiele für diese avantgardistische Strategie.
Seit Duchamps Ready-made ist zugleich eine Tendenz zu Individualisierung und damit auch eine Ausweitung des Stilbegriffs auf ästhetische Phänomene aller Lebensbereiche zu beobachten. Selbstverständlich ist von Lebensstil, Erziehungsstil, Programmierstil, Fahrstil etc. die Rede. Stil wird in dieser Denklinie zu einem Synonym für Haltung, sei es eine kritische oder affirmative. Der Philosoph Richard Shustermann spricht in diesem Sinne von einem »personal style«.5
Gilt also eine umfassende Personalisierung und Verinnerlichung des Stilbegriffs, wie es der Sinnspruch »Mode muss man kaufen, Stil muss man haben« nahelegt? Oder gilt umgekehrt, dass Stil eigentlich ein Synonym für Technik geworden ist, dem die Haltung des Künstlers oder der Künstlerin kontrastiv zur Seite gestellt wird? Von dieser Beobachtung ging immerhin das Symposion Das Rauschen unter der Choreografie – Überlegungen zu ›Stil‹ aus. Im Konzept der Veranstaltung wird dabei ein Auseinanderdriften von alltäglichem und künstlerischem Gebrauch des Stilbegriffs konstatiert und letzterem dabei attestiert, – zumindest im Tanz – »keine attraktive Kategorie mehr zu sein«6. Der folgende Beitrag ist diesem Wandel des Stilbegriffs gewidmet, der in einer die Künste vergleichenden Perspektive dargelegt wird. An Beispielen der bildenden Kunst, der Schauspielkunst, des Tanzes und der Architektur wird aufgezeigt, in welcher Weise der generische Stil in eine Krise gerät. Dabei ist davon auszugehen, dass es sich nicht um ein Oberflächenphänomen handelt. Vielmehr kann am Bedeutungsverlust des Stilbegriffs eine neoliberale Öffnung und Individualisierung des vorherrschenden Verständnisses von künstlerischer Tradition aufgezeigt werden, die auch das Verständnis von künstlerischen Techniken insgesamt erfasst. An die Stelle der Berufung auf eine künstlerische Tradition und ein tradiertes Handwerk tritt nun, vereinfacht gesagt, die Spekulation auf eine zukünftige Akzeptanz der eigenen Kunst. Dieser grundlegende Zusammenhang zwischen Individualisierung und Technikverständnis wird mit Blick auf Überlegungen des Soziologen Ulrich Beck eingeführt, um der aktuellen Stildiskussion – nicht nur im Tanz – eine historische und soziologische Dimension zu verleihen. Denn keineswegs geht es in der Bewertung des Stilbegriffs nur um eine auffällige Verkehrung, die darin bestünde, dass einige Künstler den Stilbegriff ablehnen, während eher traditionsbewusste und einem Kanon verpflichtete Künstler dies nicht tun und wiederum in den Populär- und Alltagskulturen fröhlich eine (Selbst-)Stilisierung betrieben wird. Grundlegender als dieses Für und Wider der Stilbestimmung ist die kulturökonomische Machtfrage, die ja bereits Duchamp implizit zum Gegenstand seiner Intervention machte: Welche gesellschaftlichen Zusammenhänge bestimmen, ermöglichen oder verhindern die Entwicklung technischer und stilistischer Merkmale und nach welchen Regeln wird Stil zu- und umgeschrieben oder auch verweigert? Diesem Zusammenhang soll in vergleichender, historischer Perspektive nachgegangen werden.
Dabei wird es insbesondere um die Legitimation von Stilentscheidungen gehen, die am Beispiel einiger Grenzfälle im Feld der Kunst darzulegen sind: dem Tanz von geistig und körperlich Behinderten und der Dombauarchitektur. Daran anknüpfend gilt es mit Blick auf das deutschsprachige Literaturtheater zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu zeigen, dass der Wandel des Stilbegriffs in den Künsten und der Alltagskultur kulturpolitisch motiviert ist. Zunächst aber ist etwas Theorie vorwegzuschicken, um genauer darzulegen, was es mit der These vom Auseinanderdriften des personellen und generischen Stils auf sich hat.