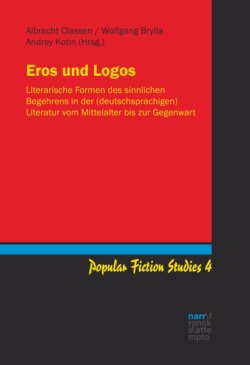Читать книгу Eros und Logos - Группа авторов - Страница 11
1. Mechthild und ihr Werk
ОглавлениеUm 1207 (nach Neumann) in einer ritterlichen Familie in der westlichen Mittelmarkt geboren und höfisch erzogen1, soll Mechtild Offenbarungen empfangen haben, die sie als den unmittelbaren Gruß des Heiligen Geistes gedeutet und über dreißig Jahre später zu verschriftlichen begonnen hatte:
Ich unwirdigú súnderin wart gegruͤsset von dem heligen geiste in minem zwoͤlften jare also vliessende sere, do ich was alleine, das ich das niemer mere mohte erliden, das ich mich zuͦ einer grossen teglichen súnde nie mohte erbieten. Der vil liebe gruͦs was alle tage und machte mir minnenklich leit aller welte suͤssekeit und er wahset noch alle tage. (IV, 2, 228)2
„[U]m 1230 [flüchtete sie] aus dem Elternhaus nach Magdeburg in ein Beginenhaus, um ein Leben in asketischer Heimatlosigkeit, Armut und Kasteiung zu führen“.3 Neumann vermutet hinter dieser einschneidenden Entscheidung einen schweren inneren Konflikt:
Die tiefbegriffene Gegensätzlichkeit von weltlichem Herrenturn und geistlicher Gottesknechtschaft, die Unvereinbarkeit irdischer Ehre und religiöser Demut, die Gefährlichkeit der ästhetischen Lebensverwirklichung in Zeremoniell und Kunstübung für die Seele ist gerade das Zentralerlebnis ihrer Jugend und der Anstoß zu ihrer Flucht ins Beginentum gewesen.4
Auf die Frage, warum sie nach der ersten, bereits um 1219 stattgefundenen und anschließend täglich wiederkehrenden Gotterfahrung so lange damit gewartet hatte, gesteht Mechthild am Anfang des vierten Buches (IV, 2, 231), dass es „schon seit langer Zeit […] [ihr] Wunsch gewesen sei, ohne eigene Schuld erniedrigt zu werden“ („Do hatte ich lange vor gegert, das ich ane mine schulde wurde versmaͤhet“). Nach ihrem ca. vierzig Jahre dauernden Aufenthalt im Beginenhof, dessen Vorsteherin sie später wahrscheinlich wurde, begab sie sich um 1270 aus nicht ganz ersichtlichen Gründen – vielleicht in Folge der Bestimmungen „einer Magdeburger Dominikanersynode von 1261 gegen das Beginentum“5, vielleicht – wie Kurt Ruh vermutet – „auf Anlaß der Familie bzw. ihres Bruders Balduin oder Heinrichs von Halle“6, vielleicht aber – wie Ursula Peters und Otto Langer wollen – wegen der „Unsicherheit und Gefährdung der semireligiösen Existenz“7 – in das Zisterzienserinnenkloster Helfta bei Eisleben, wo sie unter der Äbtissin Getrud von Hackeborn in die Ordensgemeinschaft aufgenommen wurde. Dort starb sie um 1282.
1250 hatte Mechthild mit der Niederschrift des Fließenden Lichts begonnen. Zwar wurde sie dazu direkt durch ihren Beichtvater, den Dominikaner Heinrich von Halle, bewogen, doch glaubte sie damit primär der Aufforderung Gottes („du hies mich es selber schriben“ [II, 26, 136]; „Hette es got vor siben jaren nit mit sunderlicher gabe an minem herzen undervangen, ich swige noch und hette es nie getan“. [III, 1, 156]) Genüge zu leisten. Die durch Neumann ermittelte Chronologie sieht drei Entstehungsstufen des Werkes: Bücher I-V (zw. 1250–1259), VI (zw. 1260–1270/71), VII (zw. 1271–1282).8 Das niederdeutsche Original des Fließenden Lichts ist verschollen; auf uns gekommen ist nur eine lateinische, wahrscheinlich kurz nach Mechthilds Tod entstandene Übersetzung der ersten sechs Bücher und eine etwas spätere, auf ca. 1343/45 datierte oberdeutsche Übertragung des ganzen Textes. Der Mangel an tieferer Bildung, den die Mystikerin selbst als ein Handicap ansah und der die lateinunkundige Frau dazu zwang, sich bei der Niederschrift ihres Werkes mit einem deutschen Dialekt zu behelfen, erwies sich im Nachhinein als Glücksfall. Auch in dieser Hinsicht markiert Mechthilds Buch einen tiefen Einschnitt, da es „ein herausragendes Beispiel für den in der Geschichte der abendländischen Mystik epochalen Schritt vom Latein zur Volkssprache“9 darstelle.