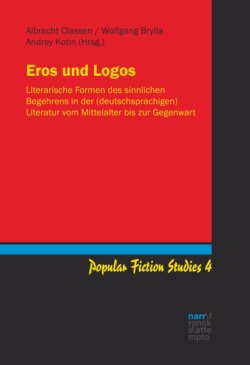Читать книгу Eros und Logos - Группа авторов - Страница 17
II
ОглавлениеIn den letzten Jahren hat man sozusagen Dietrichs von der Gletze Der Borte neu entdeckt, ein mære, in dem der Erzähler ungemein spannende und bis heute wichtige Fragen zum Verhältnis von Mann und Frau aufwirft und sogar die Aufmerksamkeit auf das Thema ‚Homosexualität‘ lenkt, ohne dass diese tatsächlich als identifizierbares Phänomen auftreten würde. Der Erzähler entwirft vielmehr eine Situation vor unseren Augen, in der die Ehefrau, die sich als Mann verkleidet hat, um ihren Mann wieder zurückzugewinnen, ihm vorwirft, sich schändlicherweise bereit erklärt zu haben, einen homosexuellen Akt zu begehen, um materiellen Gewinn daraus zu schlagen.1
Die Handlung basiert auf dem Problem des männlichen Protagonisten Kuonrât, dass er wohl wegen seiner jungen Jahre noch nicht genügend gesellschaftliches Ansehen erworben hat, weswegen er sich von seiner Frau verabschiedet, um in der Nähe an einem Turnier teilzunehmen. Während seiner Abwesenheit begibt sie sich in einen wohl topisch aufzufassenden Garten, als sich ein fremder Ritter nähert und um die Gunst der Dame wirbt, die sich aber standhaft weigert, sie liebt ja ihren Mann und hat kein Interesse selbst an magischen Tieren (Windhunde, Jagdfalke, Pferd), mit denen jeder Besitzer leicht größte Ehre am Hof erwerben könnte. Erst als er schließlich seinen Gürtel anbietet, der demjenigen, der ihn trägt, überall den höchsten Preis eintragen würde – „Der wirdet nimmer êren blôz“ (V. 309)2 – kann sie nicht mehr standhalten, weil sie genau diesen Gürtel für ihren Ehemann gewinnen möchte.
Sie gibt sich also dem Ritter hin, worauf sie all seine wertvollen Tiere und den Gürtel erhält, womit sie später die höchsten Triumphe feiern kann. Wieso sie auf die ersten Angebote nicht eingeht, die ja den gleichen Effekt gehabt hätten, und erst dann nachgibt, als der Ritter den Gürtel anbietet, bleibt unerfindlich, es sei denn, wir akzeptierten die hohe symbolische, nämlich erotische Bedeutung eines Gürtels. Der Erzähler spielt offenkundig mit den unterschiedlichen Aussageebenen dieser Objekte/Tiere und kitzelt sozusagen die erotische Phantasie des Publikums, ohne eindeutige Erklärungen zu bieten.
Das mære problematisiert aber sogleich diese Situation, denn die Dame sendet gerade nicht eine der Neuerwerbungen zu ihrem Mann, womit ihm sofort geholfen wäre. Sie wird vielmehr von einem Diener heimlich beobachtet, der darauf Kuonrât verrät, seine Frau habe Ehebruch begonnen, was formal gesehen stimmt. Dies bringt den letzteren dermaßen in Rage, dass er sich entfernt, sich zum Hof von Brabant begibt und dort verharrt, ohne jeglichen Versuch zu unternehmen, mit seiner Frau zu kommunizieren oder zu verhandeln. Diese wartet zwei Jahre geduldig, aber vergeblich, auf ihn und folgt ihm schließlich, verkleidet sich aber als Mann und taucht dann in Brabant als Heinrich von Schwaben auf, der überall den Sieg davonträgt, besitzt er/sie ja diese Wundertiere – vom Gürtel ist zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr die Rede. Genau dies trifft aber Kuonrât empfindlich, verlangt es ihn ja offensichtlich mehr als jemals zuvor danach, endlich die ersehnte Anerkennung als Ritter zu gewinnen, die ihm offensichtlich bis zu diesem Moment vorenthalten worden ist.
Als die beiden neuen ‚Freund‘ in einer Kriegssituation gemeinsam einen Posten beziehen und somit ungestört sind, bittet Kuonrât den Fremden darum, ihm eines der Wundertiere zu schenken, die dieser noch nicht einmal dem Herzog hatte verkaufen wollen. Nach einigem Hin und Her scheint es aber zu einer Einigung zu kommen, denn Heinrich gesteht, dass es ihn in der Liebe nach Männern gelüste, und wenn sich ihm Kuonrât gefügig zeige, wolle er ihm den Jagdfalken überlassen. Genau dies zu tun, d.h. sich dem anderen als männlichen Prostituierten hinzugeben, erklärt er sich bereit, womit die kritische Wende in der Erzählung erreicht ist. Denn nun bricht es aus Heinrich heraus, als sich der andere bereits auf den Rücken gelegt hat: „ir sit worden mir ein spot: / Welt ir nû ein kezzer sîn / durch hunde und den habech mîn“ (V. 776–78). Wie eine Schimpfkanonade lädt es sich auf ihn ab, er habe sich schändlich und schmählich verhalten, er sei noch schlimmer als ein Ketzer, denn er habe allein materielle Ziele verfolgt und sei völlig unchristlich in seinem Denken, während sie keineswegs einen richtigen Ehebruch begangen habe, weil sie sich dem anderen Ritter nur deswegen überantwortet habe, um ihrem eigenen Mann in seinem Streben nach Ehre zu helfen: „Daz ich tet, daz was menschlîch“ (V. 795).
Bei genauerer Hinsicht stellt sich natürlich heraus, dass Kuonrât keineswegs als ein wahrer Homosexueller zu bezeichnen wäre, denn er bedauerte sogar die sexuelle Orientierung Heinrichs – „ez muoz mîn klage immer sîn“ (V. 746) – und war allein deswegen zu dieser Transgression bereit, weil er eines der Zaubertiere für sich gewinnen wollte.3 Sein Ehrenkonzept erweist sich mithin als stark materiell orientiert und ermangelt von vornherein der ideellen Grundlage, während seine Frau sich als eine energische, selbstbewusste, zugleich opferbereite und dann dennoch zielstrebige Person entpuppt, die sogar zu dieser radikalen Tat zu schreiten bereit war, als Cross-Dresser aufzutreten, um ihrem flüchtigen Mann eine Lektion zu erteilen und ihn so eines Besseren zu belehren. Genau dies trifft dann auch zu, er gibt klein bei, unterwirft sich ihr, gesteht seine Schuld ein und erkennt sie als ihm überlegen vor allem in ethischer Hinsicht an, womit eine neue Machtstruktur entsteht, die relevant für das Eheverhältnis in der Zukunft gewesen sein dürfte.
Aber seine Frau ist nicht nachtragend, wirft ihm nur vor, der Hauptverantwortliche in dieser ganzen Krise gewesen zu sein, übergibt ihm darauf all diese Wundertiere und den speziellen Gürtel, denn diese hatte sie ja nur seinetwegen erworben. Insbesondere betont sie dann, dass sie selbst für ihn eine gute Ehefrau sein wolle: „ich wil ouch, herre, lernen / Allen dînen willen“ (V. 808–809). Die Verserzählung klingt so aus, indem der Dichter betont, dass sie von da an „zuht und êre“ (V. 819) gemeinsam pflegten und sich inniglich liebten (V. 820).
Dieser Ausgang klingt zu gut, um wahr zu sein, aber es geht ja im literarischen Diskurs nicht um den Wahrheits- und Realitätsgehalt, sondern um Problemanalyse und -lösung, indem extreme Verhältnisse und Situationen entworfen werden, die die Bedingungen auf dem Boden der Tatsachen in etwa spiegeln und Empfehlungen vermitteln, wie das zwischenmenschliche Leben besser gestaltet werden könnte. An zentraler Stelle macht sich bemerkbar, wie schwach und unsicher Kuonrât ist, der weder auf dem Turnier in der Nähe von zu Hause noch in Brabant wirklich zum Mann heranreift und offensichtlich nirgends die Anerkennung gewinnt, die ihm so vonnöten ist. Aber er ist mit einer ihn liebenden, einer selbstbewussten und sehr intelligenten jungen Frau verheiratet, die selbst unter schwierigsten Bedingungen Wege und Möglichkeiten findet, um Alternativen bereitzustellen und Lösungen für die krisengeschüttelte Ehe zu entwickeln. Allerdings ist die Eheinstitution als solche gar nicht gefährdet, während in der Praxis die Ehe der zwei Protagonisten sich als unreif und instabil erweist.
Wir können zwar nichts über die Identität des fremden, geradezu mysteriösen Ritters oder über die Herkunft der Zaubertiere bzw. des zentral als Motiv dienenden Gürtels sagen, aber all diese Elemente fungieren dafür, um das altbekannte, schwer anzugehende Problem in den Griff zu bekommen, wie sich ein Ehepaar vernünftig zusammenzuraufen versteht. Wie Dietrichs Verserzählung deutlich zum Ausdruck bringt, entstehen viele Konflikte dadurch, dass eine der zwei Personen innere Schwäche demonstriert, eine Identitätskrise durchläuft, sich vom anderen zu sehr herausgefordert sieht und sich in seinem/ihrem Ehrgefühl gekränkt oder erniedrigt fühlt. Dietrich thematisiert zwar oberflächlich die Frage, wie eine Ehe konstruktiv gestaltet werden kann, lenkt aber letztlich seine Aufmerksamkeit auf die persönlichen Schwierigkeiten des Individuums, weswegen die Beziehung über die Geschlechtergrenzen hinweg gefährdet erscheint.
Zugleich betont aber der Autor, wie wesentlich das erfüllte Liebesverhältnis für die glückliche Ehe sei, denn nachdem das Ehepaar den schweren Streit überwunden hat, finden sie harmonisch wieder zueinander und erfreuen sich aneinander bis zu ihrem Tode. Das mære erweist sich mithin als eine Meistererzählung, weil es fundamentale Probleme zwischen Mann und Frau aufgreift und sie auf überraschende und doch produktive Art und Weise zu lösen vorschlägt. Wie überaus deutlich wird, versagt Kuonrât vor allem deswegen, weil er seiner eigenen Frau aus Eifersucht weniger traut als einem Diener, weil er Angst vor der Auseinandersetzung mit ihr hat und lieber vor ihr flieht, als sie mit der Anklage auf Ehebruch zu konfrontierten. Ob sich all dies letztlich als Rechtfertigung konstruieren ließe, dass sie in ihrer Entscheidung gerechtfertigt gewesen wäre, aus dem Grund mit dem fremden Ritter zu schlafen, um dessen Gürtel für ihren eigenen Ehemann zu erwerben, bleibt etwas in der Schwebe. Aber ob es sich bei diesem Ritter wirklich um eine wahre Person handelt, lässt sich auch nicht sicher bestätigen, denn sie spottet ja nach dem Geschlechtsverkehr, der seltsamerweise auch mit einem Kuss zwischen beiden endet, obwohl sie ihn vorher so ablehnend behandelt hatte, über ihn als Ritter, der all seine Attribute verloren und mithin gar nicht mehr als männlich angesehen werden könnte: „Irn’ sît niht wol gemuot“ (V. 365).
Wie dem auch sein mag, sie hat durch ihr kalkulierendes Handeln die wichtigsten Instrumente gewonnen, um ihrem Ehemann dazu zu verhelfen, die höchsten gesellschaftlichen Ehren zu gewinnen. Im Grunde setzt Kuonrât natürlich die gleiche Strategie ein, erweist sich aber als viel eher dazu bereit, seinen Körper zu prostituieren, um eines der Tiere zu gewinnen. Seine Frau verfolgt zwar eher ideelle Ziele, aber die Erzählung belässt es doch ziemlich unbeantwortet, wer von beiden mehr verantwortlich für den schwerwiegenden Konflikt zwischen beiden anzusehen wäre.
Von hier aus ergeben sich viele weitere Fragen, die den ganzen Text durchziehen, denn bei genauerer Betrachtung beobachten wir noch eine Reihe von Widersprüchen, die sich der leichten Erklärung entziehen. Entscheidend bleibt aber, worauf Dietrich an zentraler Stelle hinzielt, nämlich die Reflexion über ein gutes Eheleben, das niemals ganz einfach zu gewinnen ist. Wie unsere Verserzählung deutlich vor Augen führt, leidet die innere Harmonie leicht darunter, wenn einer der zwei Eheleute innere Schwäche demonstriert und unsicher ist, vergeblich nach Anerkennung strebt und nicht genau weiß, wie er oder sie seine/ihre Rolle im Leben zu finden vermag.
Im Grunde spielt sich hier vor unseren Augen ein dramatischer Kampf zwischen Mann und Frau ab, ohne dass ein wahrer Streitpunkt vorläge. Sie schläft mit dem fremden Ritter, um Kuonrât zu helfen; er vernimmt diese schlimme Nachricht, versteht aber nicht den Hintergrund und verurteilt sie daher von vornherein als Ehebrecherin. Seine Handlung darauf ist aber wiederum als schwächlich zu bezeichnen, denn er trennt sich nicht offiziell von ihr, er bestraft sie nicht, er spricht nicht mit ihr oder über sie und geht dafür sozusagen ins selbstgewählte Exil, wo sich jedoch für ihn gar nichts Besonderes ergibt, ja wo er sogar bei einem Turnier, an dem inzwischen auch seine als Ritter verkleidete Frau teilnimmt, kläglich gegen einen Briten scheitert, der ihn nur so von seinem Pferd fegt. Erst Heinrich zeigt, was einen ‚Mann‘ wirklich ausmacht, aber er/sie verfügt ja über Zaubermittel, was das gesamte Prozedere des Turniers und des Rittertums in ein etwas schräges Licht wirft, ohne dass dadurch die wichtigste Thematik vergessen werden würde, wie nämlich ein junges Ehepaar wirklich zueinander finden und eine harmonische, glückserfüllte Partnerschaft über viele Jahre hinweg entwickeln kann.