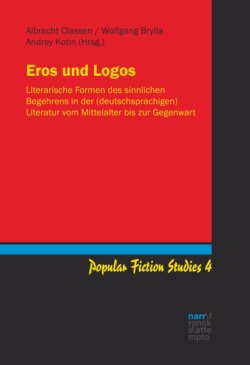Читать книгу Eros und Logos - Группа авторов - Страница 8
III
ОглавлениеSpringen wir von hier zu Goethes Römischen Elegien, die während seines Aufenthalts in der Ewigen Stadt und auf der Reise durch Italien 1786–1788 bzw. unmittelbar im Anschluss daran entstanden sind. Bereits die erste Elegie endet mit den vielsagenden Versen: „Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe / Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom“.1 In der zweiten Elegie betont er sogleich, welch attraktive Position er bei der römischen Geliebten einnimmt, im Gegensatz zu den Einheimischen: „Mutter und Tochter erfreun sich ihres nordischen Gastes, / Und der Barbare beherrscht römischen Busen und Leib“. Mit deutlichem Rückgriff auf die römische Antike, d.h. wiederum auf Ovids Metamorphosen2, hebt Goethe in der dritten Elegie das dort gebotene Vorbild für die unerwartete und überwältigende Liebeserfahrung, die sich aus der günstigen Gelegenheit ergibt, wie die vierte Elegie umschreibt, hervor.
Der Höhepunkt ist aber erst in der fünften Elegie erreicht, wo Goethe davon berichtet, wie er zwar tagsüber durch Rom streift und die klassische Antike studiert, nachts aber bei der Geliebten liegt und durch die lustvolle Erfahrung mit ihr wesentlich tiefere Erkenntnisse gewinnt als alle theoretischen Studien es ihm sonst ermöglichen würden. Stärkste Sinnlichkeit durchglüht ihn, die es ihm erst ermöglicht, die ästhetische Dimension der alten Ruinen zu begreifen und poetisch selbst schöpferisch zu werden: „Und belehr ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens / Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab? / Dann versteh ich den Marmor erst recht: ich denk und vergleiche, / Sehe mit fühlendem Aug, fühle mit sehender Hand.“3 Unverhüllt und ganz selbstbewusst entwirft der Dichter ein Glückserleben höchst erotischer Art, wobei die Schönheit des nackten Frauenkörpers unmittelbar mit der Schönheit der antiken Skulpturen in Verbindung gebracht wird und die erotische Empfindung als Anlass für eine ganze Kette an kreativen Leistungen dient. Der Dichter selbst vermag so erst vollständig die Ideen der Antike zu begreifen und auf diesem Wege innovativ neue Verse zu schaffen. Erotik entpuppt sich damit als ein wesentliches Instrumentarium für die Schaffung neuer Lyrik, neuer Kunst und für die Entwicklung eines neuen Weltverständnisses. In Bezug auf moderne erotische Gedichte definiert Veronika Neumann daher das erotische Element folgendermaßen:
das nachhaltig Affizierende, d.h. das durch die Gestaltung des Gedichtes auf die Lesenden spezifisch erotisch Wirkende, zweitens eine Mittlerstellung des Erotischen zwischen den Bereichen Liebe und Sexualität, drittens der zugleich verhüllende und enthüllende sprachliche Schleier und viertens ein eingeschriebenes Streben.4
Wie wir oben bereits gesehen haben, lässt sich genau diese Begriffsbestimmung auch auf die Werke der älteren Literaturgeschichte übertragen, womit interessante Gemeinsamkeiten kulturhistorischer Art zwischen allen Epochen auftreten. Die Sprache, die Bildlichkeit, die äußeren Umstände, die Freiheit, mit der erotische Aspekte ausgedrückt werden, die Freude am Erotischen schlechthin usw. mögen alle immer etwas unterschiedlich gewesen sein, aber die menschliche Natur ist von jeher erotisch geprägt und bedarf des erotischen Gefühls, um sich voll zu entfalten und die ganze Potenz auszuleben. Der poetische Diskurs bot sich schon immer außerordentlich fruchtbringend für dieses Phänomen an, wie die verschiedenen Studien in unserem Band vor Augen führen.
Der Grat, den wir bei der Diskussion von Erotik beschreiten, erweist sich jedoch als schmal und droht, uns leicht bei einem Fehltritt in den Abgrund abstürzen zu lassen, was nicht unbedingt ein Werturteil darstellen soll. Der Fall von E.T.A. Hoffmanns (?) Roman Schwester Monika (1815) illustriert dies eindringlich, denn an sich befinden wir uns hier schon auf dem Gebiet der Pornographie, so wenn an einer Stelle zu lesen ist: „Er zog ihr die zarten kleinen Lenden voneinander und befriedigte seine Lust so vollständig, als es ihm nur möglich war“ (S. 9), oder: „Ehe noch Franziska sich zu besinnen vermochte, stand sie schon mit nackendem Untertheil vor dem weiblichen Areopag, der, entzückt über die Schönheit ihres Hinterns, mit einem dreymaligen Händeklatschen sein Lob aussprach“ (S. 15).5
Friedrich Schlegels Lucinde (1799) hingegen stellte den Versuch dar, das Erotisch-Sexuelle mit dem Göttlichen zu verschmelzen, was freilich erneut viele im zeitgenössischen Publikum brüskierte (vgl. dazu Andrey Kotins Aufsatz). Der Dichter projizierte jedoch zugleich eine selbständig agierende weibliche Protagonistin, die selbst bestimmt, wie sie sexuelle Lust erfahren will.
Wollten wir aber diese Texttradition weiter verfolgen, kämen wir sofort vom Hundertsten zum Tausendsten, denn sexuell-orientierte Literatur gibt es in Hülle und Fülle bis in die unmittelbare Gegenwart, wie es z.B. der neue Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre von Clemens Setz (2015) illustriert, in dem das Sexuelle in der Balance zwischen Normalität und Anormalität austariert und der sexuelle Trieb als Urgrund im menschlichen Dasein dargestellt wird (siehe dazu den Beitrag von Maciej Jędrzejewski; vgl. dazu auch die Studie von Rafał Biskup über den oberschlesischen Autor Szczepan Twardoch). Wahre Erotik zeichnet sich hingegen durch die kunstsinnige Verhüllung, das Spiel mit der Andeutung aus und verliert sich nicht in drastischer, rein körperlicher Reflexion über die menschliche Kopulation, was ins Gebiet der Pornographie gehört, die z.B. von Charlotte Roche in erstaunlicher und frecher Art und Weise in ihrem Roman Feuchtgebiete (2014) gestaltet wird. Gehört dies noch zur ‚gehobenen‘ Literatur, oder handelt es sich bereits um einen trivialen Text komerzieller Ausrichtung?
Durchforsteten wir die verschiedensten Anthologien mit Lyrik oder Prosa, relevante literarische Zeitschriften oder selbständige Publikationen, würden wir auf eine große Zahl von mehr oder weniger erotischen Beispielen stoßen, und dies aus praktisch allen Epochen der Neuzeit. Verena Neumann macht u.a. auf Else Lasker-Schüler, Rosa Ausländer (vgl. dazu Oxana Matiychuk), Gottfried Benn (siehe die Untersuchung von Maciej Walkowiak), Marie Luise Kaschnitz oder Günter Kunert aufmerksam6, und wir könnten nun viele weitere Namen hinzufügen, denn das Thema ‚Erotik‘ erweist sich als unerschöpflich, als universal und zeitlos und hat sich stets schon in Dichtung und anderen literarischen Werken niedergeschlagen. Sowohl im Druck als auch online finden sich immer weitere Gedichte und andere Texte, die stark durch Erotik geprägt sind und diese mysteriöse aber zentrale Erfahrung im menschlichen Leben gestalten, ob wir an Christian Morgenstern (1871–1914), Theodor Storm (1817–1888), Rainer Maria Rilke (1875–1926), Klabund (1890–1928) oder eine ganze Menge zeitgenössischer Dichter denken. Selbst vom jungen Karl Marx (1816–1883) ist eine große Zahl von Liebeslyrik bekannt, obgleich deren Qualität eher zu bezweifeln wäre, zeigt sich ja hier dieser später so berühmte Denker als ein Epigone durch und durch, der die späte Romantik in seinen Dichtungen explizit wieder aufleben lässt.7
In der Literatur des Berlins während der Weimarer Republik dominierten Themen wie Prostitution, Vergewaltigung und Homosexualität, denn Sinnlichkeit und Erotik spielten eine zentrale Rolle (vgl. dazu die Beiträge von Marlene Frenzel und Arletta Szmorhun). Durchaus nachvollziehbar war wegen der schweren Lebensbedingungen Erotik im öffentlichen Diskurs nach dem Zweiten Weltkrieg weniger relevant oder präsent, aber die gründliche Durchsicht einschlägiger Publikationen beweist, dass zumindest seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ein neues Interesse an und Bewusstsein von Erotik zum Vorschein kam, so wenn wir an Marie Luise Kaschnitz (1901–1974), Günter Kunert (geb. 1929), Karl Krolow (1915–1999), Erich Fried (1921–1988) oder Ulla Hahn (geb. 1946) denken.8
Warum aber fühlen sich so viele Dichter und Autoren von dem Thema ‚Erotik‘ zutiefst angesprochen und gestalten dann Texte darüber? Eine fast töricht zu nennende Frage, die genauso wenig zu beantworten sein wird wie die nach der Relevanz von Tod, nach Gott oder nach dem Sinn des Lebens. Die menschliche Kreatur ist eben wesentlich von dem Bedürfnis durchdrungen, solche esoterischen und doch tangiblen Phänomene sprachlich umzusetzen, womit die eigene Phantasie beflügelt wird und sich freier zu bewegen vermag.9
Natürlich steht das Verlangen nach Genuss dahinter, imaginiertem oder realem, und die poetische Aussagekraft dient dazu, den kruden physischen Sexualakt zu überhöhen und ästhetisch zu steigern, wobei zugleich Glücksempfindung hinzukommt, oft auch religiöse Vision, denn die erotische Kraft transformiert den Menschen und lässt ihn zu einem neuen Wesen heranwachsen. Kein Wunder, dass sich der Liebesdiskurs mit dem damit eng verbundenen Prostitutionsdiskurs des 20. Jahrhunderts überschneidet, wie er von Hans Fallada und Hans Werner Richter in ihren Romanen behandelt wird (vgl. dazu den Beitrag von Arletta Szmorhun).
Andererseits gehört das unendliche Sehnen nach sexueller Erfüllung dazu, was Dichter stets noch dazu angetrieben hat, mehr oder weniger deutliche erotische Anspielungen oder sogar derb-deftige Bemerkungen in ihre Werke einzuflechten (vgl. dazu den Beitrag von Wolfgang Brylla über die Barockdichtung). Dass in der neuesten Literatur auch anti-heteronormative Vorstelllungen von sexueller Identität zur Sprache kommen, wie Marta Wimmer in ihrem Beitrag dokumentiert, braucht dabei nicht mehr zu überraschen. Erotik nimmt schlichtweg immer und überall zentrale Bedeutung ein und spiegelt zugleich sozial-historische Veränderungen und sich neu austarierende Verhältnisse zwischen den Geschlechtern (hetero-, homo-, trans- oder intersexuell) wider.
Daher soll hier zu guter Letzt noch das älteste erotische Lied der deutschen Literaturgeschichte angesprochen werden, um zu demonstrieren, um welch zeitloses und universales Thema es sich wirklich handelt und dass es unsinnig ist, aus modernistischer Sicht die Augen vor Dichtungen der Vormoderne zu verschließen. Selbst im vermeintlich so dominierend christlichen Mittelalter genossen die Menschen erotische und sexuelle Beziehungen, und die christliche Kirche war keineswegs in der Lage, hier einen festen Riegel vorzuschieben, pflegte man ja selbst im monastischen Kontext die ovidische Tradition im Sprachunterricht (vgl. dazu die Carmina Burana, ca. 1220/1240).
Unter den namenlosen Liedern in der berühmten Sammlung Des Minnesangs Frühling finden wir auch den bezaubernden Sechszeiler Dû bist mîn, ich bin dîn, der den Schluss eines lateinischen Liebesbriefes wahrscheinlich einer Frau auf Blatt 114v der ehemals Tegernseer Pergamenthandschrift clm 19411 der Bayerischen Staatsbibliothek München bildet.10 Die Frauenstimme beschwört den Geliebten darauf, dass sie beide eine Einheit bildeten, denn der andere sei fest in ihr Herz eingeschlossen, aus dem er niemals mehr herauskommen werde: „verlorn ist daz sluzzelîn:/dû muost ouch immêr darinne sîn“ (V. 5–6). Die poetische Stimme ist bestimmend, drängend, versprechend und zärtlich zugleich. Die Liebesempfindung ist hier im Herzen angesiedelt, und genau dort sollen sich die beiden Personen treffen und dann nie mehr sich daraus entfernen. Die Sängerin projiziert Glücksempfindung, aber sie drückt auch eine gewisse Besorgnis aus, denn der Geliebte befindet sich ja noch nicht im Herzen, soll erst dorthin gelockt werden; oder, anders gesehen, er befindet sich bereits dort – „dû bist beslozzen“ (V. 3) –, und soll jetzt nur darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Vereinigung der zwei Geliebten bereits geschehen sei, ein Zurück gebe es jetzt nicht mehr, denn der Schlüssel, der das Schloss zum Herzen öffnen könnte, sei verloren gegangen.
Trotz des hohen Alters dieser Tegernseer Verse sprechen sie uns bis heute unmittelbar an, schwingen voller Erotik, Hoffnung und Glück, deuten aber zugleich die potentielle Gefährdung dieser Liebesbeziehung an. Nirgends macht sich sexuelle Thematik erkennbar, wenngleich diese sicherlich mitzudenken wäre, während die reine Liebesempfindung, also das Sehnen danach, mit der geliebten Person innig verbunden zu sein und zu bleiben, das ganze Gedicht beherrscht. Damit ist bereits damals die reine Erotik in höchster ästhetischer Form ausgedrückt worden. Der Dichter oder die Dichterin hat insoweit von vornherein der deutschsprachigen Literaturgeschichte einen bemerkenswerten Stempel aufgedrückt und explizit betont, wie zentral Erotik für alle poetischen Anstrengungen sei.
Hans Castorp und Madam Clavdia Chauchat in Thomas Manns Der Zauberberg (1924) bzw. Ulrich und Agatha in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften (1930–1943) hätten dem ohne weiteres zugestimmt, vor allem weil sie, wie Elisa Meyer in ihrem Beitrag bestätigt, durch ihre inzestuöse Beziehung eine neue Stufe der Erotik erzielen, die quasi religiös-sexueller Art zu sein scheint. Das Körperliche wird aber nicht ausgelebt, weil der sprachliche Austausch erst recht zur Intensivierung ihrer Gefühle füreinander beiträgt. Zugleich beobachten wir die Entwicklung von literarischen Reflexionen über transnormative erotische und sexuelle Beziehungen in den Werken neuester Autoren wie Matthias Hirth, Cornelia Jönnson und Jürgen Lodemann (vgl. dazu den Beitrag von Marta Wimmer).
In der polnischen Literatur, die den Ersten Weltkrieg behandelt, treten bemerkenswert viele Konfliktsituationen auf, in denen Eros mit Thanatos ausbalanciert werden muss, denn der Krieg droht stets noch, die traditionellen ethischen, moralischen und religiösen Bande aufzulösen, was angesichts des massenhaften Sterbens dazu führt, dass die Liebessehnsucht und das sexuelle Verlangen ungemein ansteigen (vgl. dazu den Beitrag von Paweł Zimniak). Die sexuelle Erfüllung, ob nun in Gedichten des 12. Jahrhunderts, in solchen der englischen Renaissance (John Donne) oder in Romanen des 20. Jahrhunderts thematisiert, erweist sich mithin als ein Signament menschlicher Existenz schlechthin. Der Chor an Stimmen, die ein Loblied auf die Liebe im poetischen oder narrativen Rahmen gesungen haben, reicht also von der frühesten Zeit bis in die unmittelbare Gegenwart.
Allerdings kann gerade Sexualität, also die physische Manifestation von Erotik, auch zum Zweck der Machtausübung eingesetzt bzw. missbraucht werden, wie es sich u.a. in Ernst Jüngers Roman Die Zwille (1973) zeigt, den Manuel Mackasare in seinem Aufsatz analysiert. Durchaus ähnlich wie in Heinrich Manns Professor Unrat (1905) thematisierte Jünger die Rolle von Sexualität als Symbolon eines zusammenbrechenden gesellschaftlichen Systems, das zunehmend von Technokratie beherrscht wird, aus dem eventuell nur die Asexualität des Helden Clamor zu retten vermag.
Welche tiefen und umfassenden Probleme die Unterdrückung von Erotik und Sexualität bewirken kann, hat bereits Frank Wedekind (1864–1918) besonders eindringlich in seinen Theaterstücken, Gedichten und theoretischen Reflexionen zum Ausdruck gebracht (vgl. dazu die Studie von Anja Manneck). Wie mühsam besonders homosexuelle Dichter und Autoren um Anerkennung kämpfen mussten, illustriert das Werk der schweizerischen Autorin Annemarie Schwarzenbach (gest. 1942) (vgl. dazu den Beitrag von Karolina Rapp). Wir können aber auch in den früheren Jahrhunderten eine Reihe von Beispielen finden, selbst wenn dort meist das Siegel der Verschwiegenheit nur schwer zu lüften ist. Inzwischen scheint aber sexuelle Identität freier zur Verfügung zu stehen, wie es die neueste Literatur vor Augen führt, in der sogar die ungehemmte Verfolgung von sexuellem Genuss jenseits traditioneller Geschlechterkategorien deutlich positiv gezeichnet wird (vgl. dazu den Beitrag von Marta Wimmer).
Über diesen großen, sich unablässig wandelnden Komplex reflektieren nun die Beiträger zum vorliegenden Sammelband durch wissenschaftliche Spezialuntersuchungen von konkreten Fällen, die aus den verschiedensten Jahrhunderten stammen und auf einer Tagung zum Thema „Eros und Logos: Sexualitätsnarrative in der deutschsprachigen Literatur“ vom 16. bis 17. November 2016 an der Universität Zielona Góra (Uniwersytet Zielonogórski), speziell am Institut für Germanistik (Instytut Filologii Germańskiej) in Zielona Góra, Polen, vorgestellt und diskutiert worden sind. Die Organisatoren, Wolfgang Brylla, Andrey Kotin und ich entwickelten während der Tagung und im Anschluss daran eine enge Kooperation über die Kontinente hinweg, deren Endresultat hiermit vorgelegt wird. Die Redaktion wurde zentral von mir übernommen, dies aber stets in enger Zusammenarbeit mit Brylla.