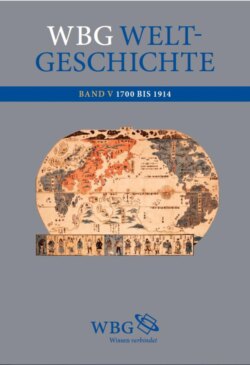Читать книгу wbg Weltgeschichte Bd. V - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pfade in die demographische Moderne
ОглавлениеDemographische und Industrielle Revolution
Die eben entfalteten Problemstellungen beziehen sich auf zwei zwischen dem 18. und dem frühen 20. Jahrhundert in Europa einsetzende und den Westen auch zunächst von anderen Teilen der Welt unterscheidende Vorgänge, die dann erst im 20. Jahrhundert auf unvollkommene Weise global wurden. Wie kam es dazu? Wie sind diese beiden fundamentalen Brüche zu erklären? Zeitlich liegt der Ausbruch aus der „malthusianischen Falle“ vor dem demographischen Übergang; wie es zur Industrialisierung kam, wird im folgenden Beitrag diskutiert. Manche möglichen Anteile an den Voraussetzungen dessen, was man „Industrielle Revolution“ nennen kann, haben dabei selbst etwas zwar nicht mit dem demographischen Übergang, wohl aber mit dem demographischen Verhalten zu tun. So bezieht sich eine denkbare Voraussetzung der Industrialisierung auf das Bevölkerungswachstum: Wenn die Bevölkerung allzu rasch gewachsen wäre, wäre der Anreiz zu arbeitssparenden Erfindungen geringer gewesen. Ein anderer denkbarer Zusammenhang betrifft die räumliche Mobilität. Manche Autoren sehen das Revolutionäre an der Industriellen Revolution in der Herausbildung freier Arbeitsmärkte. Das passt zu der Vorstellung einer „Mobilitätstransition“, wonach die vorindustrielle Gesellschaft von Sesshaftigkeit, die industrielle Moderne dagegen von hohen Migrationsraten geprägt gewesen sei. Die Frage, welche möglichen Pfade in die oben allgemein skizzierte Richtung führten, soll im Folgenden vor allem im Vergleich westlicher mit asiatischen Gesellschaften untersucht werden.
Gemäßigte Niveaus von Fruchtbarkeit
Geburt und Tod finden in der Familie, nicht im Betrieb statt – auch wenn die klare Trennung zwischen Familien und Unternehmen selbst eine Entwicklung der Moderne ist. Wenn wir den demographischen Übergang verstehen wollen, dann müssen wir also die Familiensysteme genauer betrachten. Das gilt mit Sicherheit für die Geburten, die hier zunächst thematisiert werden sollen, vielleicht aber auch für das Sterben. Eine sehr einfache Vorstellung von dem demographischen Übergang könnte darin bestehen, dass man für die Vergangenheit Geburtenzahlen in der Höhe vermutet, die dem menschlichen (d.h. dem weiblichen) Körper möglich ist. Das würde zu Bruttoreproduktionsraten (GRR) von annähernd sechs führen (also sechs Töchter bzw. zwölf Kinder pro Frau), wie sie bei Frankokanadiern im 17. Jahrhundert und bei einer täuferischen Religionsgruppe, den Hutterern, im 20. Jahrhundert beobachtet worden sind. Solche Raten kommen aber in Ländern der sogenannten Dritten Welt im 20. und auch, soweit wir Daten haben, im 19. Jahrhundert eben gerade nicht vor. In Costa Rica und in einem philippinischen Dorf, für das Daten seit dem frühen 19. Jahrhundert vorliegen (Grafik 3), liegt die GRR zwischen 1800 und 1920 höchstens bei vier, meistens auf demselben Niveau von etwa zwei bis drei. Diese Zahl war auch in europäischen Ländern um 1700 oder 1800 normal, und zwar zum einen, weil viele Frauen (noch) unverheiratet waren, und zum anderen, weil Frauen und Männer innerhalb der Ehe eben nicht so viele Kinder zeugten, wie es körperlich möglich ist. Ähnliches gilt für China, das sich das europäische Bevölkerungsdenken seit Malthus als Gegenbild zum zurückhaltenden Europa vorgestellt hat – als eine Gesellschaft, in der alle sehr früh heirateten und so viele Menschen geboren wurden, dass jeder technische Fortschritt in Mehrbevölkerung aufging. So war das historische China aber eben nicht: Zwar heirateten (fast) alle, aber überwiegend in arrangierten Ehen, die weniger als die europäischen, die ja seit dem Mittelalter auf dem Konsens der Brautleute beruhten, mit einer intensiven sexuellen Beziehung verbunden waren. In der staatsgestützten patriarchalischen Gesellschaft Chinas fanden Paare nicht aus eigener Entscheidung zusammen, sie beschlossen nicht selbst, wann sie Kinder wollten, ja sie konnten nicht einmal selbst entscheiden, ob ihre Kinder überleben sollten – konsequenterweise lag die eheliche Fruchtbarkeit im vortransitionären China unter dem europäischen Niveau. Somit ist die Vorstellung von einer „natürlichen Fruchtbarkeit“, die dann im Zuge eines Modernisierungsprozesses durch „Geburtenbeschränkung“ abgelöst wird, irreführend.
Fruchtbarkeit als sozialer Faktor
Fruchtbarkeit ist nicht natürlich, sondern sozial. Sie hängt davon ab, welche Beziehungen Menschen eingehen und wie sie diese gestalten. Oft stellt man sich die traditionelle Gesellschaft (und damit dann gleich alle nichtwestlichen Gesellschaften) irrtümlich als das genaue Gegenteil unserer Gegenwart vor. Weil in der Begründung unserer Paarbeziehungen Emotionalität und freie Wahl eine große Rolle spielen, meint man, Ehen im Europa des 18. Jahrhunderts und solche in der Dritten Welt seien generell arrangiert und materiell begründet gewesen – oder sie seien es sogar noch. Weil bei uns die Nutzung der gängigen pharmazeutischen Technik zur Vermeidung von Schwangerschaften ein wichtiger Aspekt des Erwachsen- und Selbstverantwortlich-Werdens besonders von Mädchen ist, meint man, in traditionellen Gesellschaften habe Schwangerschaft nicht einmal im Bereich dessen gelegen, worüber Paare oder Frauen selbst entschieden hätten. Die naheliegende Tendenz, sich die Vormoderne und die außereuropäische Welt als Negativ unserer Gegenwart vorzustellen, verwischt aber die großen Unterschiede zwischen den Kulturen.
Wege der Geburtenbeschränkung: 1. Stopping
Das vortransitionäre Niveau der Fruchtbarkeit – auf halbem Wege zwischen dem biologisch Möglichen und dem in der Moderne normal Werdenden liegend – kann auf drei Wege der Geburtenbeschränkung zurückgeführt werden: Stopping, Spacing und Starting. Stopping entspricht der modernen Familienplanung, bei der man so viele Kinder bekommt, wie man möchte, und dann aufhört. In vormodernen Gesellschaften ist das einerseits technisch schwierig, denn sichere Methoden (Kondome, Pille, natürliche Familienplanung) sind noch nicht entwickelt, und die gängigen Methoden (Stillen und Coitus interruptus) funktionieren nicht immer. Andererseits ist es auch wegen der hohen Kindersterblichkeit fraglich, ob ein Stopping beim Erreichen der „Zielkinderzahl“ überhaupt sinnvoll ist. Wann Stopping einsetzte, war lange ein wichtiges Thema der bevölkerungsgeschichtlichen Forschung. Es gibt durchaus schon für die Zeit um 1700 Belege für Familien aus städtischen Oberschichten der Schweiz, die ein gewisses Interesse daran hatten, ihre Söhne zum Beispiel im Rat der Stadt zu platzieren, dies aber nur für eine begrenzte Zahl erreichen konnten. Vielleicht spielt auch der Calvinismus als eine religiöse Ausrichtung eine Rolle, die die Eigenverantwortlichkeit des Individuums sehr stark betont. In der Masse der europäischen Regionen kam es allerdings erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Fruchtbarkeitsrückgang, der auf Stopping zurückgeführt werden kann. Auch wenn dieser Vorgang aufwendig (im „Princeton-Projekt“) anhand von Daten zu relativ großen geographischen Einheiten untersucht worden ist, sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Manche Autoren argumentieren, dass harte, messbare ökonomische Auslöser nicht aufzufinden seien, und dass es sich daher um einen „ideationalen“ Vorgang handeln müsse, also um die irreversible Verbreitung der für die europäische Mentalität zu diesem Zeitpunkt neuen Idee, dass man auch aufhören kann, Kinder zu bekommen. Sie folgern daraus, dass es für heutige Drittweltländer sehr wichtig ist, dass dort bevölkerungspolitische Programme durchgeführt werden, die auf die Kosten der Regulierung zielen, die also eine Mentalität fördern, die Fruchtbarkeit als gestaltbar sieht und zugleich die Methoden der modernen Medizin verbreitet. Andere Autoren haben anhand von feiner differenzierten Daten (in Preußen: Landkreise statt Regierungsbezirke) festgestellt, dass mit der Berufstätigkeit von Frauen, der Präsenz von Lehrern und dem Einkommensniveau sehr wohl ökonomische Größen nachweisbar sind, die einen Einfluss auf den europäischen Fruchtbarkeitsrückgang hatten. In dieser Sicht folgt die Geburtenzahl grundsätzlich den Bedürfnissen der Eltern, die sich im Zuge des Entwicklungsprozesses eben wandeln: Wenn Frauen arbeiten und auch Mädchen lesen und schreiben können, verzichten sie pro Kind auf mehr Einkommen als vorher, so dass sich die ökonomischen Anreize verschieben. Ein Propagieren von Familienplanung ist danach entweder überflüssig oder den Bedürfnissen der Eltern entgegengesetzt.
2. Spacing
Der zweite Weg der Geburtenbeschränkung ist das Spacing. In der älteren Forschung wird es kaum als Variante von Geburtenbeschränkung gesehen, es zählt nur das Aufhören. Abstände zwischen den Geburten können sich im Durchschnitt vor allem dadurch ergeben, dass unsichere Verhütungsmethoden, vor allem Stillen und Coitus interruptus, eingesetzt werden. Dass Letzterer bei Arbeiterfamilien in Berlin oder London um 1900 weit verbreitet war, wissen wir aus Interviewstudien. Ärzte empfahlen ihn nicht: Das medizinische Konzept von Verhütung drehte sich schon damals um einen den männlichen Höhepunkt einschließenden Geschlechtsakt, den es mit auf den weiblichen Körper zielenden, Vorbereitung und Planung erfordernden Methoden (z.B. Pessar) fertilitätsmäßig zu entschärfen galt. Die Interviewstudien zeigen, dass Sexualität in eher traditionellen, vorbürgerlichen Milieus nicht zwingend solchen bürgerlich-medizinischen Vorstellungen entsprechen musste; andererseits hinterlässt die innereheliche Alltagssexualität in den Quellen so wenig Spuren, dass sich über ihre praktischen Aspekte kaum Sicheres sagen lässt.
Geburtenabstände im Kulturvergleich
Im Kulturvergleich werden die Unterschiede deutlicher: Die für das China des 18. und 19. Jahrhunderts typische niedrige innereheliche Fruchtbarkeit kontrastiert mit einem Westeuropa, in dem im Großen und Ganzen nicht nur die Ehe eine Vorbedingung für sexuelle Aktivität war, sondern umgekehrt auch durchaus die sexuelle Aktivität ein zentraler Teil des ehelichen Lebens. Westeuropa mag, wenn man die geistlichen und weltlichen Moralpredigten des 19. Jahrhunderts liest, von einer „viktorianischen“ und sexualitätsfeindlichen Kultur geprägt erscheinen. Das liegt aber vor allem daran, wie eifersüchtig in dieser Kultur der Zugang zur Ehe bewacht wurde, und wie viel Anstoß man am Verhalten derer nahm, die hier Umwege gingen. In der Ehe selbst sah das anders aus. Im Ost-West-Vergleich fällt auf, dass zu einem aktiven, erfolgreichen Leben in Westeuropa nicht nur Haus und Hof (oder Gewerbe und Beruf) und eben die Ehe gehörten, sondern auch, dass in der Ehe Kinder kamen, solange das eben biologisch möglich war. Wie viele das waren, konnten verheiratete Männer und Frauen in Westeuropa selbst entscheiden; niemand redete ihnen in ihren sexuellen Alltag hinein. Das war in China anders: Konfuzianische Lehren empfahlen sexuelle Zurückhaltung, weil zu häufiger Verlust des Samens auf Männer schwächend wirke. Vor allem aber war es gar nicht vom Paar selbst zu entscheiden, ob es ein Kind zeugte. Das war eine Frage, die von der (mehrere Paare umfassenden) Familie entschieden wurde, und die Familie bestimmte in China und Japan auch, welche dennoch gezeugten und womöglich überzähligen Neugeborenen man tötete. Kindstötung war in Europa dagegen tabuisiert; statt des japanischen mabiki („Setzlinge ausdünnen“) und des chinesischen ni ying („Kind ertränken“) war der Begriff des „Findelkindes“ allgemein bekannt. Hospitäler, vor allem im katholischen Europa, nahmen um die Mitte des 19. Jahrhunderts über 100.000 ausgesetzte Kinder auf, der größere Teil davon stammte von verheirateten Paaren.
Stillgewohnheiten
Es ging an dieser Stelle zunächst um Coitus interruptus und innereheliche Abstinenz als Wege zu größeren Geburtenabständen, darüber hinaus um den Umweg der Kindstötung oder -aussetzung. Eine weitere wichtige Spacing-Methode ist das Stillen. Da regelmäßiges Stillen den Eisprung unterdrückt, kann man es durchaus als Verhütungsmethode betrachten, auch wenn Mediziner vor ihrer Anwendung warnen und bevölkerungspolitisch motivierte Familienplanungsprogramme sie selten propagiert haben. Stillen ist andererseits ein Mittel, das nicht nur diesem Zweck dient, sondern in erster Linie eben der Ernährung des Kindes. Es scheint auch nicht situativ je nach Kinderwunsch, sondern landschaftlich unterschiedlich (z.B. in Norddeutschland lange, in Süddeutschland kurz) praktiziert worden zu sein. Extrem hohe Kinderzahlen auf der Schwäbischen Alb hängen mit dem dort üblichen Nichtstillen zusammen – stattdessen wurde Milch-Getreide-Brei gefüttert, der sparsamer- und verheerenderweise oft mehrere Tage stehen gelassen wurde. Die resultierende hohe Säuglingssterblichkeit wurde durch mehr Geburten kompensiert, bis Stillkampagnen im 20. Jahrhundert auch auf der Alb zu einer veränderten Praxis führten. Wieweit das Verhalten der nichtstillenden Schwäbinnen und der stillenden Norddeutschen als bewusste oder auf der Ebene des allgemein Üblichen halbautomatisch ablaufende Strategie zu interpretieren ist, ist offen.
3. Starting: Ledigbleiben
Neben Geburtenbeschränkung und Geburtenabständen besteht der dritte wichtige Weg zu einer niedrigen Reproduktionsziffer im Starting, also im Beginn der elterlichen Beziehung. Europa, speziell das nordwestliche Europa, unterschied sich von anderen Regionen der Welt traditionell dadurch, dass Erwachsene ledig sein konnten. Sie heirateten spät, etliche heirateten gar nicht. Der britische Mathematiker John Hajnal hat in den 1950er Jahren festgestellt, dass westlich der inzwischen so genannten Hajnal-Linie von Triest nach St. Petersburg das „europäische“, das heißt westeuropäische Heiratsmuster von später und nicht universaler Heirat galt. Östlich davon war (und ist) das anders: In russischen Volkszählungslisten des 19. Jahrhunderts wurde es jeweils ausdrücklich begründet und erklärt, wenn ein 18-jähriger Mann ungewöhnlicherweise noch unverheiratet war („verkrüppelt“, „hässlich“, „dumm wie die Nacht“). Im Westen war es dagegen zunächst einmal eine ganz grundsätzlich denkbare Möglichkeit, dass ein Mann oder eine Frau nicht heiratete. Zum Teil ist das ein Erbe des bereits im Mittelalter etablierten Zölibats der Mönche und Nonnen, aber auch der Weltpriester. Zwar geriet der Zölibat seit der Reformation unter Druck: verdächtig als unnütze Lebensform, hinter der unfassbare Ausschweifungen vermutet wurden, konkurriert durch die seit Luther sakralisierte Ehe, im weltlichen Bereich staatlich sanktioniert durch eine auf die Ehe drängende staatliche Gesetzgebung „wider das Sitzen auf eigene Hand der ledigen Weibspersonen“. Aber der religiöse und weltliche Ledigenstand spielte besonders in katholischen Ländern wie Irland eine demographisch durchaus gewichtige Rolle. Auch bäuerliche Familien auf dem Kontinent trafen nicht selten Regelungen, die es ihren Kindern ermöglichten, unverheiratet auf dem Hof zu bleiben. Das Ledigbleiben war nicht unbedingt Scheitern, es konnte auch eine Wahl sein. Das ist die Kehrseite der Tatsache, dass das Heiraten im Westen (trotz allen kritischen Beäugens durch die ältere Verwandtschaft) kirchenrechtlich grundsätzlich auf dem Konsens des Paares und nicht auf einem Vertrag zwischen den (schwieger-)elterlichen Familien beruhte. Die römische Kirche hatte bereits im Frühen Mittelalter – wie spekuliert worden ist, aus ökonomischen Motiven – die Eheschließung aus der Kompetenz der Verwandtschaft in die des Paares gelegt, die Paarbeziehung zum Sakrament gemacht und die Ehe unter Verwandten verboten. In Europa, ja auf dem eurasischen Doppelkontinent insgesamt, regelte zudem die Institution der Mitgift – im Gegensatz zum in Afrika verbreiteten Brautpreis – die ökonomischen Familienbeziehungen anlässlich einer Heirat. Das heißt, dass die neugegründeten Paare von der Schwiegerfamilie materiell gestärkt wurden, und innerhalb des neuen Paares besonders die Frau. Brautpreis bedeutet dagegen, dass die Frau als Gut, als Objekt von hohem Wert für diejenige Familie gesehen wird, der sie jeweils untergeordnet ist und für die sie zu arbeiten hat, und dass sie deshalb ihrem Vater abgekauft werden muss. Westeuropa war also bereits seit dem Mittelalter eine Region, in der Paare und Frauen eine vergleichsweise starke Stellung gegenüber Verwandtschaften und Vätern einnahmen.
Starting: Heiratsalter
Zum europäischen Heiratsmuster gehört aber nicht nur das mögliche Ledigbleiben, sondern auch das späte Heiraten. „Spät“ heißt, dass das Durchschnittsheiratsalter in der Regel mindestens 25, oft 30 Jahre und mehr betrug. So lagen zwischen der Pubertät (oft erst mit 17 oder 18 Jahren) und den ersten Kindern mehrere Jahre, die die mögliche Kinderzahl entscheidend reduzierten. Zum typischen Lebenslauf von Jungen und Mädchen gehörte eine Phase des Erwachsenwerdens, die durch Arbeit für andere Haushalte oder Betriebe geprägt war, als Lehrling, Knecht oder Magd. Man unterlag in dieser Zeit in der Regel keinem förmlichen Heiratsverbot, aber mit der Heirat wurden Dienstverhältnisse dieser Art normalerweise aufgelöst, und daher ergab es wenig Sinn, allzu früh zu heiraten. Besser war es, den Lohn anzusparen, denn das Heiraten hatte einschneidende Konsequenzen für die Stellung des Paares im System sozialer Unterstützungsverpflichtungen. In Westeuropa wurde erwartet, dass ein verheiratetes Paar auch in der Lage war, sich selbst und seine Kinder zu ernähren. Gelang dies nicht, fiel das Paar nicht mehr seinen Eltern und Schwiegereltern zur Last, sondern der Gemeinde, die in manchen Regionen deshalb zeitweise auch versuchte, die Unterschichten von der Ehe auszuschließen. Das Gründen eines eigenen Haushaltes bei der Heirat, der Gesindedienst und die Existenz eines auf der Gemeinde, nicht der Familie beruhenden Armenwesens sind also die Schlüsselelemente, die das europäische Heiratsmuster erklären. Es kontrastiert mit asiatischen Familienformen, die freilich durchaus Veränderungen des Heiratsverhaltens als strategische Reaktion auf Knappheit kannten: In China und Japan etwa blieben viele Männer unverheiratet, da die Geschlechterproportion durch Kindstötungen verzerrt war. In Indien entschieden die großen komplexen Familien nicht selten, dass einzelne der unter ihrem Dach lebenden Männer nicht heiraten sollten, oder es mussten sich Brüder eine Frau teilen. Nicht allein in Europa funktionierte das Heiraten als demographische Steuerungsgröße, speziell europäisch waren jedoch die Sozialformen der familialen Selbständigkeit und des außerfamilialen Arbeitsmarktes.
Migration
An dieser Stelle kann man darüber nachdenken, ob auch Migration Teil einer Weltgeschichte der „Demographischen Revolution“ sein sollte (vgl. auch den Beitrag „Migration im Kontext von Globalisierung, Kolonialismus und Weltkriegen“ in Band VI). Migration ist offensichtlich ein wichtiger Aspekt von Globalisierung im Sinne eines Zusammenrückens der Welt schon im 18. und 19. Jahrhundert durch Kolonialisierung und Handel, Sklaverei und Forschungsexpeditionen. Dass sie zudem zum Entkommen aus der „malthusianischen Falle“ ihren Teil beitrug, lässt sich weniger anhand des britischen als des amerikanischen Wirtschaftswachstums zeigen: Ein erhöhter Einsatz von Inputs (also Wachstum, ohne dass die technische Effizienz verbessert wurde) war dort möglich, wo große natürliche Ressourcen in Form von Land mit hinzuwandernden und sich rapide vermehrenden Menschen zusammenkamen – die amerikanische Geschichte ist als Geschichte der „Frontier“, der nach Westen vorrückenden Siedlungsgrenze interpretiert worden. Schon im 18. Jahrhundert beobachtete Benjamin Franklin die hohe Fruchtbarkeit der amerikanischen Siedler; Zuwanderung und Fruchtbarkeit waren also parallele Vorgänge.
Migration als Druckausgleich?
Fraglich ist, ob Abwanderung und Sterblichkeit auf ähnliche Weise zwei Seiten einer Medaille waren, so dass Migration als eine Art weltweiter demographischer Druckausgleich zu interpretieren ist. Ging man vor allem dann fort, wenn einem sonst der Hungertod drohte? Im irischen Fall etwa, wo eine Kartoffelfäule 1845 bis 1849 die Ernte vernichtete und in der Folge Hunderttausende starben sowie weitere Hunderttausende auswanderten, trifft diese Katastrophenlesart von Migration zu – auch wenn sie vielleicht etwas kurz greift, denn entscheidend für das irische Drama war nicht das Missverhältnis von Bevölkerung und Lebensmittelmengen, sondern die fehlende Kaufkraft und die marktradikale Politik der britischen Herrschaft, die den Getreideexport aus Irland inmitten der Hungerkatastrophe fortlaufen ließ. Andererseits war Hunger als Standarderklärung für Auswanderung etwa im deutschen Fall (im 18. Jh. wanderten um die 100.000, zwischen 1820 und 1920 5,5 Millionen nach Amerika aus) viel eher soziale Konstruktion als Abbild der Realität. Die deutschen Behörden, Regierungen und aufgeklärten Sozialtheoretiker mochten es sich nicht vorstellen, dass die Abwanderung von Untertanen, die staatlicher Fürsorge unterstanden, nicht auf ein politisches Versagen des Staates, auf Misswirtschaft, Hunger und „Überbevölkerung“ verwies. So entstand eine konventionelle Deutung der Amerikamigration als Katastrophe, Verführungs- und Leidensgeschichte, in der unentdeckt blieb, wie sehr Amerikawanderung mit der begründeten Attraktivität der Neuen Welt und dem Gelingen der Lebenspläne von Millionen zu tun hatte. Noch heute vermittelt das größte Auswanderermuseum Deutschlands in Bremerhaven eine solche Opfergeschichte, wenn es sich in Anlehnung an die bekannten „Stolpersteine“ für Holocaustopfer mit Pflastersteinen aus Messing umgibt, in die jeweils der Name eines Auswanderers geprägt ist – unsere Erinnerungskultur will Opfer, sie ignoriert die Glückspilze, das in seiner Außergewöhnlichkeit Normale, die Alltäglichkeit dessen, was nur den in Sicherheit lebenden Nachgeborenen als gewaltiger Schritt ins Unsichere erscheint.
Weltgeschichte als Migrationsgeschichte?
Wenn Auswanderung demnach oft zu wenig in ihrer Normalität als Teilhabe an Land- und Arbeitsmärkten gesehen wird, wie sie im 19. Jahrhundert gar nichts fundamental Neues war, ist dann die Vorstellung von einer „Migrationstransition“, von einem großen Bruch zwischen der sesshaften Vormoderne und der mobilen Moderne gänzlich irreführend? Auf diese Frage sind zwei Antworten zu geben, eine quantitative und eine, die sich auf die Systemlogik von Wanderung bezieht: In quantitativer, mengenmäßiger Sicht scheint es so, dass die ältere modernisierungstheoretische Vorstellung inzwischen aufgegeben wurde, wonach vormoderne Gesellschaften innerhalb und außerhalb Europas immobil waren. Stattdessen gilt jetzt nicht nur (richtigerweise) Migrationsgeschichte als Weltgeschichte, sondern auch (was etwas problematischer ist) Weltgeschichte als Migrationsgeschichte – als ob sie immer und überall gleichermaßen von Wanderung geprägt worden wäre, als ob nicht auch in bestimmten Epochen und Regionen im Daheimbleiben das Charakteristische oder auch Erklärungsbedürftige und Interessante gelegen hätte. Aktuelle Schätzungen der europäischen Migrationsraten seit dem 16. Jahrhundert geben ein differenzierteres Bild. Sie umfassen sowohl die Aus- und Einwanderung über Grenzen hinweg, Seeleute und Soldaten, als auch die Migration vom Land in die Städte. Was (bedauerlicherweise) fehlt, ist die sogenannte Mikro-Mobilität, also die Wanderung zwischen kleineren Orten. Auch dies wäre ein wichtiges Thema, denn die ältere Forschung ging noch davon aus, dass zum Beispiel das typische vormoderne französische Dorf ein genetisches Isolat darstellte, in dem Verwandtschaftsbeziehungen auf die Nachbarschaft beschränkt waren. Erst durch die Modernisierung seien diese Isolate dann aufgebrochen worden. Auch ohne Blick auf diese kleinräumigen Wanderungen zeigt Grafik 4 jedoch, dass zwar einerseits die Migrationsraten in Europa (pro Kopf der Bevölkerung) schon in der Frühen Neuzeit nicht um Größenordnungen unter denen des 19. Jahrhunderts lagen, dass aber andererseits an der alten These von der mobility transition (als gestrichelte Linie skizziert) durchaus etwas ansatzweise Richtiges war. Die Verdoppelung der Migrationsraten im späten 19. Jahrhundert setzte aber auf einem generell recht hohen Niveau an. In den Niederlanden, also in einem der Zentren des westeuropäischen Ausbruchs aus der „malthusianischen Falle“, erreichten die Migrationsraten schon um 1600 an die 70 Prozent, vor allem wegen der starken Urbanisierung und des Aufschwungs der Seefahrt.
Grafik 4: Migrationsraten in Europa, 1500–1900 (nach: Lucassen/Lucassen 2009).
Sesshaftigkeit als Untersuchungsgegenstand
Dennoch bleibt Migration in der Regel – anders als Geburt und Tod – ein Minderheitenphänomen. Also sollte Migrationsgeschichte sich vor allem damit beschäftigen, die erstaunliche Sesshaftigkeit der Mehrheit in bestimmten Kulturen und Epochen zu erklären. Die folgende Karte zeigt ein gutes Beispiel für die Neigung der aktuellen Migrationsforschung, immer und überall Migration zu sehen. Anhand von Daten der Volkszählung von 1931 und damit bezogen auf Geburtsjahrgänge seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ist die Anzahl der jeweils aus benachbarten Provinzen stammenden indischen Männer zu sehen. In Dirk Hoerders wichtiger Welt-Migrationsgeschichte »Cultures in Contact« steht die Karte im Kontext einer Darstellung indischer Migrationssysteme des 19. und frühen 20. Jahrhunderts von der Heirats- und Entbindungsmigration der Frauen bis zur Wanderung in industrielle Zentren (Bombay, Kalkutta) und landwirtschaftliche Plantagen (Tee, Gummi, Kaffee). Die Pointe dieser Karte läge aber eigentlich darin, dass angesichts der großen indischen Bevölkerung die hinter den Pfeilen stehenden Zahlen – vom Industriezentrum Bengalen und der Plantagenregion Assam abgesehen – tatsächlich winzig sind. Hoerder verschweigt auch nicht, dass (1891 bzw. 1931) die Migration zwischen den Provinzen gerade 3 Prozent, zwischen den Distrikten 11 Prozent der Bevölkerung ausmachte, also möglicherweise noch unter dem europäischen Niveau des 17. Jahrhunderts lag.
Indien: Kaste und kollektiver Status
Woran lag das? Binnenmigration in Indien ist noch heute selten, überwiegend weiblich, führt über kurze Distanzen und nimmt tendenziell nicht zu. Antworten kommen primär aus der ethnographischen Erforschung des gegenwärtigen Indien. Beginnen wir mit dem fremdartigsten Aspekt der indischen Kultur: dem Kastenwesen, das bekanntlich vor allem auf den Gebieten des gemeinsamen Essens und des Heiratens Barrieren zwischen bestimmten Unterkasten, Jātis, aufbaut und ein sich nicht selten gewalttätig entladendes Gruppenbewusstsein begründet. Der entscheidende Punkt dabei ist nicht so sehr das damit verbundene Denken in Hierarchie, Reinheit und sozialer Distanz in ganz Indien, etwa die Tatsache, dass man überall Brahmanen, Kshatriyas usw. antrifft und diese vier Varnas oder „Farben“ eben sozial ungleich sind, sondern der extreme Lokalbezug der einzelnen, den „Farben“ zugeordneten (Unter-)Kasten oder Jātis. Eine Jāti kann man sich als eine Familiengruppe vorstellen, die ihren Namen und ihre Funktion aus ihrer Stellung zum jeweiligen lokalen Königtum erhalten hat und in einer rituell, zum Teil aber auch durchaus ökonomisch arbeitsteiligen Beziehung zu anderen lokalen Jätis steht. Angehörige verschiedener Kasten arbeiten durchaus zusammen, und es gibt insofern keinen in der Arbeit liegenden Grund, nicht an Orte zu gehen, wo die eigene Kaste nicht vertreten ist – obwohl sie vor allem in der Großstadt helfen kann. Der Kastenstatus kann durch Migration verloren gehen, was für manche kolonialzeitliche Auswanderer nach Mauritius oder Südafrika ein erhebliches Problem darstellte – von anderen aber erleichtert begrüßt wurde. Es ist allerdings sehr wohl notwendig, dass Jātis untereinander ihre soziale Stellung kollektiv aushandeln. Das hat massive Auswirkungen auf die Formen sozialer Mobilität und auf das Arbeitsangebot. Soziale Mobilität erfolgt in Indien noch heute zu einem erheblichen Teil kollektiv auf der Ebene der Jātis durch Prozesse der Sanskritisierung, also der kollektiven Übernahme von Verhaltensmustern höherer Kasten. So wird zur Zeit etwa die zunächst nur in den oberen Kasten verbreitete Praxis einer Besserbehandlung von Jungen bis hin zur selektiven Abtreibung weiblicher Föten zunehmend von unteren Kasten übernommen. Kollektive lokale Aushandlungsprozesse bestimmen auch die Lohnsätze in der Landwirtschaft, die von Ort zu Ort erheblich variieren können, ohne dass sie durch Wanderung genutzt und ausgeglichen werden. Sie bestimmen zudem auch die Menge an Arbeit, die angeboten wird. Arbeit für andere ist eng mit dem kollektiven Status verbunden. Im nordwestindischen Gujarat wurden Orte untersucht, in denen die jungen Männer, obwohl sie es durchaus nötig hätten, Geld zu verdienen, zum Ärger ihrer Väter und Großväter demonstrativ nichts-tuend auf dem Dorfplatz herumhängen, um Status zu demonstrieren. Wenn sie schon für andere arbeiten, dann so, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht öffentlich sichtbar wird, also lieber als Teilpächter, keinesfalls als Landarbeiter. Der Besitz eines eigenen bäuerlichen Betriebes – auch wenn fast alle Bauern auch für andere arbeiten und haushaltsexterne Arbeiter beschäftigen – hat in einer Gesellschaft, in der es auf gegenseitige kollektive Statusdemonstration ankommt, einen hohen Wert. Umgekehrt sehen es Mitglieder niedriger Kasten schlicht nicht ein, für Mitglieder höherer Kasten unbeaufsichtigt engagiert zu arbeiten, während diese müßiggehen. Die Tatsache, dass Arbeit und damit auch Arbeitsmigration kulturelle Bedeutungen tragen, schlägt sich auch auf die Heiratsmobilität nieder, die in Indien vor allem eine der Frauen ist: Frauen werden in Gujarat zum prestigeträchtigen Tauschobjekt zwischen Familien, wobei ein zentraler Punkt der Verhandlungen stets ist, dass sie in der neuen, sie aufnehmenden Familie nur im Haus arbeiten, also nicht in den Arbeitsmarkt eintreten. Das indische Familiensystem der joint family – mit bei den Eltern und Brüdern bleibenden Söhnen, abwandernden, aber dem Arbeitsmarkt fernbleibenden Töchtern – passt also ebenfalls zur indischen Sesshaftigkeitskultur. Eine kulturelle Erklärung niedriger Migrationsraten und darüber hinaus einer geringen Ausprägung dessen, was die Ökonomen unter einem Arbeitsmarkt verstehen, scheint also durchaus plausibel, und im Vergleich mit dem Westen wäre zu fragen, weshalb (und seit wann) Arbeit für andere und an anderen Orten hier nicht mit den Notwendigkeiten von Statusdemonstration kollidiert.
Migration zwischen indischen Provinzen im frühen 20. Jahrhundert.
Interlocking markets und unfreie Arbeit
Ein weiteres Argument, das durchaus zur Hochschätzung der Arbeit in selbständigen Familienbetrieben beitragen könnte, bezieht sich auf die rechtliche Seite der Arbeitsbeziehungen. Die meisten Wanderungen im noch kolonialen Indien waren solche, die man als unfreie Arbeit (etwa von Kulis) kennzeichnen kann. Das birgt zwei Aspekte: Erstens führte die Wanderung aus dem Dorf in die ferngelegene Plantage nicht aus dem einen in den anderen Arbeitsmarkt, sondern aus einem Familiensystem, das seine Mitglieder erheblichen Finanzierungszwängen vor allem für die Heirat unterwarf, in ein System der multiplen Abhängigkeit von Arbeitgebern, die gleichzeitig auch Kreditgeber, Lebensmittelverkäufer und Hausherren waren. Solche interlocking markets beschränkten die Bewegungsfreiheit der in ihnen Arbeitenden. Zweitens konstruierte die britische Kolonialmacht Arbeit gezielt als unfrei: Zwar wurden 1855 die Sklaven befreit, 1865 aber wurde mit dem criminal breach of contract act ein System der Arbeitsbeziehungen errichtet, das im Kontrast zur in England erkämpften Entkriminalisierung der Arbeitsmobilität das Verlassen des Arbeitsplatzes zur Straftat machte und erst 1935 aufgehoben wurde. Das Bleiben unterliegt also auch durchaus politischer, gesetzgeberischer Konstruktion.
Grafik 5: Nettomigration und Realeinkommen in Westeuropa, 1900–1909 (GDP nach Maddison 2001, Nettomigration eigene Berechnung nach Mitchell 1998).
Migration und Einkommensdifferenzen
Kommen wir zur Frage zurück, ob Migration als System des Druckausgleichs in eine Geschichte des demographischen Übergangs zu integrieren ist. Wäre es so, müsste der Westen das Bevölkerungswachstum außereuropäischer Länder als Gefahr wahrnehmen, von Migranten überrannt zu werden – eine Wahrnehmung, die den ökologischen und bevölkerungspolitischen Diskurs seit etwa 1970 stark geprägt hat. Demgegenüber neigt die aktuelle historische Migrationsforschung dazu, die Vorstellung der (neoklassischen) Mainstream-Ökonomie für unzureichend, eben „ökonomistisch“ zu erklären, dass Migranten sich an Reallohnunterschieden orientieren. Spötter fragen: Wenn aus dem einen Land fünf Mal so viel ausgewandert wurde wie aus dem anderen, war es dann fünf Mal so arm? Grafik 5 zeigt Raten der (Netto-)Migration und der Realeinkommen in westeuropäischen Ländern um 1900. Offensichtlich gab es dort in der Tat einen nicht ausnahmslosen, aber doch linearen Zusammenhang zwischen Reallohn und Nettomigration. Ähnliche Grafiken für das Indien noch des späten 20. Jahrhunderts zeigen einen solchen Zusammenhang dagegen nicht. Ob es ihn gibt, hängt also von historischen Bedingungen ab. Er kennzeichnet eine Tiefendimension westlicher Gesellschaften, nämlich ihre auf dem europäischen Heiratsmuster beruhende Orientierung auf Arbeitsmärkte.
Lebenserwartung
Schauen wir nun die andere Seite des demographischen Übergangs an: die Sterblichkeit. Das Übergangsmodell legt die Erwartung nahe, dass besonders in den hochentwickelten Gesellschaften Westeuropas die Lebenserwartungen relativ früh anstiegen, früher als etwa im übervölkerten Ostasien, das den „Übergang“ danach erst im 20. Jahrhundert erfuhr. Für Malthus galt besonders China als das Gegenbild Westeuropas: Während hier das späte und an ökonomischen Zwängen ausgerichtete Heiraten als preventive check das Bevölkerungswachstum in Schach hielt und Hungersnöte – den positive check – verhinderte, führte dort die universale Heirat zu einer übermäßig dichten Bevölkerung, niedrigen Löhnen und hoher Sterblichkeit. Die neuere Forschung sowohl zu Europa als auch zu Asien hat dieses Bild widerlegt. In groben Zügen lag die Sterblichkeit in Europa und in Asien ungefähr auf demselben Niveau, nahmen Lebenserwartungen mehr oder weniger überall zu (mit einem allerdings ausgeprägten Spurt Westeuropas um 1900), und die interessanten Unterschiede liegen viel eher in der Frage, wen es innerhalb eines Ortes oder einer Familie in welchen Situationen härter traf, als in den Unterschieden zwischen den Kontinenten.
„Krankheits-Umwelt“
Die Geschichte der Sterblichkeit ist zu großen Teilen Naturwissenschaft, reine Biologie, die der Geschichte der Menschen kausal vorgelagert ist. Fertilität ist sozial; was an ihr biologisch ist, ergibt sich aus Beziehungen zwischen Menschen. Sterblichkeit ergibt sich dagegen aus den Beziehungen zwischen Menschen und Mikroorganismen. Ein zentraler Begriff ist der des disease environment, der „Krankheits-Umwelt“. Die Alte Welt bildete ein großes disease environment, innerhalb dessen Pest, Grippe, Pocken und Cholera frei zirkulierten. Europäer, Araber und Asiaten bildeten daher Immunitäten aus, die weiträumig nützlich waren. Das subsaharische Afrika, vor allem Westafrika, bestand dagegen aus vielen kleingekammerten „Krankheits-Umwelten“. Wessen Körper mit angolanischen Mikroorganismen zurechtkam, der konnte dennoch sterben, sobald er in Kontakt mit solchen aus Guinea kam. Groß waren die Sterberisiken daher vor allem beim transatlantischen Sklavenhandel. Amerika schließlich war von Eurasien über Jahrtausende isoliert – mit verheerenden Folgen in der Frühen Neuzeit.
„Epidemiologischer Übergang“
Ein Großprozess des 19. Jahrhunderts lag im „epidemiologischen Übergang“, der Verschiebung der Todesursachen von den Hunger- zu den Abnutzungskrankheiten. Das verweist auf die besser werdende Ernährung, also auf ein Wirtschaftswachstum, das zu einem guten Teil auf der Produktivitätszunahme in der Landwirtschaft beruhte und sich auf Dauer in einem längeren Leben niederschlug. Allerdings war Hunger nicht in allen Teilen der Welt gleichermaßen ein Problem, und der Fortschritt der Ernährung verlief alles andere als linear. Die Herausbildung von Märkten war zwar eine wichtige Grundlage für ökonomisches Wachstum, aber das kam aus drei Gründen nur sehr langsam bei den menschlichen Körpern an: Erstens belohnen Märkte, was jeweils knapp ist. In der Industrialisierung waren das nicht die arbeitenden Menschen, sondern die Maschinen. Es stiegen also zunächst die Kapitalerträge an, erst später die Löhne, Körpergrößen und Lebenserwartungen. Zweitens waren die Löhne dort besonders hoch, wo besonders effizient produziert wurde: in den Städten. Dort standen die Fabriken, die viele Menschen zusammenbrachten, dort waren auch Handel und Verkehr am intensivsten. Städte waren aber genau aus diesen Gründen auch besonders ungesund; sie wuchsen, weil die Zuwanderung den Sterbeüberschuss übertraf. Drittens konnte die Ausbildung von Märkten für Lebensmittel auch bedeuten, dass diese in die kaufkräftigen Städte fortverkauft wurden, anstatt dass die örtlichen Konsumenten zum Zuge gekommen wären – ein Phänomen, das anlässlich der letzten großen indischen Hungerkrise von 1944 entdeckt wurde.
Eigentümergesellschaft und Tod
In Westeuropa, besonders in den nordwesteuropäischen Eigentümergesellschaften, war zudem die Besitzungleichheit ungleich schärfer als in Asien, wo besonders in China der Staat und nicht das Eigentum die Grundlage gesellschaftlicher Autorität bildete. Das westeuropäische Armenwesen zielte nicht so sehr darauf, die hier zahlreichen Besitzlosen zu schützen, sondern auf die strukturellen Opfer der Sterblichkeit in einer Gesellschaft, die um die Kernfamilie und deren Ernährer herum gebaut war: auf die Witwen und Waisen. Hungerkrisen konnten bis weit ins 19. Jahrhundert hinein besonders die Unterschichten daher tödlich treffen. In China dagegen sorgte der kaiserliche Staat sowohl für den Schutz der Bauern vor Verschuldung und dem Verlust ihres Eigentums, so dass keine breite Besitzlosenschicht entstand, als auch für die Schaffung hinreichender Vorräte, die Hungerkrisen viel weitgehender als in Europa verhinderten. Auch von den größeren und komplexeren asiatischen Familien könnte man erwarten, dass sie ihre Mitglieder vor wirtschaftlichem Druck schützten. Das war aber nicht der Fall: Komplexe Familien gab es auch in Europa, wo sie den an Eigentum Armen ohne Unterstützung durch einen patriarchalischen Staat wenig gegen den Hunger halfen. Die ausgereifte chinesische Medizin gab den Menschen schließlich Handlungsmöglichkeiten in die Hand, die das Leben erheblich verlängern konnten, wenn man sich denn darum bemühte. Umgekehrt wurden in China diejenigen, um die man sich nicht weiter bemühen wollte, gleich nach der Geburt dem Tod überlassen. Der Tod war in China also grundsätzlich stärker durch soziales Handeln, durch Hygiene und Kindstötung, im Griff der Menschen, in Europa dagegen eher eine passiv erduldete Folge des Fehlens materieller Güter.
Verhinderung von Ansteckung
Neben der besseren Ernährung steht die verhinderte Ansteckung im Zentrum des langfristigen Fortschritts der Lebensdauer. Auch dies ist eine nicht besonders geradlinige Geschichte. Der Übergang zur Moderne war zunächst mit der Herausbildung von Staaten, speziell im Westen eines ganzen Weltsystems von miteinander konkurrierenden Staaten verbunden. Man hat versucht, den Gegensatz zwischen China und dem Westen mit dem Begriffspaar Weltreich – Weltsystem zu fassen. Das chinesische „Weltreich“ und das isolierte Japan kamen mit relativ wenig Militärs aus, die Europäer dagegen mischten auf ihren Kriegszügen Menschen und Mikroben immer wieder neu durcheinander. Auch die Entdeckung neuer Weltteile bedeutete für Entdecker und Entdeckte immer wieder die Konfrontation mit neuen Krankheiten. Deren Bekämpfung ging durch drei große Phasen: vom Impfen über die Sanitätsreform zur Labormedizin – oder institutionell: vom Staat über die Stadtgemeinde zum Krankenhaus. Das Impfen gegen die Pocken wurde in China bereits im 17. Jahrhundert praktiziert. In vielen Ländern (Ägypten, zahlreichen europäischen Staaten, Jamaika) gelang es seit dem späten 18. Jahrhundert, die Pockensterblichkeit mit Hilfe der vom britischen Arzt Edward Jenner entwickelten Impfung mit Kuhpockenserum erheblich zurückzudrängen. Für Impfkampagnen waren (und sind) staatliche Strukturen erforderlich; Impfen bleibt bezogen auf die Verbreitung der Erreger wirkungslos, wenn nicht ein großer Teil der Bevölkerung erfasst wird.
Städtische Gesundheitspolitik
Dass wirtschaftlicher Fortschritt vor allem in der ungesunden Stadt stattfand, wurde schon erwähnt. Da man sich gerade in der modernen Klassengesellschaft nicht wirklich aus dem Weg gehen konnte, kamen Koordinierungsprobleme zwischen Arm und Reich in bisher unbekanntem Ausmaß auf. Kommunalen Verwaltungen gelang es in Europa erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, städtische Umweltbedingungen so zu verbessern, dass Seuchen wie die Cholera nicht mehr ganze Städte bedrohten. Besonders wichtig war dabei das Wasser. Frisch- und Abwasser mussten in einem getrennten System von „Arterien“ und „Venen“ fließen, dem alle Bewohner sich anschließen mussten – ein Netz, das nicht privat betrieben werden konnte. Man musste nicht die richtigen wissenschaftlichen Theorien vertreten, um die richtige städtische Gesundheitspolitik zu verfolgen. Manche westliche Mediziner folgten noch im späten 19. Jahrhundert der Miasma-Theorie, die üble Dämpfe für Krankheiten verantwortlich machte, andere bereits der Auffassung Robert Kochs, dass die Ansteckung mit Bakterien entscheidend sei. Üble Dämpfe zu bekämpfen, konnte aber die richtige Strategie sein, etwa nach dem Great Stink von London 1858, als die Themse so stank, dass die Sitzungsräume des Parlaments mit feuchten Laken verhängt werden mussten. Nicht die feuchten Laken, wohl aber die überfällige Einrichtung einer städtischen Kanalisation, die damals beschlossen wurde, war der richtige Weg. In Hamburg dagegen hatte sich bereits die moderne Ansteckungstheorie Robert Kochs durchgesetzt, als die Cholera 1892 eingeschleppt wurde. Quarantänemaßnahmen zum Schutz der Einheimischen vor den aus Osteuropa kommenden mutmaßlichen Trägern des Erregers halfen aber wenig in einer Stadt mit großer sozialer Ungleichheit, in der immer noch die Armen die Abwässer der Reichen tranken. Auch das Krankenhaus mit seiner Konzentration medizinischer Kompetenz – aber auch eben von Ansteckungsgefahren – half erst spät. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war es eher kontraproduktiv; dann immerhin konnten Patienten halbwegs sicher sein, dass sie, wenn sie mit einer bestimmten Krankheit eingeliefert wurden, auch an dieser und nicht an einer erst im Krankenhaus dazugekommenen Krankheit starben. Aus der weitgehenden Unwirksamkeit der modernen Labormedizin in der Zeit des europäischen Sterblichkeitsrückgangs im 19. Jahrhundert ist gefolgert worden, dass dieser letztlich eben der verbesserten Ernährung zu verdanken sei, also der Wirtschaft und nicht der Medizin. Das mag so sein, aber der Vergleich mit ostasiatischen Ländern und ihrer Kultur des pfleglichen Umgangs mit dem Körper zeigt, dass Ansteckung durch Sauberkeit und abgekochtes Wasser auch unter vormodernen Bedingungen vermieden werden konnte.
Verschiebung des Sterbealters
Mit dem Tod von Neugeborenen wurde ein weiterer großer Veränderungsprozess angesprochen, der wiederum weltweit, aber uneinheitlich verlief: die Verschiebung des Sterbealters. Bei ihrer Geburt waren (und sind) die Menschen zwar nicht von den Mikroorganismen, wohl aber von den Konjunkturen und der allgemeinen Wirtschaftslage abgekoppelt. Um 1800 begannen Menschen ihr Leben unter dem Druck biologischer Gefahren und gerieten dann im Laufe der Kindheit in den Bereich sozioökonomischer Risiken. Man starb typischerweise entweder kurz nach der Geburt (wo sich die Sterberaten häuften) oder irgendwann im Lauf des weiteren Lebens, das im Prinzip sowohl für 10- als auch für 30- und 60-Jährige gefährlicher als heute war. Der Tod konzentrierte sich also noch nicht wie in der Gegenwart auf das hohe Alter. Seine Rhythmen waren auch noch nicht wie heute von medizinischer Rationalität beeinflusst, von ärztlichen Entscheidungen darüber, welche Operation noch zu wagen ist und ob sich eine bestimmte Behandlung noch lohnt. Sie ergaben sich vielmehr, sobald man den biologischen Gefahren der frühen Kindheit entwachsen war, zu einem guten Teil aus ökonomischem Stress und dessen mehr oder weniger gelingenden sozialen Abfederung über das ganze Jugend- und Erwachsenenalter hinweg. Diese Beobachtung, dass mit dem Aufwachsen ein Übergang von biologischen zu sozioökonomischen Gefahren verbunden ist, gilt allerdings bis heute nicht in allen Kulturen gleichermaßen.