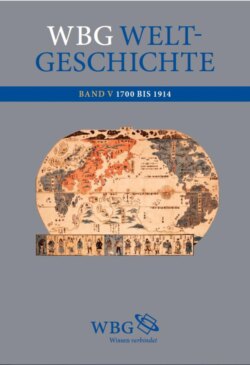Читать книгу wbg Weltgeschichte Bd. V - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die schwerindustrielle Phase der Industrialisierung
ОглавлениеUrsachen für die Ausdehnung
Die zweite Phase der Industrialisierung war von der Schwerindustrie geprägt und nicht mehr auf die britische Hauptinsel beschränkt, sondern konnte jetzt auch auf dem europäischen Kontinent und in Nordamerika Fuß fassen. Diese Ausdehnung der Industrialisierung hatte im Wesentlichen zwei Ursachen. Erstens war die Entwicklung der Schwerindustrie seit den 1830er Jahren aufs engste mit der Transportrevolution verbunden, denn der Aufbau der Verkehrsinfrastruktur entwickelte einen bisher nicht gekannten Bedarf an Eisen und Stahl sowie an Energie (Steinkohle). Gleichzeitig verbilligte er den Transport von Gütern, so dass die lokalen und regionalen Märkte immer enger vernetzt werden konnten. Zweitens war der Vorsprung der Briten bei diesen neuen Führungssektoren der Wirtschaft zunächst zwar weiterhin groß, aber nicht mehr lange uneinholbar wie zuvor bei der Textilindustrie. Auch die institutionellen Voraussetzungen waren in zahlreichen kontinentaleuropäischen Gesellschaften mittlerweile geschaffen worden, um die (zunächst weiterhin kopierte britische) Technik in ähnlichem Maßstab einsetzen zu können wie in der „Werkstatt der Welt“. Am Ende dieser Phase war Großbritannien deshalb zwar noch das bedeutendste Industrieland der Welt, aber viele kontinentaleuropäische Volkswirtschaften hatten sehr stark aufgeholt und industrielle Führungsregionen entwickelt, die den britischen nicht zuletzt auf dem Gebiet der modernsten Industrien der Zeit ernsthaft Konkurrenz machen konnten. Daneben zeichnete sich in den USA bereits ab, dass die Erschließung des Landes zu einer Nutzbarmachung der reichsten Ressourcen führen würde, über die eine Volkswirtschaft zu dieser Zeit verfügen sollte. Auch hier bildete die Transportrevolution insofern die Voraussetzung für den Aufstieg zur führenden Industrienation des 20. Jahrhunderts.
Transportrevolution
Wegen der stark in den Grenzen nationaler Volkswirtschaften denkenden älteren Industrialisierungsforschung wird die Transportrevolution der mittleren Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts bis heute oftmals fast ausschließlich mit der Eisenbahn gleichgesetzt. Tatsächlich bildete die Eisenbahn in einigen Ländern wie Belgien und dem Deutschen Zollverein beziehungsweise in Preußen sowie mit Abstrichen auch in Frankreich und in den sich industrialisierenden westlichen Teilen des Habsburgerreiches den Kern eines schwerindustriellen Führungssektorkomplexes. Aber auch die Schifffahrt wurde durch den Einsatz der Dampfmaschine als Antriebsaggregat und von Stahl als Schiffbaumaterial revolutioniert.
Dampfschiffe
Der Einsatz von Dampfmaschinen auf Schiffen setzte etwa zeitgleich mit der „Eisenbahn-Revolution“ ein. Nachdem bereits kurz nach der Jahrhundertwende in den USA das erste Dampfschiff auf dem Hudson seine Jungfernfahrt erfolgreich bestanden hatte, absolvierte wenig später das erste britische Dampfschiff seine erste Fahrt auf dem Clyde bei Glasgow. Regelmäßig verkehrten Flussdampfer allerdings erst seit den 1820er Jahren. Obwohl Dampfschiffe auf den größeren kontinentaleuropäischen Flüssen kaum später erschienen, fehlten dort noch die infrastrukturellen Voraussetzungen, vor allem ein Netz bildendes Wasserstraßensystem aus schiffbaren Flüssen und Kanälen, um eine mit dem Eisenbahntransport vergleichbare Verbindung verschiedener Wirtschaftsräume zu erreichen. Aber auch in Großbritannien war die Leistungsfähigkeit der Kanäle, die noch für Schiffe gebaut worden waren, die auf traditionellem Wege durch Treideln angetrieben wurden, nicht ausreichend, um die Fähigkeit der Dampfmaschine, wesentlich größere Schiffe zu bewegen, wirklich ausnutzen zu können.
Hochseeschifffahrt
Es war deshalb auch nicht der Binnenwasserstraßenverkehr, der sich komplementär zur Eisenbahn entwickelte, sondern – allerdings etwas zeitversetzt – die Hochseeschifffahrt, die ein ganz ähnliches Wachstum durchlief wie der binnenländische Verkehr mit der Eisenbahn. Nachdem der Schaufelradantrieb seit den 1840er Jahren zunehmend durch den Schraubenantrieb ersetzt worden war und sich seit den 1850er Jahren der Einsatz von Verbundmaschinen durchzusetzen begann, wodurch der Kohlenverbrauch der Schiffe deutlich gesenkt wurde, war es vor allem der Ersatz von Holz durch Stahl im Schiffbau, der für eine „Industrielle Revolution“ auf den Weltmeeren sorgte. Zwischen 1870 und 1913 dürften sich die Tarife deshalb etwa halbiert haben (s. Band VI, S. 285, Grafik 3). Daneben wurden aber auch die Hafenanlagen durch eine Vergrößerung der Hafenbecken sowie durch neuartige Schütt- und Ladetechniken modernisiert, wodurch die Liegezeiten der teuren neuen Schiffe deutlich verkürzt werden konnten.
Gesamttonnage
Hatte die Gesamttonnage der britischen Handelsmarine 1820 noch 2,4 Millionen Tonnen betragen, waren es 1860 schon 4,7 und 1900 9,3 Millionen Tonnen. Bis in die 1860er Jahre war der Anteil der Dampfschiffe noch sehr gering, um 1860 lag er bei knapp 10 Prozent. Bis 1880 stieg der Anteil dann auf knapp 40 Prozent, um bis 1890 die Gesamttonnage der Segelschiffe deutlich zu übertreffen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren durchaus noch neue Segelschiffe in Dienst gestellt worden, so dass sich zwar ihr Anteil an der britischen Handelsmarine, nicht aber das von ihnen bewältigte Frachtaufkommen reduzierte. Erst seit den 1880er Jahren ging dann auch die Gesamttonnage der Segelschiffflotte zurück. Während auf dem Atlantik nun das Dampfschiff dominierte, waren die traditionellen Schoner wohl nur noch bei der Küstenschifffahrt im Einsatz, dort allerdings häufig mit einer unterstützenden Dampfmaschine ausgerüstet.
Großbritannien im Mittelpunkt
Damit stand erneut Großbritannien auch bei der überseeischen Transportrevolution im Mittelpunkt der Entwicklung, was bei der Insellage auch nicht verwunderlich ist. Denn während auf dem europäischen Kontinent die nationalen Eisenbahnsysteme recht zügig miteinander vernetzt wurden und damit nicht nur der interregionale, sondern auch der Handel zwischen benachbarten Staaten deutlich verbilligt wurde, war Großbritannien bei seinem Außenhandel vollständig auf den Schiffsverkehr angewiesen. Diese Abhängigkeit sorgte für den Aufbau einer modernen Schiffbauindustrie, wobei sich die durchschnittlich pro Jahr in Großbritannien gebaute Dampfschifftonnage in der zweiten Jahrhunderthälfte etwa verzehnfachte.
Die britische Wirtschaft war zwar auch schon während der ersten Phase der Industrialisierung existenziell auf den Import von Rohstoffen, insbesondere von Baumwolle, angewiesen gewesen und das rasante Wachstum der Textilproduktion war auch nur dank der Aufnahmefähigkeit überseeischer Märkte möglich, aber die Verbilligung des Überseetransports verstärkte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum einen noch einmal die internationale Konkurrenzfähigkeit und ermöglichte zum zweiten, dass sich in Großbritannien schon frühzeitig ein moderner tertiärer (Dienstleistungs-)Sektor entwickelte. Denn die Schiffe und ihre Ladung mussten versichert und die rasch wachsenden Zahlungsströme zwischen den Volkswirtschaften und damit zwischen unterschiedlichen Währungen – vielfach unterstützt durch Kredit – abgewickelt werden.
Weltwährungssystem
Neben der „Industriellen Revolution“ im Schiffbau war deshalb auch die Entstehung eines funktionsfähigen Weltwährungssystems eine notwendige Bedingung für das Wachstum des Welthandels während des halben Jahrhunderts vor dem Ersten Weltkrieg. Dafür mussten aber erst einmal die Währungen der wichtigsten Industrieländer stabilisiert werden, was wiederum die Sanierung der Staatsfinanzen nach den großen europäischen Kriegen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts voraussetzte. Großbritannien, die Niederlande, Belgien, die Schweiz, Frankreich und Preußen hatten diese Stufe schon relativ schnell erreicht. Viele andere Staaten bemühten sich durch wirtschafts- und finanzpolitische Reformprogramme im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts, ebenfalls ihre Währungen zu stabilisieren. Denn je rückständiger sie waren, desto wichtiger wurde für sie das internationale Vertrauen in die wirtschaftliche und politische Stabilität des Landes, da nur so ausländische Investoren etwa für den Eisenbahnbau gewonnen werden konnten.
Das Weltwährungssystem des späten 19. Jahrhunderts, der internationale Goldstandard, dem sich – von Großbritannien ausgehend – seit den 1870er Jahren immer mehr Länder anschlossen, war im Grunde nicht mehr als die Einführung einer gemeinsamen Recheneinheit, dem Gold. Indem ein Land seine Währung in einer bestimmten Menge Gold definierte, entstand ein System fester Wechselkurse zwischen allen Ländern, die ihre Währungen in dieser Weise reformierten. Handels- und Zahlungsbilanzungleichgewichte sollten in der Theorie durch das Schwanken nationaler Zinsniveaus ausgeglichen werden, was dann bis 1914 auch leidlich funktionierte, weil London im Zentrum dieses Systems als internationale Clearingstelle fungierte, deren freier Geldmarkt in letzter Instanz den ungehinderten Austausch zwischen dem Gold und den verschiedenen Währungen der Goldstandardländer sicherte (s. Band VI, S. 286–288).
Weltwährungen
Bevor die enormen Kosten der Revolutionskriege und der Napoleonischen Kriege die Währungen der beteiligten Staaten aushöhlten, waren die meisten Währungen der Welt reine Silber-(Metall-)Währungen gewesen. Die Experimente mit Papiergeldwährungen waren sämtlich gescheitert und die aus der Not geborenen Papiergeldwährungen der Kriegsjahre, allen voran die französische Assignaten-Inflation, hatten jede nicht Metallbasierte Währung diskreditiert. Nach den Napoleonischen Kriegen war 1819 einzig das britische Pfund als Goldwährung neu geschaffen worden, Frankreich bevorzugte stattdessen einen Doppelstandard aus Gold und Silber. An dieses System schlossen sich seit 1865 mit Belgien, Italien, der Schweiz und Griechenland weitere Staaten an („Lateinische Münzunion“), während die anderen im internationalen Handel eine gewisse Rolle spielenden Staaten, wie die Niederlande und Preußen, zunächst noch an ihren Silberwährungen festhielten. Die entscheidende Wende erfolgte dann Anfang der 1870er Jahre, als das neugegründete Deutsche Reich mit Hilfe der französischen Kriegsentschädigung eine neue Währung schuf und sich mit der Mark dem Goldstandard anschloss. Nahezu gleichzeitig führten auch die Niederlande (1876), Dänemark und Schweden (1873) die Goldwährung ein, indem sie sich auf die Goldkrone als gemeinsame Währungseinheit einheit verständigten. 1875 trat dann auch Norwegen dieser „Skandinavischen Münzunion“ bei. Parallel zu dieser Entwicklung machten zahlreiche weitere Länder den französischen Gold-Franc zur Grundlage ihrer Währung: Spanien 1868, Finnland 1877, Serbien 1878, Venezuela 1879 und Bulgarien 1880.
Silberfrage
Schließlich schlossen sich auch Österreich-Ungarn, das 1867 zunächst einen Vorvertrag mit der Lateinischen Münzunion geschlossen, den Beitritt aber nicht vollzogen hatte, mit der Einführung der Krone (1892) und Russland mit einer Reform der Rubel-Währung (1897) dem Kreis der Goldwährungsländer an. Außerhalb Europas hatten zu diesem Zeitpunkt lediglich die USA seit 1873 eine Goldwährung besessen. Die umlaufenden Währungen der Länder Asiens und Lateinamerikas basierten dagegen überwiegend auf Silber. Das britische Pfund bildete dort allerdings in den meisten Fällen eine Art Parallelwährung für den Außenhandel, und auch der Kapitalimport wurde überwiegend in britischen Pfund abgewickelt und damit dem internationalen Währungssystem untergeordnet. Der Wertverlust des Silbers durch die Demonetarisierung der Silberwährungen Europas führte allerdings zu einer schleichenden Abwertung der Silberwährungen, wodurch zwar die Ausfuhr der Silberländer erleichtert wurde, sich aber die aus der Auslandsverschuldung resultierenden Zins- und Tilgungslasten erhöhten. Deshalb und wegen des vergleichsweise langsamen Geldmengenwachstums der Goldstandardländer war die Frage des Währungsstandards in vielen Ländern ein politisch umkämpftes Terrain. Das gilt besonders für die USA, wo sich die Anhänger einer reinen Goldwährung gegen die Bimetallisten 1896 in einer Präsidentenwahl schließlich durchsetzen konnten, und für Indien, wo 1898 eine Art Gold-Devisen-Standard eingeführt wurde, indem man die Rupie zu einem festen Wechselkurs an das britische Pfund band.
Die Silberfrage war für Großbritannien auch deshalb wichtig, weil der Export in die industriell weniger entwickelten Regionen der Welt gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein immer größeres Gewicht für den britischen Außenhandel bekam. Im Mittelpunkt standen dabei neben den britischen Kolonien und den Dominions insbesondere die Silberwährungsländer des informal empire in Südamerika. Denn wegen ihrer erfolgreich nachholenden Industrialisierung waren die Kanal- oder Nordseeanrainerstaaten in immer größerem Maße in der Lage, ihren Bedarf an Industriewaren selber zu befriedigen. Der Umorientierung des britischen Außenhandels kam es deshalb auch zugute, dass sich die Frachttarife im Seeverkehr auf den langen Strecken, also etwa im Atlantik- oder im Asienhandel, deutlich stärker ermäßigten als auf den kürzeren Strecken.
Wie sehr Großbritannien aber immer noch im Zentrum des internationalen Handels lag, zeigt sich nicht zuletzt an der Rangfolge der wichtigsten im Seeverkehr transportierten Güter, unter denen seit den 1870er Jahren Baumwolle, Getreide und Steinkohle die ersten Plätze belegten. Baumwolle war bereits in den Jahrzehnten zuvor ein wichtiges Transportgut im Atlantikhandel gewesen, wobei Liverpool nicht nur als Importhafen, sondern auch als Transithafen weiterhin eine zentrale Rolle zukam.
Getreide
Bei Getreide handelte es sich zwar nicht um einen industriellen Rohstoff und erst recht nicht um ein industriell hergestelltes Gut, aber seine Bedeutung für die Industrialisierung kann gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Als sich Großbritannien seit den 1840er Jahren zum wichtigsten Getreideimporteur der Welt entwickelte, wurde das Getreide zunächst vor allem aus dem Ostseeraum, insbesondere aus dem preußischen Ostelbien bezogen. Dank der billigen Getreideimporte konnte nicht nur der Brotpreis im Inland gesenkt werden, wodurch sich wegen der großen Bedeutung von Grundnahrungsmitteln in der Ausgabenstruktur von Unterschichtshaushalten die Kosten der (industriellen) Arbeitskraft deutlich verringern ließen, sondern durch die Exporterlöse waren Preußen und andere Getreideexportländer auch in der Lage, britische Fertigwaren zu importieren, was ebenfalls der britischen Industrie zugute kam.
Mit der Transportrevolution auf dem Atlantik kam das britische Importgetreide seit den 1870er Jahren in rasch zunehmendem Umfang aus den USA, die wiederum zum Aufbau ihrer kontinentalen Verkehrsinfrastruktur essentiell auf Exporterlöse angewiesen waren (s. Band VI, S. 290ff.). Denn das Kapital für den Bau der amerikanischen Eisenbahnen kam überwiegend aus Europa, wodurch sich die USA zum weltweit größten Schuldnerland entwickelten. Die Erlöse aus dem Export von Baumwolle und Getreide spielten in dieser kritischen Phase des Übergangs der USA zu einem Industrieland eine zentrale Rolle, um den Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern auch zuverlässig nachkommen zu können.
Steinkohle
Steinkohle war das einzige industriell hergestellte, quantitativ für die Seeschifffahrt bedeutende Massengut, das über die Weltmeere verschickt wurde. Deshalb war Großbritannien auch nicht Importeur dieses Gutes, sondern Exporteur. Abgesehen von den Exporten in die La-Plata-Region und nach Indien war die Richtung der Steinkohlenausfuhr jedoch weniger außereuropäisch ausgerichtet, sondern die wichtigsten Abnehmerländer waren die Kanal- und Nordseeanrainerstaaten (einschließlich Nordfrankreich und Norddeutschland) sowie die Mittelmeerländer, vor allem Italien. Während Letztere kaum über eigene Kohlevorkommen verfügten und dementsprechend für ihre nachholende Industrialisierung auf den Import dieses Energieträgers angewiesen waren, mussten sich die britischen Steinkohlenexporte an den gegenüberliegenden Küsten gegen die belgische, die französische und vor allem gegen die Ruhrkohle durchsetzen.
Mittellage der Niederlande
Insbesondere die Niederlande profitierten von ihrer Mittellage zwischen dem nordostenglischen Revier um Newcastle und dem Ruhrgebiet. Denn wegen dieser Konkurrenzsituation dürfte kaum ein anderes Land so preisgünstig an diesen für eine nachholende Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts strategisch so bedeutenden Energieträger gekommen sein wie sie. Da war es nur logisch, dass die Erschließung des im äußersten Süden des Landes gelegenen Limburger Reviers erst erfolgte, als die Niederländer während des Ersten Weltkriegs die Erfahrung machen mussten, dass ihre Neutralität sie nicht vor einem Versiegen dieses Zuflusses an billiger Energie schützen konnte.
Steinkohlevorkommen in Europa um 1875.
Wenn im Folgenden von dem Aufstieg der Eisen- und Stahlindustrie sowie des Steinkohlenbergbaus zu industriellen Führungssektoren die Rede ist, heißt das nicht, dass nicht auch schon während der leichtindustriellen Phase Steinkohle industriell abgebaut und Eisen sowie Stahl auf industriellem Wege hergestellt worden wären. Aber ihre Funktion als „Lokomotive“ der industriellen Entwicklung konnten sie erst in Verbindung mit der Eisenbahn entfalten.
Steinkohlenbergbau
Am Anfang dieser Entwicklung standen deswegen auch keine spektakulären Erfindungen. Im Gegenteil, wichtige Technologiesprünge erlebte die Eisen- und Stahlindustrie schon im 18. Jahrhundert, und der Kohlenabbau war noch längst nicht so weit mechanisiert, wie man sich das für einen „industrialisierten“ Bergbau vielleicht vorstellt. Das Hauptproblem des Steinkohlenbergbaus war im 18. Jahrhundert die Wasserhaltung gewesen, weil die über dem Grundwasserspiegel liegenden Flöze schnell abgebaut waren. Obwohl die erste moderne, von Thomas Newcomen konstruierte Dampfpumpe 1712 in einem Kohlebergwerk in Staffordshire installiert wurde, entwickelte sich der Nordosten Englands mit Newcastle upon Tyne zum Zentrum der industrialisierten Steinkohleförderung. Obwohl Newcomen-Dampfmaschinen zur Wasserhaltung in englischen Bergwerken bereits im frühen 18. Jahrhundert zum Einsatz kamen, sollte es noch über 100 Jahre dauern, bis es zu einer „Industrialisierung“ des Abbaus von Steinkohle kam. Erst der Einsatz von Sprengstoff, seit den 1870er Jahren in erster Linie Dynamit, ersetzte Schlegel, Hacke und Schaufel des Bergmanns „vor der Kohle“.
Eisengewinnung
Eisen wurde in zwei verschiedenen Arbeitsprozessen gewonnen: der Roheisenverhüttung und der Verarbeitung zu Schmiedeeisen (bzw. Stahl). Für die Herstellung von Roheisen aus Erz hatte Abraham Darby schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein Hochofenverfahren entwickelt, das es ermöglichte, statt der knappen Holzkohle als Brennstoff Koks zu verwenden. Es setzte sich aber erst ab 1750 durch, als es durch weitere technische Verbesserungen und dank einer Kostensenkung der Koksproduktion billiger wurde als das alte Verfahren. Auf der nächsten Produktionsstufe wurde das Roheisen in Frischfeuern und unter Hämmern zu brauchbarem Schmiedeeisen verarbeitet. Für diesen Herstellungsprozess entwickelte Henry Cort in den 1780er Jahren das sogenannte „Puddelverfahren“ mit Steinkohlenfeuerung. Damit hatte sich in der Eisenindustrie auf beiden Produktionsstufen die Steinkohle als alleiniger Brennstoff durchgesetzt.
Während sich in Großbritannien die Verwendung von Steinkohle und Koks für die Eisen- und Stahlerzeugung vergleichsweise schnell durchsetzte und dort bereits zur Jahrhundertwende das Eisenerz überwiegend in Kokshochöfen verhüttet wurde, dauerte die Durchsetzung des Kokshochofens und des Puddelns auf dem Kontinent wesentlich länger. Nach ersten mäßig erfolgreichen Versuchen, unter anderem im französischen Le Creuzot um 1785 und im oberschlesischen Gleiwitz 1796, wurde der erste dauerhaft leistungsfähige Kokshochofen auf dem Kontinent erst 1824 in Seraing (südliche Niederlande, seit 1830 Belgien) durch John und Charles James Cockerill angeblasen – zwei Söhnen des aus Lancashire stammenden belgischen Industrialisierungspioniers William Cockerill, der sich kurz vor der Jahrhundertwende im benachbarten Vervier niedergelassen hatte.
Einführung von Kokshochöfen in Kontinentaleuropa
Die frühen Versuche zur Einführung von Kokshochöfen in Kontinentaleuropa waren nicht in erster Linie deswegen so wenig erfolgreich, weil die Techniker auf dem Kontinent unfähig gewesen wären, die noch vergleichsweise wenig komplexe Technik zu kopieren. Vielmehr war die chemische Zusammensetzung des Eisenerzes aus den verschiedenen Abbauregionen häufig so unterschiedlich, dass ein technisches Verfahren, das sich in dem einen Fall bewährt hatte, in einem anderen Fall scheiterte. Der Technologietransfer erfolgte deshalb selten und in der Metallverarbeitung so gut wie nie problemlos. Es mussten Anpassungsleistungen erbracht werden, die selbst innerhalb Großbritanniens nicht immer gelangen und erst recht nicht, wenn eine Anlage im Ausland installiert wurde. Zweitens waren in Frankreich und Deutschland wegen ihrer im Vergleich zu Großbritannien weiterhin reichlich vorhandenen Holzvorkommen die Voraussetzungen für eine Umstellung der Holzkohlenverhüttung durch Koks bei weitem nicht so günstig. Die Verfügbarkeit von Kohle war insbesondere in Frankreich viel schlechter und außerdem waren die meisten französischen Kohlevorkommen für das Verkoken nicht geeignet. Da Holz in Frankreich demzufolge billiger und Kokskohlen sehr viel teurer waren als in England, verwundert es nicht, wenn die Anlagen vor allem ökonomisch scheiterten. Der Kokshochofen setzte sich entsprechend auch nach der Lösung der technischen Probleme in Frankreich und (West-)Deutschland viel langsamer durch als in England. An der Saar wurde der erste Kokshochofen erst 1844 errichtet und im Ruhrgebiet sogar erst 1848. Ähnlich war die Situation beim Puddelverfahren, das in den südlichen Niederlanden/Belgien (Seraing) erstmals 1820, in Frankreich (Charenton bei Paris) erstmals 1822 und in Deutschland (Neuwied) erstmals 1824 zur Anwendung kam.
Belgien als Kohlelieferant
Im Steinkohlenbergbau war der Abstand Kontinentaleuropas nicht ganz so groß wie bei der Eisengewinnung und -verarbeitung. Das älteste moderne Revier auf dem Kontinent, das Borinage im äußersten Westen des späteren Belgien, stand den englischen Revieren technisch kaum nach. So wurde dort bereits 1737 die erste englische Newcomen-Dampfpumpe installiert. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde auch in den anderen belgischen Revieren dank verbesserter Abbauverfahren die Fördergrenze in immer größere Tiefen vorangetrieben. Von 1838 bis 1866 stieg der Durchschnittswert für ganz Belgien von 210 auf 437 Meter, der Maximalwert erhöhte sich von 437 auf 1065 Meter Tiefe in einer Grube bei Mons. Die Voraussetzungen dieser rasanten Entwicklung waren technische Fortschritte auf breiter Front: die Verwendung dampfgetriebener Pumpen, Förderseile aus Draht statt Hanf, Schienen für Förderkörbe, Sicherheitslampen, Ventilatoren und vieles andere mehr. 1846 betrug die Kohleförderung in Belgien 5 Millionen Tonnen, das waren 450 Kilogramm pro Kopf der Bevölkerung. Vergleicht man diese Menge mit den 600 Kilogramm in Großbritannien auf der einen Seite und den 230 Kilogramm in Preußen sowie den gar nur 40 Kilogramm in Frankreich auf der anderen Seite, erkennt man Belgiens neue Bedeutung als Kohlelieferant Europas.
Eisenbahnzeitalter
Am Vorabend des Eisenbahnzeitalters waren demzufolge nur Großbritannien und Belgien für die wachsende Nachfrage nach Stahl und Kohle seitens dieses neuen Führungssektors gerüstet. Entsprechend gehörten beide Länder zu den Pionieren dieses komplexen Transportsystems. Das Eisenbahnzeitalter begann in Großbritannien mit der Eröffnung der Stockton-Darlington-Eisenbahn im Jahr 1825, die allerdings zu einem Gutteil noch eine Kohlebahn war und außerdem auch gelegentlich noch als Pferdebahn betrieben wurde. Die erste Eisenbahnstrecke im modernen Sinne war die Verbindung von Manchester nach Liverpool, die 1830 eröffnet wurde.
Die Liverpool-Manchester Railway Company war eine Aktiengesellschaft, die allerdings zum Bau ihrer Eisenbahnstrecke die Genehmigung durch ein Parlamentsgesetz benötigte. Das Kapital für den Bau der Strecke musste über den Kapitalmarkt aufgebracht werden. Solange die Eisenbahngesellschaften hohe Dividenden ausschüteten, war es in Anbetracht des Reichtums im Land nicht allzu schwer, Anleger für dieses und alle weiteren Eisenbahnprojekte zu interessieren. Außerdem waren die Kapitalbesitzer im Land durch den privatwirtschaftlichen Kanalbau an derartige Investitionsprojekte bereits gewöhnt und konnten das Risiko einigermaßen abschätzen – jedenfalls glaubten sie das zu können.
Railway Mania
Bereits Ende der 1830er Jahre löste der wirtschaftliche Erfolg der ersten Eisenbahnen ein „Eisenbahnfieber“ (Railway Mania) aus, als zahlreiche neue Gesellschaften gegründet und konzessioniert wurden, deren Kapital wegen völlig unrealistisch hoher Renditeerwartungen von den Investoren auch noch mehrfach überzeichnet wurde. Die Aktienkurse stiegen zunächst rapide. Als sich jedoch zeigte, dass die Erwartungen nicht zu erfüllen waren, brach der Markt zusammen. Daraufhin wurden die Investoren sehr vorsichtig, so dass auch solide Neugründungen Schwierigkeiten bekamen, das Kapital für den Bau der Strecken zu beschaffen. In den 40er Jahren wiederholte sich dann dieser Zyklus von übertriebener Erwartung (seit 1844) und Zusammenbruch (Frühjahr 1847). Trotz des vorübergehenden Stillstands war das Bautempo enorm: 1851 waren knapp 11.000 Kilometer Eisenbahn in Betrieb – gegenüber etwa 3500 Kilometer nach der ersten Mania zehn Jahre zuvor. Am Ende der 70er Jahre waren es dann knapp 25.000 Kilometer.
Verkehrsaufkommen und Tarife
Mit dem Wachstum der Streckenlänge war auch ein Wachstum des bewältigten Verkehrsaufkommens verbunden. Allein zwischen 1856 und 1873 verdreifachte sich der Güterverkehr auf den britischen Eisenbahnen, und der Personenverkehr erreichte sogar fast das Vierfache. Begleitet wurde dieses Output-Wachstum von einer deutlichen Senkung der Tarife. Um 1870 waren die Personentarife um etwa 40 Prozent und die Frachttarife um etwa 30 Prozent gegenüber der Frühzeit der Eisenbahnentwicklung gefallen. Damit lagen sie deutlich unter den Tarifen der konkurrierenden Verkehrsträger (Post-)Kutsche im Personenüberlandverkehr und Binnenschifffahrt im Frachtverkehr.
Auswirkungen auf die übrige Wirtschaft
Die Auswirkungen der Eisenbahnen auf die übrige Wirtschaft, die Kopplungseffekte, waren beträchtlich. Das gilt sowohl für die Nachfrage der Eisenbahnen nach Stahl und Kohle als auch für die Angebotsfunktion durch die Verbilligung der Transportkosten und die dadurch ermöglichte Markterweiterung für die Frachtgüter. Insbesondere die Bedeutung der Eisenbahnnachfrage nach Stahl und Kohle ist in der Vergangenheit allerdings häufig überschätzt worden und kann nicht mit ihrer Wirkung in manchen kontinentaleuropäischen Volkswirtschaften gleichgesetzt werden. Denn sowohl die Eisen- und Stahlindustrie als auch der Steinkohlenbergbau waren bereits recht weit fortgeschritten, als die Eisenbahnen mit ihrem Schienenbedarf etc. als Nachfrager am Markt erschienen. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass die Eisenbahnnachfrage ein wichtiger Impuls für den Übergang zur Massenproduktion von Stahl durch das Bessemerverfahren gewesen ist, der vermutlich wichtigsten Innovation in der Stahlindustrie während der schwerindustriellen Phase der Industrialisierung.
Bessemerverfahren
Das durch den Stahlindustriellen Henry Bessemer in Sheffield Mitte der 1850er Jahre entwickelte Verfahren stellte im Vergleich zu dem arbeitsaufwendigen Puddelverfahren eine stärker mechanisierte Methode der Stahlherstellung dar. Sie ermöglichte es, in 20 Minuten die gleiche Menge Stahl herzustellen, für die man bisher beim Puddeln 24 Stunden benötigt hatte. Das Prinzip des Bessemerverfahrens bestand darin, flüssiges Roheisen in einem großen, mit dem entsprechenden Futter ausgekleideten Gefäß („Konverter“) durch das Einblasen von Luft zu frischen. Ein wesentlicher Vorteil dieses Verfahrens war es, das gefrischte Eisen in beliebig große Formen gießen zu können und nicht als verfestigtes Eisen weiter verarbeiten zu müssen. Dadurch wurde insbesondere die Schienenproduktion wesentlich vereinfacht und damit verbilligt. Der Nachteil des Bessemerverfahrens bestand allerdings darin, dass die Auskleidung des Konverters die Verwendung phosphorhaltiger Erze unmöglich machte, wodurch die Verwendbarkeit von Roheisen aus bestimmten Regionen äußerst eingeschränkt war. Dieses Problem wurde erst etwa 20 Jahre später durch das ebenfalls in Großbritannien entwickelte Thomasverfahren gelöst, das nun auch die Verwendung phosphorhaltiger Erze ermöglichte.
Vorbildfunktion der Eisenbahngesellschaften
Nicht quantifizierbar ist die Bedeutung der Vorbildfunktion der Eisenbahngesellschaften für die Organisation von Großunternehmen sowie für die Entwicklung neuer Formen der Industriefinanzierung durch den Kapitalmarkt. Die Integrationsleistung, die Bedeutung der Eisenbahnen für die Entstehung eines nationalen Binnenmarktes, kann durch ein deutliches Abschleifen der Preisunterschiede auf regionalen Teilmärkten belegt werden. Auf diese Weise wurden die Herausbildung regionaler Spezialisierungen und das Ausnutzen komparativer Kostenvorteile gefördert. Es muss allerdings einschränkend betont werden, dass die Kanäle auch in dieser Hinsicht schon eine erhebliche Vorleistung erbracht hatten. Das gilt zum einen für die Marktintegration als auch für die Anpassung der Kapitalmärkte an die Bedürfnisse kapitalintensiver Industrien und Infrastrukturprojekte.
Fehlen jeglicher Netzplanungen
Um 1870 verfügte Großbritannien über das dichteste Eisenbahnnetz der Welt. Eine solche Geschwindigkeit beim Bau von Eisenbahnen war wohl nur unter privatwirtschaftlichen Bedingungen denkbar, aber der Nachteil dieses kaum regulierten Wucherns war das Fehlen jeglicher Netzplanungen. Alle größeren Eisenbahngesellschaften waren darauf bedacht, sich einen möglichst großen Teil des Landes als Gebietsmonopol zu sichern. Genau das wollten aber die Nutzer der Eisenbahn verhindern, wodurch der Bau von Konkurrenzstrecken, von mehreren Bahnhöfen in derselben Stadt usw. ermutigt wurde. Außerdem fehlte es an jeglicher Standardisierung des Materials. Noch nicht einmal die Spurweite war während der ersten Jahrzehnte des Eisenbahnzeitalters einheitlich.
Ungleichmäßige Erschließung des Landes
Wegen der fehlenden übergeordneten Netzplanung erfolgte die Erschließung des Landes auch sehr ungleichmäßig. Während die Industrieregionen mit einem dichten Netz von Eisenbahnen überzogen wurden, waren die stärker landwirtschaftlich geprägten Regionen des Landes in der Regel nur dann an das Eisenbahnnetz angeschlossen, wenn zufällig eine Fernverbindung zwischen zwei Ballungsregionen durch das Land führte. Periphere landwirtschaftlich geprägte Regionen wie East Anglia waren deshalb noch Jahrzehnte nach Beginn des Eisenbahnzeitalters weitgehend vom „neuzeitlichen Verkehr“ abgeschnitten. Denn die Erschließung von dünn besiedelten Gebieten mit einem niedrigen Frachtund Personenverkehrsaufkommen war für Rendite-orientierte Eisenbahngesellschaften unattraktiv. Insofern folgte der Eisenbahnbau in Großbritannien – etwas vereinfacht gesprochen – den bestehenden Handelsströmen, so dass das britische Eisenbahnnetz gegen Ende des 19. Jahrhunderts ziemlich genau die Wirtschaftsgeographie des Landes abbildete. Im Ergebnis verstärkte die Eisenbahn damit das interregionale Wohlstandsgefälle des Landes noch. Aber das zu ändern, wurde von der Regierung ausdrücklich nicht als ihre Aufgabe angesehen.
Eisenbahnzeitalter in Belgien
Nur mit einer geringen zeitlichen Differenz, nicht ganz so schnell, aber deutlich besser geplant als in Großbritannien, begann das Eisenbahnzeitalter in Belgien. Die Initiative zum Bau der ersten Eisenbahnen ging hier von der Regierung aus, die in den 1830er Jahren nach einem Ausweg aus der Krise suchte, die durch Belgiens Trennung von den Niederlanden ausgelöst worden war. Belgien besaß zwar zum Zeitpunkt seiner Gründung Wasserstraßen mit einer Gesamtlänge von etwa 1600 Kilometer, davon 450 Kilometer Kanäle, aber die Regierung war weitsichtig genug, sich nicht allein auf dieses Verkehrsnetz zu verlassen. Denn die Kanäle waren weniger zur Erschließung des Landes, sondern eher zur Anbindung der belgischen Reviere nach Frankreich (während der französischen Besatzung) beziehungsweise nach den nördlichen Niederlanden (seit der Annexion der südlichen Niederlande 1815) gebaut worden. Nach der Unabhängigkeit kam es vor allem auf die Verbindung der verschiedenen Wirtschaftsregionen untereinander an, zumal die Niederlande seit der Abspaltung Belgiens einen Wirtschaftskrieg gegen das Land anzettelten und auch Frankreich sein Zollgebiet gegen belgische Einfuhren schützte. Folgerichtig begann der belgische Staat schon 1834 mit dem Bau der ersten Eisenbahnstrecken. Denn das neue Verkehrsmittel hatte sich noch nicht bewähren können, so dass private Investoren in Anbetracht der enormen, bis zur Fahrt des ersten Zuges zu investierenden Summen noch Zurückhaltung übten. Der Aufbau eines nationalen Eisenbahnnetzes war deshalb nur als Staatsbahn realistisch.
Zuerst ging es um die Verbindung zwischen Antwerpen und Aachen, die auf preußischer Seite durch eine Verlängerung nach Köln an den Rhein führen sollte, um auf diesem Wege einen großen Teil des deutschen Rheinhandels anstatt über die Niederlande durch den „eisernen Rhein“ nach Antwerpen umzulenken. Diese West-Ost-Strecke kreuzte sich in Mecheln mit einer Nord-Süd-Strecke, die Verbindungen nach Frankreich und in die Niederlande herstellte. Der Erfolg der ersten Linien führte dazu, dass der weitere Ausbau des Eisenbahnnetzes größtenteils von Privatgesellschaften übernommen wurde. Seit Beginn dieser Entwicklung hatte das kleine Belgien das nach England dichteste Eisenbahnnetz der Welt, und um 1880 wurde der Pionier des Eisenbahnbaus in dieser Hinsicht sogar übertroffen. Dank ihrer Pionierleistungen bei der Produktion von Lokomotiven, Schienen und anderem Eisenbahnmaterial konnte die belgische Industrie bald auch andere Länder beliefern und dadurch die Grundlagen seiner für den Inlandsbedarf deutlich überdimensionierten Schwerindustrie festigen.
Industriefinanzierungsbanken
Von fast noch größerer Bedeutung für die europäische Industrialisierung war jedoch eine institutionelle Innovation, die als wichtiger Vorläufer für die (kontinental-) europäische Universalbank angesehen werden kann. Als das damals industriell weit fortgeschrittene Gebiet 1815 der holländischen Krone zugesprochen und so einem Staat angeschlossen wurde, der zwar wenig Industrie besaß, aber mit Amsterdam über einen führenden europäischen Finanzplatz verfügte, interessierten sich die Amsterdamer Banken wenig für die Industrie in den neu gewonnenen südlichen Landesteilen. Da ihr traditionelles Geschäft mit der Handels- und Staatsfinanzierung weiterhin gut lief, hatten sie auch nur wenig Veranlassung, sich auf das neue und bislang unbekannte Terrain der Eisenbahn- und Industriefinanzierung zu begeben, das als riskant eingeschätzt wurde. Allerdings war in Brüssel im Jahr 1822 die Société générale pour favoriser l’industrie nationale gegründet worden, die vom niederländischen König gefördert wurde, der sich um die Loyalität seiner Untertanen im neuen Landesteil bemühte. Nach der Gründung des belgischen Staates wandte sich die Société Générale der Finanzierung der belgischen Industrie zu, wie es der Name des Instituts eigentlich von Anfang an nahegelegt hatte. Die Société Générale wurde somit die erste (Aktien-)Bank der Welt, die als Investitionsbank bezeichnet werden kann. Im Jahr 1835 kam mit der Banque de Belgique eine zweite Industriefinanzierungsbank hinzu. Diese beiden Banken unterstützten in den folgenden Jahren insbesondere die sich schnell ausbreitenden Gründungen von Aktiengesellschaften in der Schwerindustrie.
Der von dem raschen Aufbau der Montanindustrie und dem Eisenbahnbau ausgelöste Gründerboom hatte jedoch einen Kapitalbedarf zur Folge, der trotz eines beträchtlichen französischen Kapitalimports die Möglichkeiten der beiden Banken überstieg. In zwei schwere Krisen musste schließlich der Staat eingreifen, um in den 1840er Jahren den Zusammenbruch zu verhindern. Zu dieser Zeit war die enge Verknüpfung von Banken und Industrie in Belgien aber bereits dauerhaft vollzogen.
Eisenbahnbau in Frankreich
Auch in Frankreich hatte die Regierung ein landesweites Eisenbahnnetz geplant. Anders als in Belgien bot sie jedoch Privatfirmen Konzessionen für die projektierten Strecken an. Wegen des enormen Kapitalbedarfs schalteten sich recht bald die großen Pariser Banken in den Eisenbahnbau ein. Darüber hinaus kam Kapital für den Bau jedenfalls der rentablen Strecken auch von britischen, belgischen und schweizerischen Banken. Die Krise von 1847/1848 beendete jedoch den Boom und die weniger rentablen Strecken mussten nun von der Regierung in eigener Regie gebaut werden. In der zweiten großen Phase des Eisenbahnbaus, während des Zweiten Kaiserreichs unter Napoleon III., war die Situation eine völlig andere. Daran hatten die Vorstellungen des Saint-Simonismus einigen Anteil, insbesondere der Grundsatz, dass der teure Ausbau der Infrastruktur und der Aufbau großer Industrieunternehmen zentral geplant und mit Aktienkapital finanziert werden sollten. Einige Anhänger dieser Ideen hatten unter Napoleon III. einflussreiche Stellungen inne und gewannen den Kaiser für ihre Ansichten. Sie und ihre Banken konnten deshalb bei öffentlichen Aufträgen mit weitgehender Unterstützung seitens der Regierung rechnen.
Neuer Bankentypus
So entstand ein neuer Bankentypus, für den der 1852 von den Brüdern Pereire gegründete Crédit Mobilier den Prototyp bildete. Sein Geschäftsprinzip war es, Einlagen breiter Bevölkerungsschichten anzusammeln und dieses Kapital vor allem in den großen Unternehmen des Eisenbahnbaus anzulegen. Auf diese Weise wurden Ersparnisse für die Wirtschaft mobilisiert, die ansonsten brachgelegen hätten. Eine Zeitlang war der Crédit Mobilier äußerst erfolgreich. In Spanien, Italien, Österreich, den deutschen Staaten und sogar in England wurden Banken nach seinem Vorbild gegründet, die ebenfalls primär in den Eisenbahnbau, außerdem in die Schwerindustrie und in andere kapitalintensive Projekte investierten.
Auswirkungen des Crédit Mobilier
Der anfängliche Erfolg des Crédit Mobilier veranlasste schließlich auch in Frankreich manche etablierten Pariser Banken, dieses Konzept zu übernehmen und ihr Engagement in der Eisenbahnfinanzierung aus den Jahren vor 1848 wieder aufzunehmen. Die französischen Banken waren deshalb Mitte der 1850er Jahre bereit und in der Lage, nicht nur den jetzt stürmisch voranschreitenden Ausbau des französischen Eisenbahnnetzes zu finanzieren, sondern beträchtliche Summen auch im Ausland, vor allem für den Eisenbahnbau, anzulegen. Der Konkurrenzkampf zwischen den zwei größten Finanzgruppen, den Rothschilds und dem Crédit Mobilier, um Konzessionen in Frankreich setzte sich im Ausland verstärkt fort und trug dazu bei, dass in den Ländern Süd-, Mittel- und Osteuropas längere Eisenbahnstrecken viel früher gebaut werden konnten, als das mit eigenem Kapital dieser Länder möglich gewesen wäre. Diese Entwicklung verstärkte die internationale Verflechtung der nationalen Volkswirtschaften und trug zum Zusammenwachsen Europas zu einem Wirtschaftsraum bei.
Zwei Montanreviere von überregionaler Bedeutung
Ein wesentlicher Grund für das vergleichsweise langsame Wachstum der französischen Wirtschaft im 19. Jahrhundert war die im Vergleich zu England, Belgien und auch Deutschland schlechte Ausstattung mit Bodenschätzen, insbesondere mit Steinkohle. Deshalb entwickelten sich dort auch nur zwei Montanreviere von überregionaler Bedeutung. Zum einen zogen sich die Steinkohlevorkommen des belgischen Reviers bis in das französische Département Nord. Dort entstand 1757 die Compagnie des mines d’Anzin, eines der lange Zeit größten und technisch fortgeschrittensten Unternehmen Frankreichs. Nach der Eingliederung des belgischen Teils des Reviers in die Niederlande wurden im Frankreich verbliebenen äußersten Westen des Kohlenbandes auch Eisenhütten gegründet. Wie auf der anderen Seite der Grenze waren auch hier nicht wenige englische Fachleute beteiligt. Der Abbau tiefer gelegener Kohle begann 1851 bei Courrières. Nun wurde der Norden auf Grund seines Kohlereichtums zum wichtigsten Montanindustriegebiet Frankreichs; vor dem Ersten Weltkrieg wurden dort zwei Drittel der französischen Kohle gefördert.
Eisenindustrie in Lothringen
Die Ursprünge der französischen Eisenindustrie lagen aber nicht im Norden, sondern in Lothringen mit seinen Eisenerzgruben. Bereits in den 1820er Jahren hatte man dort Kokshochöfen aufgestellt. Die Nachfrage war allerdings noch zu gering, um die Holzkohle als Energieträger bei der Eisenproduktion ernsthaft zu gefährden. Erst mit dem Eisenbahnbau änderte sich die Situation, so dass zu Beginn der 1850er Jahre mehr als die Hälfte des französischen Eisens durch Kokshochöfen produziert wurde. Als in dieser Zeit dann die Kohlevorkommen im Norden erschlossen wurden, verlagerte die Eisen- und Stahlindustrie ihren Schwerpunkt von den Eisenerzgruben zu den Steinkohlezechen. Trotzdem blieb Lothringen weiterhin eine Eisen und Stahl produzierende Region. Die Einführung des Bessemerverfahrens in anderen Revieren stellte seit den 1860er Jahren allerdings eine schwere Beeinträchtigung der Konkurrenzfähigkeit der lothringischen Eisenindustrie dar. Denn die lothringischen „Minette-Erze“ waren stark phosphorhaltig und deshalb für die Bessemerkonverter nicht geeignet. Die wenig später erfolgte Annexion Lothringens mit einem Großteil der Erzgruben des Reviers durch das Deutsche Reich schwächte die Stellung des bei Frankreich verbliebenen Teils des Reviers weiter.
Eisenbahnbau im Zollverein
In den Staaten des Deutschen Zollvereins standen die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen des Eisenbahnbaus denjenigen in Belgien nicht nach. Der Aufbau eines Netzes erfolgte auch hier vergleichsweise schnell, aber es gab weder eine zentralstaatliche Netzplanung wie in Belgien und Frankreich, noch trieb die privatwirtschaftliche Konkurrenz – abgesehen von einem kurzen Zeitraum in den 1860er Jahren – den Ausbau des Netzes wie in England voran. Der Eisenbahnbau war im Zollverein Sache der Einzelstaaten, und deren Konkurrenz untereinander war für den schnellen Zuwachs an Eisenbahnstrecken verantwortlich. Im Ergebnis war auch im Zollverein die Erschließung der einzelnen Landesteile recht unausgewogen, aber der Streckenausbau folgte nicht wie beim privatwirtschaftlich betriebenen Eisenbahnbau grundsätzlich den bestehenden Handelsströmen, sondern jeder Einzelstaat war bemüht, sein Territorium, seine Hauptstadt oder im Extremfall sogar die Residenz des Landesherrn vorrangig mit einem Eisenbahnanschluss zu versehen. So existierten beispielsweise drei parallele Süd-Nord-Verbindungen in Süddeutschland (jeweils eine in Baden, Württemberg und Bayern), bevor die erste süddeutsche Ost-West-Verbindung in Angriff genommen wurde.
Für die meisten Eisenbahnprojekte der kleineren deutschen Staaten interessierten sich zu wenige Investoren, so dass dort in der Regel Staatsbahnen gebaut wurden. Lediglich in Preußen wurde der Eisenbahnbau bis 1848 ausschließlich privatwirtschaftlich betrieben. Eine staatliche Förderung gab es zunächst kaum. Erst zu Beginn der 40er Jahre erkannte auch der preußische Staat die Bedeutung der Eisenbahn und unterstützte einige ausgewählte Eisenbahngesellschaften mit Zinsgarantien. Seit 1848 erfolgte der weitere Aufbau des Eisenbahnnetzes dann durch ein „gemischtes System“ von Staats- und Privatbahnen, bis seit dem Ende der 1870er Jahre sukzessive alle Privatbahnen verstaatlicht und einer behördlichen Betriebsführung unterstellt wurden. Die weitere, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgende weitere Verdichtung des Netzes diente dann wesentlich der Erschließung der durch die Privatbahnen vernachlässigten Regionen.
Lokomotiven
Der Aufbau des Streckennetzes wurde auch in Deutschland von einer deutlichen Senkung der Frachttarife begleitet, wodurch das Frachtaufkommen deutlich gesteigert werden konnte. Neben der Markterweiterung waren die aus der realen Investitionsnachfrage resultierenden Impulse ebenso bedeutsam für den gesamtwirtschaftlichen Ausbreitungseffekt der Eisenbahnen. Von der Nachfrage des expandierenden Eisenbahnsektors profitierten in erster Linie die Eisen- und Stahlindustrie (Schienen), der Maschinenbau (Lokomotiven) und der Steinkohlenbergbau (Kohle als Antriebsenergie). Lokomotiven mussten wie in fast allen kontinentaleuropäischen Ländern zunächst überwiegend aus Großbritannien, teilweise auch aus Belgien, bezogen werden. Aber sehr schnell gelang es deutschen Unternehmern diese Importe durch eigene Produkte zu substituieren: bei Schienen etwa seit den späten 1850er Jahren und bei Lokomotiven sogar schon seit den späten 1840er Jahren. Insbesondere der Lokomotivbau wurde von den verschiedenen deutschen Staaten massiv gefördert, denn jede Staatsbahn wollte möglichst nur Lokomotiven einsetzen, die im Land selbst gefertigt worden waren. So entstanden über das Gebiet des Zollvereins verteilt zahlreiche Lokomotivfabriken, die zugleich die bis heute andauernde Spitzenstellung des deutschen Maschinenbaus auf dem Weltmarkt begründeten.
Das Ruhrgebiet
Als Zentrum der deutschen Schwerindustrie bildete sich nach 1850 das Ruhrgebiet heraus, das bis zur Jahrhundertwende zum größten montanindustriell geprägten Ballungsraum Europas aufstieg. Das Ruhrgebiet entwickelte sich im Vergleich zu den englischen, belgischen und sogar zu den anderen deutschen Revieren in Oberschlesien und an der Saar zwar vergleichsweise spät, aber wegen seiner verkehrsgünstigen Lage an Ruhr und Rhein und wegen des hohen Anteils an verkokbarer Kohle etablierte sich neben dem Steinkohlenbergbau auch eine der modernsten Stahlindustrien der Welt. In diesen beiden wichtigen Sektoren der Wirtschaft hatte das Deutsche Reich um 1900 den britischen Pionier sowohl quantitativ als auch qualitativ fast eingeholt und die belgische Schwerindustrie deutlich hinter sich gelassen.
Leistungsfähiges Bankensystem
Dieser außerordentlich zügige Aufbau moderner, aber gleichzeitig vergleichsweise kapitalintensiver Industrien war nur dank des parallelen Aufbaus eines leistungsfähigen Bankensystems möglich. In den deutschen Staaten herrschte während der Frühindustrialisierung zwar kein Kapitalmangel, aber die Vermögensbesitzer waren es nicht gewohnt, in Industrie- oder Handelsunternehmen zu investieren. In dieser Situation erforderte ein erfolgreicher Durchbruch der Industrialisierung solche Finanzinstitutionen, die in der Lage waren, die verfügbaren Ersparnisse zu sammeln und den neuen Wachstumsbranchen zuzuführen. Die etablierten Bankhäuser der Finanzzentren Frankfurt und Hamburg waren ähnlich wie die Amsterdamer Banken einige Jahrzehnte zuvor zunächst wenig an der Erschließung dieses neuen Marktes interessiert. Es blieb deshalb Newcomern aus der Provinz überlassen, diese Märkte zu entwickeln und Erfahrungen zu sammeln.
Die Lokomotive Rob Roy, hergestellt von Neilson & Company in Glasgow (1873).
Zentralnotenbank
Die deutschen Universalbanken unterschieden sich von den belgischen und französischen Pionieren der Industriefinanzierung in erster Linie dadurch, dass sie das kurzfristige und das langfristige Kreditgeschäft „mischten“ und zunächst nicht nur auf das Notenbankgeschäft, sondern weitgehend auch auf das Depositengeschäft verzichteten, wodurch sie weniger anfällig für plötzliche Ressourcenabzüge waren. Unterstützt wurde das sich in zwei Schüben, in den 1850er Jahren und in den 1870er Jahren, herausbildende Universalbankensystem in Deutschland durch eine Zentralnotenbank, zunächst die Preußische Bank und nach der Reichsgründung die Reichsbank, die als „Bank der Banken“ ihre Lender of Last Resort-Funktion durch eine implizite Liquiditätsgarantie für grundsätzlich solvente Banken wesentlich aktiver interpretierte als die in dieser Zeit mit Abstand bedeutendste Zentralnotenbank der Welt, die Bank of England.
Das deutsche Universalbanken-Modell mit der Reichsbank als „Bank der Banken“ diente am Ende des 19. Jahrhunderts vielen Ländern als Modell, die ebenfalls versuchen mussten, mit kapitalintensiven Industrien den Anschluss an das Industriezeitalter zu schaffen. Das gilt etwa für Schweden, die während der Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg am schnellsten wachsende Volkswirtschaft Europas, und auch für Italien, wo nicht nur versucht wurde, das deutsche Modell zu kopieren, sondern wo sich auch deutsche Banken an der Gründung italienischer Universalbanken beteiligten.
In Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa war die Industrialisierung am Ende des 19. Jahrhunderts erst in vergleichsweise begrenzten Teilregionen zum Durchbruch gelangt. Österreich-Ungarn und Russland waren von einem extremen Entwicklungsgefälle zwischen den modernen industriellen Zentren und der Peripherie geprägt, während das Osmanische Reich so gut wie keine Ansätze einer Industrialisierung zeigte.
Österreich-Ungarn
Nach dem Ausgleich von 1867, der die Habsburgermonarchie in zwei gleichberechtigte Teile gliederte, umfasste die österreichische Hälfte einige moderne Industriegebiete, vornehmlich in Böhmen, sowie vergleichsweise moderne landwirtschaftlich geprägte Regionen. Galizien im Nordosten und Dalmatien im Süden waren jedoch wirtschaftlich sehr rückständige Provinzen, die zu den ärmsten Regionen Europas gehörten. Die ungarische Reichshälfte war fast ganz agrarisch geprägt, wobei die großen Latifundien der ungarischen Tiefebene exportorientiert Weizen anbauten. Im Zuge dieser Entwicklung entstand in Budapest eine moderne Mühlenindustrie. Die Randbereiche waren aber auch in der ungarischen Reichshälfte wirtschaftlich sehr rückständig.
In Russland war die Bedeutung moderner Industrieregionen noch weitaus geringer als in Österreich-Ungarn. Das lag zum einen daran, dass die Bauernbefreiung noch einmal deutlich später erfolgte, und zum anderen waren mit der Reform von 1861 de facto immer noch keine individuellen Verfügungsrechte den Bauern verliehen worden. Die Voraussetzungen für eine marktorientierte Landwirtschaft wurden in Russland erst mit den Stolypin’schen Reformen nach der Wende zum 20. Jahrhundert geschaffen. Damit erfolgte die institutionelle Revolution rund 150 Jahre später als in Großbritannien und rund 100 Jahre später als in den seinerzeit von Frankreich beherrschten Teilen Europas.
Eisenbahnbau in Russland
Ähnlich wie bei seinen westlichen Nachbarn spielte auch in Russland der Eisenbahnbau eine zentrale Rolle für die Industrialisierung. Die erste wichtige Strecke von Moskau nach St. Petersburg wurde aber erst 1852 eröffnet. Im Jahr 1880 hatte das russische Eisenbahnnetz aber immerhin einen Umfang von 22.900 Kilometern erreicht. Im Jahr 1892 war eine Verbindung von Moskau zum Ural fertiggestellt, und etwa zur gleichen Zeit wurde mit dem Bau der Transsibirischen Bahn von Moskau nach Wladiwostok an der Pazifikküste begonnen, die eine der gewaltigsten technischen Herausforderungen der Zeit darstellte. Bei einer Streckenlänge von ca. 6000 Kilometern betrug das Bautempo bis zur Fertigstellung im Jahr 1904 ca. 450 Kilometer pro Jahr. Das war nicht zuletzt deshalb eine bemerkenswerte Leistung, weil ein großer Teil des Baumaterials über Tausende von Kilometern herangeschafft werden musste. Noch vor der Vollendung der Transsibirischen Eisenbahn wurde bereits 1901 ein Abzweig von Orenburg am Ural nach Taschkent – und damit in die Baumwollgebiete Zentralasiens – in Angriff genommen (s. S. 366).
Kapital für den Eisenbahnbau
Diese eindrucksvolle Bauleistung eilte jedoch der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung weit voraus. Das neue Verkehrsmittel wurde vielerorts noch nicht einmal annähernd ausgelastet, entsprechend gering war die Neigung von privaten Investoren, Eisenbahnen in Russland zu bauen. Deshalb musste der Staat die Bahnen teils selbst finanzieren, teils den privaten Gesellschaften eine jährliche Mindestverzinsung garantieren. Diese staatliche Zinsgarantie entwickelte sich zu einem der wichtigsten Instrumente zur Förderung der russischen Industrialisierung und gleichzeitig zu einer schweren Belastung des Staatshaushalts. Das Kapital zum Bau der Eisenbahnen und zum Aufbau einer russischen Schwerindustrie kam zum großen Teil aus dem Ausland, etwa ein Drittel aus Frankreich, knapp ein Viertel aus Großbritannien und jeweils etwa ein Fünftel aus Belgien und Deutschland. Besonders Sergei Juljewitsch Witte, seit 1891 Finanzminister, förderte den Kapitalimport aus dem westlichen Ausland als notwendige Voraussetzung einer nachholenden Industrialisierung. Er setzte auch den erwähnten Beitritt Russlands in den Kreis der Goldwährungsländer durch, wodurch die Wechselkursrisiken für ausländische Investoren deutlich verringert wurden.
Ukraine
Die Witte’sche Industrialisierungsförderung führte in den 1890er Jahren tatsächlich zu einem deutlich beschleunigten Wachstum der Industrieproduktion. Zu den wichtigsten Trägern dieses Wachstums gehörte die Schwerindustrie der Ukraine. Nach 1871 wurden das Donez-Kohlerevier und im folgenden Jahrzehnt das Kriwoj-Rog-Eisenerzgebiet erschlossen. Im Jahr 1887 betrug der Anteil der Ukraine an der russischen Eisen- und Stahlproduktion nur drei Prozent. Zu dieser Zeit wurde Eisenerz in Russland noch überwiegend vorindustriell im Uralgebiet auf Holzkohlebasis verhüttet. 1897 machte der moderne ukrainische Produktionsanteil dann schon 34 Prozent und 1901 sogar 75 Prozent aus.
Osmanisches Reich
Das mit Abstand rückständigste der drei Großreiche im Osten und Südosten Europas war das Osmanische Reich. Im 18. Jahrhundert hatte in Ägypten und der Levante zwar noch ein vorindustrielles exportorientiertes Baumwollgewerbe existiert, aber spätestens in der Mitte des 19. Jahrhunderts waren Baumwollwaren aus dem östlichen Mittelmeerraum auf den Weltmärkten nicht mehr konkurrenzfähig. Zunehmend wurden sie sogar im Inland durch industriell hergestellte Konkurrenzprodukte bedrängt. Die auch weiterhin erfolgreiche Nische handgearbeiteter Orientteppiche war viel zu klein, um als Führungssektor fungieren zu können. Davon abgesehen hätte jeder Mechanisierungsversuch deren Alleinstellungsmerkmal zerstört.
Im Gegensatz zu Russland war das Osmanische Reich aber nicht nur wirtschaftlich rückständig, sondern auch politisch schwach. Deshalb konnte die Erschließung des Landes durch die Eisenbahn auch dort nur dank des Zuflusses ausländischen Kapitals erfolgen. Dies geschah aber nicht auf Grund von selbst gesetzten Standards, sondern war mit einer imperialistischen Durchdringung des Landes durch die europäischen Großmächte verbunden (s. S. 373). Obwohl das Land deren Konkurrenz gelegentlich durchaus auszunutzen versuchte, waren weder Frankreich noch Großbritannien oder Deutschland daran interessiert, das Osmanische Reich mittelfristig in die Lage zu versetzen, etwa Lokomotiven und Schienen selber herzustellen. Deshalb ging vom Eisenbahnbau auch kein Impuls für den Aufbau einer eigenen Schwerindustrie aus. Allerdings waren dafür auch die institutionellen Voraussetzungen nicht geschaffen worden. Der jungtürkische Versuch einer gezielten Industrialisierungsförderung seit 1909 kam spät und war auch deswegen zum Scheitern verurteilt.
„Vorteile“ der USA
Anders als die beschriebenen Vielvölkerstaaten Europas befanden sich die USA am Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr in einem Übergangsstadium zu einem Industriestaat. Ganz ähnlich wie Russland gab es auch in den USA industrielle Ballungsräume neben weiten Gebieten, die kaum besiedelt waren. Die dort lebende indigene Bevölkerung, der moderne Eigentumsrechte fremd gewesen war, wurde einfach verdrängt, wenn es wirtschaftlich geboten schien oder sie eine Gefahr für die europäischen Siedler darstellte. Ein wesentlicher Unterschied zu Europa lag jedoch darin, dass die USA nicht mit einem feudalen Erbe belastet waren, das die wirtschaftliche Entwicklung in Ost- und Südosteuropa fast über das gesamte 19. Jahrhundert noch maßgeblich behinderte. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil war die Tatsache, dass die amerikanische Bevölkerung wegen der besonderen Altersstruktur der Einwanderer während des 19. Jahrhunderts im Durchschnitt ausgesprochen jung war. Junge Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben waren wesentlich mobiler und stellten eine weitaus bessere Voraussetzung für die Übernahme jeglicher Arten von Neuerungen dar als die Traditionen verhaftete und in den scheinbar unverrückbaren Hierarchien der dörflichen Gesellschaft lebende Bevölkerung in weiten Teilen Europas.
Europäische Amerikaauswanderung
Zu einem Massenphänomen wurde die europäische Amerikaauswanderung seit den 1840er Jahren, als bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs etwa vier Millionen Menschen nach Amerika strömten. Allein zwischen 1847 und 1857 kamen auf 10.000 Einwohner der USA etwa 100 Immigranten jährlich. Während der zweiten Einwanderungswelle nach dem Bürgerkrieg war die Relation von Immigranten und Einwohnern zwar nicht mehr ganz so hoch, in absoluten Zahlen aber immer noch einzigartig: Zwischen 1870 und 1890 stieg die Einwohnerzahl der USA von 40 auf über 60 Millionen Menschen, wobei zwei Drittel dieses Zuwachses auf die Einwanderung zurückzuführen sind. Die Mehrheit der Einwanderer kam aus Irland (insbesondere während der ersten Welle), den deutschen Staaten, der Schweiz und Skandinavien. Später kamen auch verstärkt Italiener und Asiaten, wobei vor allem Chinesen als Eisenbahnbauarbeiter angeworben wurden und eine regional bedeutsame Minderheit in den noch dünn besiedelten Gebieten an der Westküste darstellten (s. Band VI, S. 180f.). Das Ziel der meisten europäischen Einwanderer dieser Jahre war der Erwerb von Farmland, was vielen von ihnen auch gelang. Lediglich die irischen Einwanderer blieben mehrheitlich in den Städten an der Ostküste und verdingten sich dort als Industriearbeiter. Nachdem die Landnahme jedoch kurz vor der Jahrhundertwende abgeschlossen und damit die Hoffnung auf ein weitgehend selbstbestimmtes Leben in den USA geschwunden war, ebbte die Auswanderung aus den Industriestaaten ab. Denn Arbeit in Fabriken war dort zu dieser Zeit auch zu finden.
Im Folgenden werden drei Wirtschaftsregionen in den USA zu betrachten sein, die das Land für den größten Teil des 19. Jahrhunderts wesentlich prägten: das alte, frühzeitig leichtindustriell strukturierte Siedlungsgebiet an der Ostküste, der Mittlere Westen, der zum einen die „Kornkammer“ der USA bildete, zum anderen südlich der Großen Seen eine bedeutende Schwerindustrie hervorbrachte, sowie der Baumwollgürtel des Südens.
Landwirtschaft an der Ostküste
Die neuen Siedlungsgebiete für diejenigen Einwanderer, deren Ziel der Erwerb von Farmland war, lagen jenseits der Appalachen. Diese, später als Mittlerer Westen bezeichnete Großregion war zunächst rein landwirtschaftlich geprägt. Die Wachstumsraten der weitgehend auf Familienbetrieben beruhenden agrarischen Produktion waren fast während des gesamten 19. Jahrhunderts sehr hoch. Um die wachsende Produktion vermarkten zu können, musste jedoch eine Verkehrsanbindung an die Ostküste mit ihren großen Städten hergestellt werden. Da Landwirtschaft in den Neuenglandstaaten nur unter ungünstigeren Bedingungen möglich war, erleichterte ein intensivierter Warenaustausch zwischen der Ostküste und dem Mittleren Westen auch die regionale Spezialisierung. Während sich der Mittlere Westen zum Getreideproduzenten entwickelte, nutzte die Landwirtschaft an der Ostküste ihre relative Nähe zu den Verbrauchern und spezialisierte sich auf leicht verderbliche Produkte (Veredelungslandwirtschaft), die für lange Transportwege ungeeignet waren.
Kanalbau
Allerdings stellten die Appalachen ein schwer zu überwindendes Hindernis dar. Nach einigen frühen Straßenbauprojekten waren es in erster Linie Kanalbauten zur Verbindung der natürlichen Ströme und Flüsse, mit denen die drei Wirtschaftsregionen miteinander verbunden wurden. Das galt zum einen für das Flusssystem des Mississippi, mit dem der agrarische Mittlere Westen erschlossen und mit dem Süden verbunden werden konnte. Zum anderen kam das Gebiet der Großen Seen über den Eriekanal mit dem Hudson und damit mit der Ostküste in Verbindung. Besonders der Erfolg dieses zwischen 1817 und 1825 errichteten Kanals löste wie zuvor in Großbritannien eine Canal Mania aus und lockte auch europäische Investoren an. Am Vorabend des Eisenbahnzeitalters waren in den USA insgesamt fast 5000 Kilometer Kanäle in Betrieb.
„Kornkammer“ der USA
Der Aufstieg zur „Kornkammer“ der USA bedeutete jedoch nicht, dass der Mittlere Westen eine rein agrarisch strukturierte Region geblieben wäre. Vielmehr entstand mit der interregionalen Exportorientierung auch eine landwirtschaftsnahe Industrie: teilweise, indem landwirtschaftliche Produkte verarbeitet wurden, etwa in den Schlachthöfen Chicagos (denen das Provinzstädtchen seit den 1860er Jahren seinen Aufstieg zu einer der bedeutendsten Großstädte der USA verdankte) oder in den Brauereien von St. Louis (die aus dem „Tor zum Westen“ eine Industriestadt machten), teilweise aber auch als Zulieferer für eine auch im zeitgenössischen Vergleich mit Europa recht kapitalintensive Landwirtschaft. Auf die relativ frühe Mechanisierung der Landwirtschaft des Mittleren Westens ist die hohe Produktivität der US-Landwirtschaft im Vergleich zu Europa wesentlich zurückzuführen.
Baumwollgürtel des Südens
Mit dem wachsenden Bedarf Europas an Baumwolle entstand in den Südstaaten von South Carolina im Osten über die Staaten an der Golfküste bis nach Texas eine auf Sklavenarbeit beruhende Baumwollplantagenwirtschaft. Dort, wo schon seit längerem Tabak, Reis oder Zuckerrohr angebaut worden war, verschwanden diese Kulturen und wurden durch King Cotton ersetzt. Lediglich in dem etwas weiter nördlich an der Atlantikküste gelegenen Virginia konnte sich der Tabak- und Weizenanbau noch behaupten, ansonsten lebte der gesamte Süden von der Baumwolle. Dabei entwickelte sich New Orleans an der Mississippi-Mündung zu dem wichtigsten Ausfuhrhafen der USA. Anders als im Mittleren Westen fand der Süden jedoch lange Zeit keinen Anschluss an das Industriezeitalter. Eine textilindustrielle Entwicklung wurde trotz der leichten Verfügbarkeit des Rohstoffs im Süden nicht ausgelöst. Am Vorabend des Bürgerkriegs waren nur etwa 10 Prozent des Kapitalstocks der Baumwollindustrie in den Südstaaten investiert worden, aber 70 Prozent in den Neuenglandstaaten.
Eisenbahnbau in den USA
In das Eisenbahnzeitalter traten die USA trotz ihres gut ausgebauten Binnenwasserstraßennetzes außerordentlich früh ein. Mit dem Bau der ersten Eisenbahnstrecke von Baltimore über die Appalachen an den Ohio wurde bereits 1827 begonnen. Die erste in den USA gebaute Lokomotive war dort bereits seit 1830 im Einsatz und damit kaum später als die Rocket von George und Robert Stephenson auf der Strecke Liverpool–Manchester. Im Jahr 1852 überquerten dann schon vier Eisenbahnstrecken die Appalachen, und um 1860 waren mehr als 45.000 Kilometer Eisenbahn in Betrieb. Auch hier war die privatwirtschaftliche Konkurrenz zwischen den Eisenbahngesellschaften eine wesentliche Triebfeder für das rasante Wachstum. Ähnlich wie in England fehlte allerdings auch in den USA eine zentrale Planung. So war der wirtschaftlich stärkere Norden weitaus besser durch Eisenbahnen erschlossen als der Süden, und fast alle Strecken besaßen eine Ost-West-Ausrichtung. Um 1860 verliefen nur ganze drei Eisenbahnstrecken von Norden nach Süden. Außerdem ließen sich die amerikanischen Eisenbahngesellschaften lange Zeit ähnlich wie in England auf bestimmte Standards (einschließlich der Spurweite) nicht verpflichten.
Kohlenfunde in den USA
Eine wichtige Voraussetzung für den frühen Eintritt der USA in die schwerindustrielle Phase der Industrialisierung waren die Kohlenfunde auf der Ostseite der Appalachen. Bereits in den 1820er Jahren wurde das erste Kohlefeld durch einen Kanal erschlossen. Die dort und in anderen Feldern im östlichen Pennsylvania abgebaute Kohle war reine Anthrazitkohle, die sich anders als die europäische Kohle wegen ihres hohen Kohlenstoffanteils ohne Verkokungsprozess als Energielieferant für Eisenhütten eignete. Nachdem in Pennsylvania bereits seit Beginn des 19. Jahrhunderts Eisenerz gefördert und in Holzkohlehochöfen verhüttet worden war, wurden seit den 1840er Jahren die ersten Anthrazithochöfen in Betrieb genommen und das Roheisen dann in Puddelöfen weiter verarbeitet. Die Technologie kam ursprünglich aus Wales, wo es ebenfalls Anthrazitvorkommen gab, wurde dann aber in den USA weiterentwickelt und verbreitete sich sehr schnell in der Region. Vor dem Bürgerkrieg waren schon deutlich mehr als 50 Prozent des in den USA produzierten Roheisens in Anthrazithochöfen verhüttet worden.
Südstaaten-Sklaven bei der Bedienung von Eli Whitneys 1790 erfundenen „Cotton Gin“ (Holzstich, 19. Jh.).
Seit den 1840er Jahren bildete die Eisen- und Stahlindustrie in Pennsylvania dann auch die Grundlage für eine erfolgreiche Importsubstitution von Schienen, für die der Eisenbahnbau rund 50 Jahre lang einen gewaltigen Absatzmarkt schuf. Daneben versorgten die Anthrazitkohlenfelder aber auch die Städte an der Ostküste, die wegen ihres schnellen Bevölkerungswachstums ebenfalls einen bedeutenden Wachstumsmarkt darstellten. Mit der steigenden Produktion und der sich ständig verbessernden verkehrsmäßigen Erschließung sanken die Kohlenpreise, so dass die Energieträger Holz und Wasser in allen Bereichen immer weiter zurückgedrängt werden konnten.
Gleichzeitig wurden weitere Kohlefelder erschlossen, darunter auch solche westlich der Appalachen, in Ohio, Illinois und Missouri. Der Abbau war in den meisten Feldern wenig aufwendig, weil die Kohle nahe an der Oberfläche gefördert werden konnte. Der Abtransport erfolgte entweder über das Wasserstraßennetz oder seit den 1840er Jahren auch schon mit der Eisenbahn. Während des Bürgerkriegs wurde die Förderung dann noch einmal gesteigert. Auch in den Südstaaten wurden neue Felder in North Carolina und Alabama erschlossen, nachdem vor dem Bürgerkrieg dort nur in Virginia Kohle abgebaut worden war.
Bei Kriegsende waren in sehr vielen Staaten der USA Kohlevorkommen erschlossen worden, was wiederum einen starken Anreiz für die verschiedenen Eisenbahngesellschaften schuf, die Felder mit den Verbrauchszentren zu verbinden. Der Eisenbahnbau ermöglichte dann auch die Erschließung der ersten, westlich des Mississippi gelegenen Kohlevorkommen, etwa in Colorado, Wyoming und New Mexico. Da in den meisten der seit dem Krieg neu erschlossenen Felder Fettkohle gefördert wurde, überflügelte sie im Rest der USA die Anthrazitförderung Pennsylvanias schon wenige Jahre nach dem Krieg, so dass auch der Hochofenkoks in der Eisen- und Stahlindustrie rasch und zu Lasten der Anthrazitkohle an Bedeutung gewann.
Eisenerzfunde am Lake Superior
Von nicht minder großer Bedeutung für die Entwicklung der Schwerindustrie nach dem Bürgerkrieg waren die Eisenerzfunde am Lake Superior. Die ersten Minen förderten zwar schon seit den späten 1840er Jahren, aber die Transportprobleme von Minnesota nach Osten waren noch zu groß, um Erz und Kohle zusammenzubringen. Die erste Voraussetzung stellte ein Verbindungskanal vom Lake Superior zu den anderen Seen dar. Als dieser Mitte der 1850er Jahre realisiert worden war, reichten aber die Transportkapazitäten von Kanal und Segelschiffen noch nicht aus, um die Vormachtstellung der Eisen- und Stahlindustrie Pennsylvanias ernsthaft zu gefährden. Als in den 70er und 80er Jahren jedoch die Dampfschiffe auf den Großen Seen die Segelschiffe verdrängten und der Verbindungskanal sowie die Hafenanlagen in Cleveland und Buffalo am Eriesee sowie in Chicago am Michigansee ausgebaut worden waren, entwickelte sich das Gebiet südlich vom Michigansee (Chicago) und Eriesee (Detroit, Cleveland, Buffalo) sowie mit Pittsburgh im Westen Pennsylvanias zu der bedeutendsten schwerindustriell geprägten Region der USA.
Landerschließung mit der Eisenbahn
Neben der „Transportrevolution“ auf den Großen Seen stellte die Erschließung des Westens mit der Eisenbahn die zweite, im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner noch weit stärker verwurzelte infrastrukturelle Leistung dar. Nach dem Bürgerkrieg wurde der alte Traum einer Eisenbahnverbindung zwischen der Ost- und der Westküste relativ schnell verwirklicht. Angetrieben durch einen privatwirtschaftlichen Wettbewerb und die Zusage des Staates, den Eisenbahngesellschaften finanzielle Beihilfen zu gewähren und das benötigte Land entlang der Strecken unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, wurde das letzte Verbindungsstück der transkontinentalen Eisenbahn zwischen Omaha im Bundesstaat Nebraska, einem der westlichsten Punkte des Eisenbahnnetzes zu dieser Zeit, und Sacramento in Kalifornien bereits 1869 geschlossen. In den 1880er Jahren folgten dann zwei weitere Strecken, zunächst die etwas weiter südlich verlaufende Verbindung von Kansas nach Los Angeles und dann die etwas nördlichere Verbindung von Duluth am Westufer des Lake Superior nach Portland im Bundesstaat Oregon. Etwa zu derselben Zeit wurde auch die erste transkontinentale Eisenbahn in Kanada gebaut, die nach diversen politischen Skandalen, Unruhen und Finanzierungsproblemen 1885 vollendet wurde und das kanadische Eisenbahnnetz von dessen westlichstem Punkt Winnipeg aus mit Port Moody beziehungsweise Vancouver in British Columbia an der Pazifikküste verband.
Industrialisierung Japans
Etwas aus dem Rahmen der Systematik dieses Überblicks fällt die Industrialisierung der einzigen außerhalb des christlich geprägten Kulturkreises gelegenen Weltregion. Denn es war nicht die Schwerindustrie, die als Führungssektor die Industrialisierung Japans während des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts prägte, sondern die Leichtindustrie. Weshalb es gelang, der überlegenen westlichen Konkurrenz ausgerechnet in diesem Segment industrieller Produktion zu diesem späten Zeitpunkt noch erfolgreich Paroli zu bieten, erklärt sich vermutlich zum einen aus der geographischen Lage des Landes. Denn die europäische und nordamerikanische Textilindustrie hatten zwar den atlantischen Raum zu diesem Zeitpunkt fast vollständig erschlossen, aber auf dem riesigen asiatischen Markt war das mit der Ausnahme Indien erst ansatzweise gelungen. Zum anderen konnte sich Japan mit einer Textilfaser auf dem Weltmarkt platzieren, die bisher in den Ländern mit der leistungsfähigsten Textilindustrie weitgehend unbeachtet geblieben war: der Seide. Der japanische Erfolg gelang also erstens wegen der Größe des asiatischen Marktes für billige textile Massenwaren (Baumwolle) und zweitens wegen des erfolgreichen Besetzens einer Nische (Seide).
Startbedingungen
Die Startbedingungen für die Industrialisierung waren denjenigen Europas aber durchaus nicht unähnlich. Eine einschneidende (militärische) Niederlage hatte einen fundamentalen Lernprozess ausgelöst, der dem sich seit längerem im Niedergang befindlichen Feudalsystem den Todesstoß versetzte. Was in weiten Teilen Westund Mitteleuropas die napoleonische Besetzung beziehungsweise Bedrohung und im Falle Russlands der Krimkrieg bewegt hatten, war in Japan durch die von den USA militärisch erzwungene Öffnung des japanischen Marktes für westliche Importe gelungen. Dadurch musste Japan seine jahrhundertelange Politik der relativen Abschließung aufgeben, wodurch das soziale und politische System des Landes weiter destabilisiert wurde.
Nach einer Revolution im Jahr 1868 veränderte sich das Land in einem atemberaubenden Tempo. Ähnlich wie in Europa bildeten die Aufhebung aller Beschränkungen der Bewegungs- und Gewerbefreiheit sowie die Herstellung von Eigentumsund Verfügungsrechten über Grund und Boden auch in Japan eine wichtige Voraussetzung für die Modernisierung der Wirtschaft, die zu diesem Zeitpunkt noch wesentlich durch die Landwirtschaft geprägt war: Bauern und ihre Familien machten zum Zeitpunkt der Marktöffnung noch etwa drei Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Anstelle feudaler Abgabe- und Dienstverpflichtungen wurde nun eine in Geld zu zahlende Grundsteuer eingeführt, die es dem Staat erlaubte, sich wirtschaftlich stark zu engagieren, ohne sich im Ausland nennenswert verschulden zu müssen. Denn das Ziel dieser Politik war die volle Wiederherstellung der Souveränität, die man auch durch ausländische Gläubiger gefährdet sah.
Institutionelle Reformen
Das Grundsteueraufkommen, das zwischen 1875 und 1895 etwa 90 Prozent aller staatlichen Einnahmen ausmachte und sich 1895 auf etwa 60 Millionen Yen (gegenüber 2 Mio. Yen 1868) belief, ermöglichte ein zu dieser Zeit auf der Welt wohl einmaliges wirtschaftliches Interesse des Staates. Der Staat engagierte sich vom Aufbau eines breiten elementaren Bildungssystems und der gezielten Förderung höherer (technischer) Bildung im Inland, über die Organisation von Industriespionage und die Errichtung von Musterfabriken bis hin zu Investitionen in die Infrastruktur (Telegraf, Eisenbahn und Handelsflotte) und eine moderne Rüstungswirtschaft. In einem atemberaubenden Tempo wurde das Geldwesen vereinheitlicht und 1882 mit der Bank von Japan eine moderne Zentralnotenbank geschaffen. Auch bei diesen institutionellen Reformen suchten die Japaner im Westen gezielt nach Vorbildern, die dann den Gegebenheiten angepasst wurden.
Schlüsselrolle der Landwirtschaft
Ähnlich wie in den erfolgreichen Fällen kontinentaleuropäischer nachholender Industrialisierung spielte auch in Japan die Landwirtschaft eine Schlüsselrolle. Denn zum einen stellte die durch die Agrarreformen ausgelöste Produktionssteigerung eine ausreichende Ernährung der Bevölkerung sicher, so dass Devisen für den Import von Nahrungsmitteln nicht benötigt wurden, zum anderen gelang es, den Rohstoff für die Seidenproduktion durch eine erhebliche Ausweitung der Kokonproduktion in der heimischen Landwirtschaft in ausreichender Menge herzustellen. Zwischen 1880 und 1910 stieg die Rohseideproduktion Japans um etwa 700 Prozent, wobei etwa drei Viertel exportiert wurden. Die Verarbeitung der Kokons wurde seit den 1870er Jahren dank der staatlichen Unterstützung flächendeckend mechanisiert, indem spezialisierte kleingewerbliche, aber auf Marktproduktion ausgerichtete Haspelbetriebe errichtet wurden, deren Energiebedarf entweder noch ausschließlich durch die menschliche Muskelkraft oder auch schon durch den Wasserradantrieb sichergestellt wurde.
Baumwollgewerbe
Vor der Öffnung des Binnenmarktes hatte es auch in Japan ein auf Heimarbeit beruhendes Baumwollgewerbe gegeben. Mit der Marktöffnung für westliche, maschinell gesponnene und gewebte Baumwolltextilien brach die heimische Garnproduktion jedoch innerhalb kurzer Zeit fast vollständig zusammen. Die Handweberei konnte sich dagegen noch etwas länger behaupten, indem die Weber auf besondere Qualitäten auswichen und damit Nischen wie etwa die Stoffe für die Kimonoproduktion besetzten. Dank einer massiven staatlichen Intervention konnte sich dann in den 1880er Jahren auch eine mechanisierte Baumwollspinnerei etablieren, wobei die leichter zu verarbeitende indische Rohbaumwolle die heimische Baumwolle zunehmend verdrängte. Viele der neuen Spinnereien gliederten sich mit der Zeit modernen Webereien an, die vor allem für den Export in die asiatischen Nachbarländer arbeiteten.
Steinkohlenvorkommen
Obwohl Japan große Steinkohlenvorkommen besaß, wurden die Lager wegen ihrer peripheren Lage auf Kyūshū und Hokkaidū, der südlichsten beziehungsweise nördlichsten der vier Hauptinseln Japans, erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts erschlossen. Das älteste Steinkohlenbergwerk, die Miike-Kohlenmine auf Kyūshū, war 1872 wegen ihrer „strategischen Bedeutung“ verstaatlicht und dann überwiegend mit dem Einsatz von Häftlingen betrieben worden. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde das Bergwerk dann privatisiert, indem der größte (Misch-)Konzern des Landes, Mitsui Bussan, dank seiner hervorragenden Kontakte zur Meiji-Regierung das Bergwerk übernahm. Die Häftlingsarbeit ging danach zwar zurück, wurde aber erst 1930 ganz eingestellt. Auch andere große (Misch-)Konzerne (Zaibatsu) engagierten sich in dieser Zeit im Steinkohlenbergbau, so dass Steinkohle um 1900 immerhin zum zweitwichtigsten Exportgut Japans nach Rohseide aufstieg. Zu diesem Zeitpunkt wurde Steinkohle im Gesamtwert von etwa 20 Millionen US-Dollar exportiert, um 1880 hatte der Exportwert dagegen erst bei etwas über 1 Million US-Dollar gelegen.