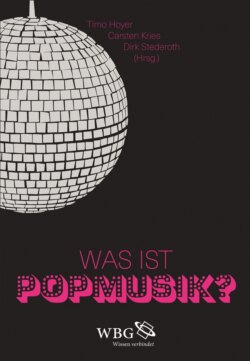Читать книгу Was ist Popmusik? - Группа авторов - Страница 12
4. Pop1: ein weiter Begriff von Popmusik
ОглавлениеDer im fachwissenschaftlichen und feuilletonistischen Diskurs häufig verwendete Begriff von Popmusik (auch Pop oder populäre Musik) ist ein Container von schier unerschöpflicher Fassungskraft (vgl. z.B. BALZER 2016, DIEDERICHSEN 2014, HELMS/PHLEPS 2012). Das muss man sich einmal vor Augen halten: Roberto Blanco, Godspeed You! Black Emperor, Ravi Shankar, Wolf Eyes, Ricky King, Slayer, Hannes Wader, D J Spooky, Glenn Miller, Sun Ra, Aphex Twin, Kurt Weill, Juan de Marcos González, Public Enemy, die Puhdys, James Last, Edith Piaf, Acid Mothers Temple, Dean Martin, Biermösl Blosn – alles angeblich Repräsentanten von Popmusik. Ob Tanz- oder Volksmusik, Rock (Beat, Kraut- oder Post-Rock), Jazz (vom Ragtime über den Swing bis zum Free Jazz), Blues, Country & Western, Chanson, Schlager oder Noise – alles populäre Musik. Manche schließen, um dem Feld etwas mehr Homogenität zu verleihen, nach Gutdünken den Schlager aus, manche möchten auf traditionelle Volksmusikformen oder experimentelle Musik verzichten, manche klammern Schauspielmusik, Musicals oder den Jazz aus – aber wohin damit? Überzeugende Argumente für den Ausschluss der einen oder anderen Musiksparte gibt es nicht, weil es auch keine überzeugenden Argumente gibt, weshalb dies kunterbunte Allerlei eine sinnvolle Einheit namens Popmusik bilden soll. Meine zuvor im zweiten Kapitel unternommenen Unterscheidungen wären mit diesem weiten Popmusikbegriff prinzipiell unmöglich, da alle dort erwähnten Bands, Musikerinnen und Musiker von vornherein der Popmusik zugerechnet werden. Ich kürze diesen weiten Popmusikbegriff mit Pop1 ab und werde ihm nachher einen engen Begriff von Popmusik gegenüberstellen: Pop2. (Meine Klassifizierung hat im Übrigen nichts mit der von Diederichsen zu tun, der einmal eine chronologisch aufeinanderfolgende Pop I- und Pop II-Phase unterschieden hat).
Pop1 ist eine Sammelbezeichnung, in der unbesehen sämtliche Musikstile Aufnahme finden, die man außerhalb der europäischen Kunstoder Konzertmusik ansiedelt. Eine binäre Opposition, wie sie im Buche steht: Hier die ernsten, anspruchsvollen Künstler und Komponisten/innen von Buxtehude bis Olga Neuwirth: Klassische bzw. ab 1945 „Moderne Musik“ (vgl. DIBELIUS 1966). Dort der ganze Rest, das schlechthin Andere: populäre Musik, Popmusik. Klare Fronten also – die so klar nicht sind. Der Dualismus von Klassischer Musik und Popmusik geht auf eine kulturelle Abwertung, eine Deklassierung zurück. Von der philosophischen Ästhetik, der Kunstwissenschaft, der akademischen Musikanalyse, der universitären Musikausbildung und von der Mehrheit der Komponisten Moderner Musik ist grosso modo das ganze musikalische Geschehen jenseits der sog. Kunstmusik lange Zeit nicht für voll genommen worden. Noch Wolfgang Rihm, Jahrgang 52, schüttelt sich bei der bloßen Vorstellung, ein Rockkonzert zu besuchen, da er bereits als Gymnasiast über diese Art Musik die Nase rümpfte: „Ach, Gott im Himmel, das war so altmodische Harmonik“ (HOYER 2013, 85). Von dieser Rihmschen Warte aus betrachtet, gab und gibt es außerhalb der Philharmonien nichts als leicht gestrickte Kost zu hören, für den schnellen Konsum und das flüchtige Vergnügen bestimmte Massen- und Unterhaltungsware, die mit den hohen Ansprüchen der Klassischen/Modernen Musik nicht im Entferntesten mithalten könne.
Die Zweiklassen-Musikgesellschaft ist im Rückgang begriffen, seit die kulturelle und akademische Deutungsmacht zu einem guten Teil bei einer Generation von Journalisten, Redakteuren und Akademikern liegt, die vor allem mit Pop1 aufgewachsen ist und nicht mehr, wie noch zu Zeiten Theodor W. Adornos oder Vladimir Jankélévitchs, in erster Linie mit Klassischer Musik. Trotzdem ist der Dualismus in den Köpfen und Institutionen längst noch nicht überwunden. Der 1971 geborene Philosoph Gunnar Hindrichs bringt es beispielsweise fertig, die „Musik unserer Zeit“ (HINDRICHS 2014, 59) unbeirrt und unbegründet mit der Tradition europäischer Kunstmusik gleichzusetzen; in seiner Musikontologie existiert aus dem weiten Feld von Pop1 rein gar nichts.
Solche eingeschränkten Sichtfenster sind auch im „Popmusik“-Diskurs allgegenwärtig. Nach dem Tod von David Bowie war im Feuilleton zu lesen, einer der erfolgreichsten Sänger der „Popgeschichte“ sei gestorben, Bowie habe die „Popgeschichte“ wie wenige andere beeinflusst. Aha, die Popgeschichte also – und nichts außerdem? Peter Kümmel teilte in der ZEIT (Nr. 3, 2016) mit, Bowie wäre mit seiner 1969 herausgekommenen Space Oddity „der erste Raumfahrer der Popgeschichte“ gewesen. Kümmel irrt, wenn mit Pop Rockmusik gemeint sein soll. Die Rolling Stones etwa befanden sich schon zwei Jahre vor Bowie „2000 Light Years From Home“, ebenso Jimi Hendrix, der zu Beginn von Axis: Bold As Love außerirdische Standpunkte einnimmt. Sollte mit Pop populäre Musik (Pop1) gemeint sein, ist Kümmels Aussage ebenfalls falsch, schließlich gab es schon die Cosmic Music von John und Alice Coltrane, und mit Sun Ra sogar einen auf dem Saturn geborenen Musiker. Letztlich ist es jedoch völlig gleichgültig, der wievielte „Pop“-Musiker Bowie im All gewesen ist. Die künstlerische Bedeutsamkeit des Albums ergibt sich, wenn man es aus der Popmusikschublade befreit und in den größeren Kontext von Weltraummusiken stellt, die es schon lange vor Bowie gab (Haydn Die Schöpfung, Josef Strauss Sphärenklänge etc.) und die ungefähr zeitgleich mit Bowie Konjunktur hatten. Solche Zusammenhänge entgehen einem, solange man in den Kategorien der binären Opposition gefangen ist.
Es ist, darauf möchte ich hinaus, längst angebracht, den absurd weiten Popmusikbegriff, der aus den Zeiten des Kalten Krieges zwischen „Ernster Musik“ und „Unterhaltungsmusik“ stammt, für überholt zu erklären und auszurangieren. Meine Forderung sei mit wenigen Bemerkungen bekräftigt.
Dass die gängige E-U-Dichotomie in ihrer einfachen Wortbedeutung witzlos ist, darüber sind kaum Worte zu verlieren. Verglichen mit der heiligen Ernsthaftigkeit von John Coltranes A Love Supreme, den andächtigen Gospels Mahalia Jacksons, den von Olga Sergeeva gesungenen russischen Volksliedern oder den finsteren Gesängen von Nick Cave – alles angeblich U-Musik – wirken die meisten Operetten einigermaßen läppisch und Henryk Góreckis Sorrowful Songs – Sparte EMusik – wie sentimentaler Betroffenheitskitsch. Und wenn Ummagumma oder die irrigerweise als Rock-Symphonien titulierten Werke Glenn Brancas nichts als unterhaltsam und das Gesamtwerk von John Zorn oder Extreme Metal leicht bekömmliche Kost sein sollten, dann wären es Puccinis Opern oder Bizets Carmen allemal.
Ich habe größte Mühe mir vorzustellen, was das musikalische Werk von Duke Ellington, Faust, Christian Marclay oder Ravi Shankar mit Boney M., Freddy Quinn oder Pharrell Williams verbindet, sehe aber sofort haufenweise Analogien zwischen der Musik der Erstgenannten und Werken der sog. Klassischen oder Modernen Musik. „Wollen wir beispielsweise einen indischen Raga an den Wertvorstellungen messen, die dem ‚wohltemperierten Klavier‘ innewohnen, so wäre das Entscheidende verfehlt“ (TAYLOR 1993, 63), meint der Philosoph Charles Taylor. Das mag schon sein. Doch wer Pop1 (z.B. Ragas) und Klassik (z.B. Bachs Klaviermusik) kategorisch getrennten Wertesystemen und Musikwelten zuordnet, ist bei der Analyse des musikalisch „Entscheidenden“, was immer das sein soll, so voreingenommen wie ein Ethnologe, der in anderen Kulturen ausschließlich Fremdartiges sucht – und dann auch findet.
Worin in aller Welt sollte die musikalische Gemeinsamkeit, um nicht zu sagen das Wesen des als Popmusik bezeichneten Sammelsuriums bestehen? Gibt es tatsächlich ein signifikantes Ausdrucksspektrum, bestimmte Produktions- und Distributionsverfahren, Werk- und Strukturcharakteristika, Klangbilder oder Aufführungsmodalitäten, die für Rock, Jazz, Schlager, traditionelle Musikformen usw. typisch sind und eben ausschließlich für diese und nicht für die sog. Konzertmusik? Oder ist es nicht vielmehr so, dass einem zu allen angeblich typischen Merkmalen der „Popmusik“ – von denen im Übrigen auch im vorliegenden Band die Rede ist – sofort triftige Gegenargumente einfallen (und nicht nur Einzelfälle oder Randphänomene), die das Differenzierungsmerkmal zunichtemachen?
Der mutmaßliche Unterschied zwischen Pop1 und Klassischer Musik wird beispielsweise am Umstand festgemacht, populäre Musik habe ein neuartiges Rhythmusverständnis zur Geltung gebracht, das im Zusammenhang mit der Körperlichkeit und Tanzbarkeit dieser Musik stehe. Keine Frage: In der Beatmusik, im Funk, im HipHop, der Discomusik, im Techno, Jazz und in traditioneller Volksmusik ist der Rhythmus, der Beat, der Groove vielfach von außerordentlicher und unverwechselbarer Bedeutung. Aber „what about the fucking…fucking… Beethoven“ (HORNBY 2000, 114), möchte man eine Frage aus dem Roman „High Fidelity“ einwerfen. Sind denn nicht zahlreiche Kompositionen von Beethoven, aber auch von Berlioz, Wagner, Bartók, Strawinsky, Ravel, Xenakis und manche Player Piano Studien von Conlon Nancarrow um einiges rhythmusbetonter und mitreißender als so gut wie alles von, sagen wir, Chet Baker, Radu Malfatti, Karen Dalton und William Fitzsimmons zusammen?
Cooljazzer, improvisierende Avantgardemusiker, Folksängerinnen und introvertierte Singer/Songwriter schreiben für Gewöhnlich auch keine Tanzmusik. Der Jazz hat sich spätestens mit dem Bebob in die Konzertsäle verlagert, was ihm prompt von den Grenzwächtern der E- und U-Musik übelgenommen wurde. Günther Anders etwa empfand den Einzug des Jazz in die Konzerthallen als Betrug am Wesen dieser Musik, die „zu ernst“, zu ergreifend für den Hör-Saal sei. Jazz, erklärte er, bestehe im „motorischen Mitvollzug“, in Ekstase und im orgiastischen Tanz, während Konzertmusik „nur gehört werden soll“ (ANDERS 1968, 87). Anders wollte eigentlich eine Lanze für den Jazz brechen, tapste aber, wie viele Kulturphilosophen jener Zeit, von einem mit ethnizistischen Vorurteilen gefüllten Fettnapf in den nächsten. Der Jazz hatte damals die Tanzflächen mehr und mehr dem Rock ’n’ Roll überlassen. Auch dieser hat sich dort nicht zur Ruhe gesetzt. Weite Teile der Rockmusik, der Progressive-, der Kraut- oder Post-Rock etwa, sind alles andere als tanzbar, von rhythmusarmer Ambient Music oder Drone Metal ganz zu schweigen. Zu mancher Musik des Barock hingegen sollte durchaus getanzt werden und wurde es auch. Und wer kennt reinrassigere Tanzmusik als die des Walzerkönigs Johann Strauss? Oder wäre das dann Popmusik aus einer Zeit, die noch nicht zwischen Pop und Klassik unterschieden hat?
Ein weiteres Differenzierungsmerkmal, das häufig ins Spiel gebracht wird, betrifft den vermeintlich für Pop1 typischen Performancecharakter. Im Rock, Jazz, Soul und in traditioneller Volksmusik ist der Akt des leibhaftigen, situativen Hervorbringens von Musik, die Live-Performance, ganz sicher ein markanter, eigentümlicher Faktor. Das Publikum kann hierbei den kreativen Prozess in statu nascendi miterleben. Doch zwingend notwendig ist die Performance im Zeitalter der technischen Produktion und Reproduzierbarkeit von Musik natürlich nicht. Das haben Aufnahmepioniere wie Lennie Tristano und Glenn Gould schon früh zu nutzen gewusst. Der technischen Herstellung, Nachbearbeitung, Montage usw. sind in keiner Musiksparte Grenzen gesetzt. Unendlich viel Pop1 gab und gibt es ausschließlich in Form artifizieller Studioproduktionen. Musiker wie Robert Wyatt, der seit zig Jahren keine Auftritte mehr absolviert, wären ohne das Tonstudio als Künstler schlichtweg inexistent. Andere Musiker und Bands wiederum, die durchaus aufwändige Studioaufnahmen produzieren, ziehen in der Live-Performance noch einmal ganz andere Seiten auf; die Musikwelt wäre deshalb eine ganz andere (und bedeutend ärmere), wenn Albert Ayler, James Brown, Grateful Dead, Rory Gallagher, Prince oder die Swans niemals vor Publikum aufgetreten wären.
In der Konzertmusik des 19. Jahrhunderts traten die Komponisten mitunter als Dirigenten, aber selten als Performer ihrer eigenen Werke in die Öffentlichkeit. In der Kunstmusik der Frühen Neuzeit jedoch, in der zudem die im und für den Moment geschaffene Improvisation hoch im Kurs stand (vgl. BAILEY 1987), war das anders. Und in der sog. Modernen und Elektronischen Musik verstehen sich viele Komponisten auch nicht etwa als bloße Schreibtischmusiker, sie nehmen aktiv in Echtsituationen an der Gestaltung ihre Musik teil (Stockhausen z.B. übernahm üblicherweise während der Aufführung seiner Werke die ins Geschehen massiv eingreifende Klangregie).
Auch das Starperformer-Phänomen hat in der Klassischen Musik seinen Ursprung und nicht, wie oftmals angenommen, im Jazz oder Rock. „O, I’d give anything to hear Caruso sing, said Mary Jane“ (JOYCE 2000, 200), heißt es in einer frühen Erzählung von James Joyce. Charismatische Sänger/innen, Instrumentalisten und „Wunderkinder“ ließen das Publikum im 19. Jahrhundert in die Konzerthäuser strömen, weil man die „Performer“ sehen und hautnah erleben wollte – in den Hintergrund trat, was sie aufführten. Das Bühnenereignis schob sich vor die Musik, beides bildete, neudeutsch, ein event. Das Rock- und Showbusiness hat daraus eine sich ständig überbietende Kultur der Attraktionen und Überwältigungen gemacht. Nicht wenige Musiker/innen klassischer Provenienz ziehen ihre Konzerte und ihr Marketing mittlerweile nach dem Vorbild von Showstars auf.
Die übliche Pop-Klassik-Binarität verdunkelt überdies die Tatsache, dass in der „populären Musik“ meistens völlig ungebrochen an Aufführungskonzepten des bürgerlichen Zeitalters festgehalten wird. Deshalb wunderte sich auch niemand, als die Einstürzenden Neubauten vom großen Bauch der Elbphilarmonie kurz nach deren Eröffnung völlig reibungsfrei aufgenommen wurden. Die Verbürgerlichung des Rock ’n’ Roll, die sich in der Chronik ihrer Aufführungsorte spiegelt, ist schon so alt wie die Rockmusik selbst, mindestens so alt wie Elvis Presleys erster Auftritt in Las Vegas, nein, viel älter. Auch im Jazz, und zwar nicht erst im smarten Lincoln Center Jazz eines Wynton Marsalis, und in den pompösen Schlagerkonzerten einer Helene Fischer überdauern mehr Versatzstücke der Kunstmusik des vorletzten Jahrhunderts, als in den Aufführungspraktiken von John Cage, Alvin Curran oder Helmut Lachenmann, die so gut wie alle Paradigmen und Rezeptionsformen europäischer Musikkultur umgemodelt haben.
Die Dichotomie von Popmusik und Klassischer Musik ist eine gedankenlose, trügerische Konvention, die sich von der Sache her nicht rechtfertigen lässt. Das wird noch einmal offenkundig, wenn man sich der Elektronischen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts zuwendet. Sollten beispielsweise „Sand“ von Philipp Jeck, „Black Vomit“ von Wolf Eyes, „Salt Marie Celeste – The Musical“ von Nurse With Wound oder „Endless Summer“ von Fennesz aus welchen Gründen auch immer Popmusik sein, dann müssten wohl (oder übel) Edgar Varèses „Poem Électronique“, Ligetis „Artikulation“ oder die „Cosmic Pulses“ von Karlheinz Stockhausen aus denselben Gründen auch dazu gerechnet werden. Damit hätten wir dann allerdings einen ultimativ weiten Begriff von Popmusik, der zu überhaupt keiner Differenzierung mehr taugt. Alles spricht deshalb für eine Nomenklatur, in der das Deutungsmuster Popmusik um einiges enger gefasst wird.