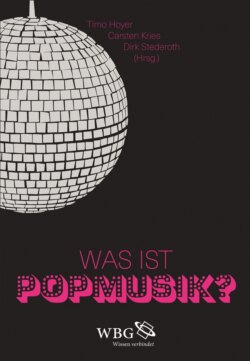Читать книгу Was ist Popmusik? - Группа авторов - Страница 17
Altern erlaubt – das Ruinöse wahrhaben
ОглавлениеIn seinem Aufsatz „Das Altern der Neuen Musik“ von 1956 hat Adorno das Verlöschen ihrer verstörenden, nonkonformistischen Impulse als Symptome des Alterungsprozesses von Neuer Musik gedeutet (ADORNO 1982b). Dies als Alterung zu bezeichnen, war etwas ungeschickt, da die Metaphorik des Alterns weder den von Adorno gemeinten Sachverhalt noch deren gesellschaftliche Ursachen einfängt. Aber wie so oft bei Adorno treffen selbst seine danebenliegenden Bemerkungen noch irgendwo ins Schwarze.
Seine Überlegungen zum schwindenden Widerstandspotential einst radikaler Musik werfen ungewollt ein Schlaglicht auf Popmusik (Pop2), die jene widerständigen Impulse, von denen Adorno in Bezug auf Neue Musik spricht, gar nicht verlieren kann, da sie keine davon besitzt. An der äußersten Polkappe des Pop2-Spektrums ist die Musik – gleichgültig wie überkandidelt juvenil oder potent sie daherkommt – immer schon, nach der Adorno’schen Metaphorik, „alte“ Musik: angepasst, zahnlos, bald vergessen. Manche Pop-Stücke freilich sind zum ewigen Altsein verdammt: Untote, Evergreens genannt, die in dieser Sprachlogik besser Everbrowns heißen müssten.
Popmusik, die dazu verdammt ist, Leichtfüßigkeit zu demonstrieren, bekommt auch ein Problem mit dem biologischen Alter der Musiker. Deren jugendliche Leichtigkeit und exaltierte Bewegungslust schwinden irgendwann dahin, sollen aber bitteschön bis zum bitteren Ende echt und glaubwürdig verkörpert werden. Das System ist unerbittlich, Alte und Schwache, die einem das Jungsein nicht mehr vormachen können, werden ausgesiebt. Man kennt dies Phänomen auch aus anderen Popkulturen. Günther Anders hat schon vor über einem halben Jahrhundert beobachtet, dass Schauspielerinnen in Hollywood genötigt werden, den Weg allen Fleisches schamhaft zu verbergen. Diese „erbärmlichen Gespenster“, schreibt er giftig, und man muss unwillkürlich an die Nicole Kidmans unserer Zeit denken, „die vergeblich versuchen, ihren Großaufnahmen gewachsen zu bleiben“ (ANDERS 1956, 191).
„Forever Young – I Want To Be Forever Young“ (Alphaville). Das Showgeschäft lebt diesen Wunsch allzu oft als Lüge. „Rock Me Baby Like My Back Ain’t Got No Bones“ sang B.B. King noch im Greisenalter, und selbst dieser Ausnahmekünstler hatte Schwierigkeiten, dabei nicht lächerlich zu wirken. Udo Jürgens wollte noch 2014 auf seinem 53. Album glauben machen, er stünde „Mitten im Leben“, dabei stand er auf der Schippe des Todes. Peter Kraus darf nicht altern, Jürgen Drews darf nicht altern, Angus Young darf nicht altern… Die Rolling Stones treten seit langem nur noch als fossile Schauspieler ihrer vormaligen Virilität auf. Der Buena Vista Social Club vermarktet das hohe Alter folkloristisch als südamerikanische Lebensfreude. Kurzum, erbärmliche Gespenster wohin man schaut.
Sänger und Sängerinnen trifft das Verbot zu altern besonders schwer – darunter hatte schon die Callas zu leiden –, weil sich die Lebenszeit auf die Stimmbänder niederschlägt, für die es, soviel ich weiß, noch keine Plastische Chirurgie gibt. Manche ins Alter kommende Stimmen, vorwiegend männliche, haben Glück: Dem verwitterten Gesang von Bob Dylan, Billy Gibbons oder dem von Johnny Cash der „American“-Ära ist das Alter zwar deutlich anzuhören, doch die gerontischen Stimmen werden nicht mit physiologischem Niedergang in Verbindung gebracht, sondern als authentisch empfunden. Diese abiträre Assoziation – warum sollten brüchige Stimmen gefühlsechter sein als glockenklare? – rettet die Sänger. Aber man stelle sich eine Band vor, in der alle Musiker ihre Instrumente so krächzend spielen würden, wie Bob Dylan oder der ZZ Top-Gitarrist mittlerweile singen. Die Gruppe wäre auf dem Popmarkt verloren, dafür hätte sie allmählich Chancen, als Antipop durchzugehen.
Antipop scheut nicht die Vergänglichkeit, er will den Verfall in allen Schattierungen buchstäblich wahrhaben. Das Altern gehört dazu, denn Altern ist letzten Endes ruinös. Antipop sucht musikalische Lösungen, nicht nur Worte, sondern Formen, Strukturen, Klänge, um die nachlassende Kraft, die Krankheit, die Schwäche, den Schmerz, die Zerstörung, das Sterben hörbar und erfahrbar zu machen. Manche Musiker/innen finden darin sogar ihr Lebensthema. Lydia Lunch und Diamanda Galás etwa haben sich ganz und gar dem Ruinösen, in Gestalt von Tod, Krankheit, Gewalt, Leid und Völkermord verschrieben und dabei das Songformat und das vokale Ausdrucksspektrum in ungeahnte Richtungen erweitert. Der japanische Musiker Keiji Haino ist ebenfalls beispielhaft: Seit vielen Jahrzehnten lässt er keinen beschwichtigenden Ton zu. Oder Stephen O’Malley, dessen sinistre Projekte – Burning Witch, Khanate, KTL, SunnO))) uam. – das Ruinöse beschwören, bis es schmerzt.
Lunch, Galás, Haino, O’Malley geben sich zumeist ostentativ düster, was sich in ihren Bühnenauftritten, in der graphischen Gestaltung ihrer Alben und den Songtiteln niederschlägt. Aber Antipop, der vorm Ruinösen nicht die Augen verschließt, muss deshalb nicht auf Teufel komm raus nachtaktiv sein. Braxton hält seine Stücke und seine Auftritte frei von eindeutigen Denotationen und plakativen Impressionen. Von Anfang an hat er seinen Werken abstrakte graphische Titel und Nummern gegeben, aber keine Songtitel, keine Namen, die irgendeine bestimmte Stimmung evozieren. Das Ruinöse ist bei ihm ein selbstverständlicher Bestandteil eines insgesamt freundlichen, taghellen musikalischen Universums, das keinen Anfang, kein Ende, keinen Stillstand kennt. Seine Musik ist so etwas wie vertonte Entwicklung, bei der man niemals weiß, woher sie kommt und wohin sie führt: musikalische Linien, Schichten und flirrende Konstellationen, die unentwegt entstehen, sich aufbauen, verknüpfen und verknoten, transformieren, abbrechen, ins Leere laufen, wieder auftauchen, auch in gegenläufiger und paralleler Bewegung, aber selten, sehr selten linear: ein Deleuze/Guatarri’sches Rhizom, dem man beim Wachsen zuhören kann. Allein Braxtons umfangreiches Werk für unbegleitetes Altsaxophon enthält – neben vielem anderen – vom kreischenden Schrei bis zum dahinsiechenden Hauch ein gültiges Klangvokabular ruinösen Ausdrucks, doch keine Bitterkeit, keine Morbidität, keine Grabesstimmung, dafür viel Humor.
Dabei steht dem heute Zweiundsiebzigjährigen stets vor Augen, dass seine Produktivkraft ihrem natürlichen Ende entgegengeht. Man kann für seine musikalische Arbeit der vergangenen fünf bis zehn Jahre ruhig den abgegriffenen Ausdruck des Alterswerks heranziehen, sollte allerdings nichts Schrulliges, Mildes oder Betuliches erwarten, denn nichts liegt Braxton ferner. Von einem Alterswerk zu sprechen macht gleichwohl Sinn, weil Braxton dem Umstand der limitierten Schaffenszeit und dem Sachverhalt des eigenen Alterns reflektiert Rechnung trägt – in Form von Reduktion, Retrospektion und Finalisation. Die meiste Zeit und Kraft investiert Braxton seit ein paar Jahren in die Fertigstellung seiner Opern-Dodekalogie Trillium, die sein Gesamtwerk in gewisser Weise krönt (vgl. YOUNG 2016). Daneben widmet er sich, völlig nostalgiefrei, der konzeptionellen Rückbesinnung. In seiner 2009 erstmals aufgeführten Echo Echo Mirror House Music spielt Braxton wortwörtlich mit der eigenen künstlerischen Vergangenheit, indem er noch nicht dagewesene Strategien der musikalischen Interaktion erschließt: Übereinander geschichtete Ausschnitte seiner auf iPods gespeicherten Studio- und Liveaufnahmen werden über ein geregeltes Zufallsprinzip zum kakophonischen Resonanzraum für spontane musikalische Interaktionen (vgl. TESTA 2016). Früher hätte er mit diesem waghalsigen Konzept bestimmt die Welt bereist, aber das kommt nicht mehr in Frage. Er hat seine öffentliche Präsenz und die Zahl seiner Konzertauftritte zuletzt auf wenige Stippvisiten eingeschränkt. Das ist sowohl ein Tribut ans Alter als auch eine logische Folge seiner Prioritätensetzung: opera first! Zuvor hatte er bereits damit begonnen, die beeindruckende Spannbreite der von ihm in früheren Jahren beherrschten Blasinstrumente (alle möglichen Saxophone, Klarinetten und Flöten) auf einen überschaubaren Kern (meistens Alt-, Sopran- und Sopraninosaxophon) zu reduzieren. Diese Selbstbeschränkung auf einen kleineren Kompetenzbereich korrespondiert mit stilistischen und technischen Veränderungen im Saxophonspiel Braxtons. Der satte, kraftstrotzende Sound und das eruptive, sprunghafte, unendlich variantenreiche Spiel der siebziger und achtziger Jahre haben einem eher filigranen, fragilen Klang und quirlig-schrillen Tonkapriolen Platz gemacht. Unverkennbar ist damals wie heute ein und dasselbe Energiebündel am Werk, aber eben in verschiedenen Abschnitten des Lebens.
So lässt sich die hier erörterte Figur in zwei Sätze zusammenfassen: Indem sich Antipop immer wieder aufs Neue am Ruinösen abarbeitet, bleibt er musikalisch jung. Dafür ermöglicht er den Musikerinnen und Musikern, würdig und eigensinnig zu altern.