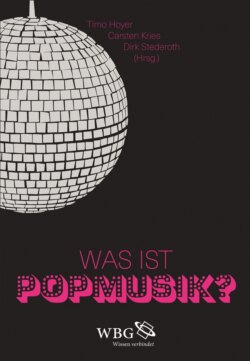Читать книгу Was ist Popmusik? - Группа авторов - Страница 19
Unberechenbar – Standardabweichungen
ОглавлениеAntipop definiert sich nicht über bestimmte Genre-Muster, kann aber darauf zurückgreifen oder daraus hervorgehen. SunnO))) spielen Antipop und rekurrieren dabei auf Doom Metal und Black Metal. Diamanda Galás rekurriert auf Blues, Gospel und die Songform, Hank Williams III auf Country, Jackie-O Motherfucker auf Folk, Braxton auf Jazz. Dabei geht es in keinem Fall um die Einhaltung oder Erfüllung idiomatischer Vorgaben. Viel eher kreiert Antipop eigene Idiome. In der unermüdlichen Gestaltung von Musikkonzepten ist Braxton erneut eine Ausnahmeerscheinung. Jedes seiner weiter oben genannten Musikmodelle ähnelt allein sich selber (vgl. WOOLEY 2016).
Sämtliche Bauelemente, aus denen die musikalische Form besteht (Rhythmus, Melodie, Harmonie etc.), nutzt der Antipop sozusagen als Rohmaterialien, die je nach Intention, Expertise und Gelegenheit in Ordnungs- oder Unordnungsstrukturen gebracht werden. Die Formen, die dabei entstehen, sind nicht beliebig – Antipop-Künstler/innen folgen gerne einem System, dem jeweils eigenen –, aber im Prinzip unvorhersehbar. Auf nichts ist Verlass, mit allem muss jederzeit gerechnet werden. Deshalb sind im Antipop offene oder wenig determinierte Gestaltungsformen – Improvisation, Intuition, Aleatorik – häufig in Gebrauch. Ein erheblicher Reiz von improvisierter, intuitiver und aleatorischer Musik besteht in der Erwartung des Unerwarteten. Braxtons Wort dafür lautet: looking for a „surprise“. Auf Überraschungen legt er als Performer und Komponist höchsten Wert; sie halten die Aufmerksamkeit wach und verhindern, dass Spiel-, Denk- und Hörroutinen Überhand nehmen.
Bricht der Rhythmus im nächsten Augenblick ab, finden die Geräusche zu einer Form, die Bruchstücke zu einer Gestalt, oder umgekehrt, wird aus der Form Geräusch, aus der Gestalt Fragment? Wird die Melodie fortgeführt, wiederholt oder verliert sie sich von einem Moment auf den anderen? Dauert das Stück wenige Sekunden, stundenlang oder eine Ewigkeit, kehrt es zum Ausgangspunkt zurück oder ist es schon Übergang zu etwas Anderem? Gleicht die zweite Aufführung eines Werkes der vorhergehenden, oder überrascht sie mit Ungehörtem? Je mehr Fragen dieser Art ein Werk aufwirft, desto unberechenbarer ist es – und je unberechenbarer es ist, desto näher kommt es Antipop. Durch und durch Überraschendes lässt sich im Übrigen schwer verkaufen. Das wissen jene Musiker am besten, die mit Antipop ihr Brot verdienen, z.B. der Trompeter Peter Evans: „How do you sell somebody an improvised solo or band act if the whole idea is ‚yeah, you know, don’t worry, next time is going to be completely different‘. How do you sell that?!! In a way it’s amazing that we are able to get paid […], because it seems to be so contradictory to the whole idea of selling stuff as we know it in our society“ (IRABAGON/EVANS 2014).
Um der Unberechenbarkeit (nicht der Planlosigkeit) und den Überraschungen (nicht der Beliebigkeit) breiten Raum zu geben, hat Braxton raffinierte Strategien entwickelt. In seinen Orchesterwerken arbeitet er seit längerem mit zwei oder drei Dirigenten, die simultan das Ensemble leiten, wobei sie zugleich Akteure und spontane Co-Autoren der Stücke sind. Sie entscheiden während der kontinuierlichen Aufführung unabhängig voneinander, welche Kompositionen oder Kompositionsfragmente zusätzlich zu der jeweiligen Primärkomposition gespielt werden, sie bestimmen, in welchem Zeitraum dies geschieht, und wer aus dem Ensemble daran beteiligt ist (vgl. BROOMER 2009, 107ff.). Die meisten Partituren Braxtons besitzen ferner ausgefuchste Interpretations- oder Überraschungsspielräume: graphische Notationen und kryptische Zeichen, verschiedene Codes, die auf unterschiedliche Art zur Improvisation auffordern (s. Abb. 1).
Abb. 1: Anthony Braxtons Composition No. 366c. ©Anthony Braxton/Tri-Centric Foundation.
Extrem interpretationsoffen sind auch die zwölf formalen Typen seiner Language Music (vgl. WILSON 1993; WOOLEY 2016). Darunter versteht Braxton „primary sound categories“, die er in seine Kompositionen einflechtet: Long Sounds, Trills, Short Attacks, Multiphonics, Gradient Formings etc. Dieses Vokabular dient der Strukturierung seiner Musik, aber es wird von jedem Performer und in jeder Performance unterschiedlich übersetzt. Dadurch ist sichergestellt, dass keine Aufführung in Form und Farbe einer anderen gleicht. Mehr Antipop geht nicht! Weder die Musiker/innen noch das Publikum steigen sozusagen zweimal in denselben Fluss. Das wäre nach Heraklits Panta rhei-Doktrin ja ohnehin unmöglich, doch davon will Pop2, der auf Wiedererkennung und Wiederholbarkeit beruht, nichts wissen.
So erklärt sich auch, weshalb eingängige, leicht zu merkende Melodien in der Popmusik von unverzichtbarer Bedeutung sind: Sie sorgen für den Mnemoeffekt. Antipop ist zwar nicht notwendigerweise melodielos oder unmelodisch – Stockhausens Monumentaloper Licht und Braxtons ebenso monumentaler Opernzyklus Trillium etwa stecken voller Melodien, Braxtons Ghost Trance Music basiert auf lang andauernden, schroffen Melodielinien usw. Doch dem Diktat liedhaft-einprägsamer Melodien, die zum Mitsummen einladen, entzieht sich Antipop. Er ist ein eher unfruchtbares Milieu für Ohrwürmer oder Evergreens. Nicht einmal signature tunes, die ebenfalls wiedererkannt sein wollen, können auf ständig fließendem Untergrund längere Zeit bestehen.
Wenn es eine mnemotechnische Qualität beim Antipop gibt, dann resultiert sie aus dem, was Susan Sontag Stil genannt hat. „Der Stil eines Künstlers ist, technisch gesehen, nichts anderes als das besondere Idiom, in dem er die Formen seiner Kunst entfaltet“ (SONTAG 1982, 44). An ihrem Individualstil sind Antipopkünstler/innen zu erkennen und wiederzuerkennen. Sie entwickeln je eigene Vokabulare, Gesetzmäßigkeiten, Symbolwelten und Mythologien. Deshalb stoßen sie nicht nur beim „breiten“ Publikum auf Unverständnis. Antipop muss, selbst den Eingeweihten, hier und da unverständlich sein oder mit der Zeit wieder unverständlich werden, sonst wäre es kein Antipop.
Was geschieht nun, wenn diese notorische Eigengesetzlichkeit auf eingeführte musikalische Formen, überlieferte Muster und Konventionen stößt? Von einem unbeirrbaren Systemtüfftler wie Braxton erwartet man vielleicht nicht, dass er sich dieser Herausforderung mit großer Beharrlichkeit stellt. Doch auch in dieser Hinsicht folgt er seiner eigenen Marschroute, und die führte ihn schon wiederholt zur grundlegenden Neubewertung von Jazzstandards (vgl. BROOMER 2009, 85ff.). Er nennt diese Auseinandersetzung mit traditionellem Material „Urlaub vom eigenen System“ (vgl. HOYER 2006). Aber hinter diesen Ausflügen steckt mehr als ein Erholungsbedürfnis, nämlich Bekenntnis zur musikalischen Herkunft, Reflexion bewährter Strukturen, Liebesbekundung, Selbstvergewisserung. In einer seiner jüngsten Veröffentlichungen widmet er sich auf sieben CDs den Kompositionen und der Schule Lennie Tristanos (Quintet [Tristano] 2014, New Braxton House 905), und das bereits zum dritten Mal! Von Andrew Hill, Thelonius Monk und Charlie Parker gibt es von ihm ebenfalls Einzelporträts; und gemischtes Jazzrepertoire hat Braxton schon in so großer Zahl eingespielt, dass sein Urlaubsanspruch für die nächsten zwanzig Jahre verwirkt sein müsste.
Seine Standardbearbeitungen lassen eine für den Antipop charakteristische Einstellung erkennen: Bestehende Struktur- und Formvorgaben werden als unverbindlich angesehen, sie können umgewälzt, in ihre Einzelteile zerlegt, lediglich angedeutet oder beiseite geschoben werden. 2003 und 2006 hat Braxton für seine Verhältnisse überraschend konventionell einen Haufen Jazzstandards aufgeführt. Jeden Abend wurde ein vollständig anderes Repertoire gespielt, die Probezeit war bewusst knapp kalkuliert, beides sollte die Verfestigung von Routinen unterbinden. Auf nicht weniger als 18 CDs (Leo Rec. und Amirani Rec.) sind die bravourösen Resultate festgehalten. Das übliche Jazzschema (Head, Improvisationen, Head) wurde selten angetastet, auch die Verteilung der musikalischen Rollen folgte der gewohnten Hierarchie (Leadinstrumente, Rhythmusgruppe).
Warum kehrte Braxton in den überholten Regelkreis des Jazz zurück? Warum legte er sich freiwillig die von ihm schon hundertfach gesprengten Fesseln der standardisierten Form an? Beide Fragen sind falsch gestellt, und genau das machen diese Konzerte klar. Braxton kehrt nicht ins Überholte, Hintersichgelassene zurück, weil er in Bezug auf die ästhetische Form Vorstellungen von Vorwärtskommen, Verbesserung und Fortschritt ablehnt (vgl. BRAXTON 1985, 184f.). Die Annahme einer eingeschriebenen „Tendenz des Materials“, die Adorno und Hindrichs in der (von ihnen rezipierten) Musik zu erkennen glauben, ist ihm fremd. Solche Fortschrittsideen gehen von einem geschlossenen Paradigma aus – grob: europäische Kunstmusik –, das einem inhärenten Bewegungsgesetz unterliege. Dieses „Material“-Verständnis und die eurozentrisch verengte Sicht bewegen sich auf der Linie der von Braxton kritisierten „present day interpretation about world creativity“, wie sie die „established western educational institutions“ verbreiten (ebd., 149). Das darin zutage tretende Fortschrittsdenken widerspricht zudem dem nichtlinearen Zeitverständnis, dem Braxton als Komponist Ausdruck zu verschaffen sucht, indem er die drei Dimensionen der Zeit in ihrer Gleichzeitigkeit erfasst: „That is to say, PAST–PRESENT–FUTURE is approached as one unit of measurement“ (BRAXTON 2015, 3). Braxton unterscheidet drei gleichwertige Umgangsweisen mit musikalischer Überlieferung: Bewahrung („traditionalism“), Verfeinerung („stylism“) und Veränderung („restructuralism“) (vgl. LOCK 1988, 162f.; FORD 1997, 57ff.). Es versteht sich von allein, dass er sich auch als Standardinterpret in erster Linie als Restrukturalist begreift. Aber damit erklärt er die beiden anderen Ansätze, die auf Erhalt und Fortführung wertlegen, nicht für reaktionär, unzeitgemäß, überflüssig oder falsch.
Sein Standardspiel hat auch nichts mit Fesselung zu tun, weil Braxton über die Formgesetze, die er befolgt, in bester Antipop-Manier, selbstbewusst verfügt (auch in besagten Einspielungen wird noch reichlich gegen den Strich gebürstet, also restrukturiert). Die Quartett-Aufnahmen von 2003 und 2006 strahlen ein lässiges Freiheitsgefühl aus, das heutzutage so manchem routiniert vorgetragenem Free Jazz fehlt, weil sich dieser, mit einer Formulierung von Botho Strauß, der „Anstrengung der hohen Konvention“ (STRAUSS 1984, 361) entzieht. In jeder Minute lassen Braxtons Einspielungen durchblicken: Die Musiker könnten auch ganz anders, aber sie wollen nicht.
Für solch einen völlig anderen, nämlich radikal dekonstruktiven Umgang mit bestehenden Formen bietet Braxtons Werk bekanntlich Beispiele in Hülle und Fülle. 1971 etwa spielte er in Paris auf dem Altsaxophon Duke Ellingtons melancholische Komposition „Come Sunday“ ein (Recital Paris 1971, Futura Ger 23). Die halbstündige solistische Exkursion des Fünfundzwanzigjährigen hört sich an, als wolle er die schöne Schale des Stückes rüde durchbrechen, um sich in den dionysischen Irrwitz zu versenken, der darunter verborgen liegt. Am Ende taucht er wieder auf, alles ist, wie es war, aber das scheint nur so: Einmal als Fassade enttarnt, ist die schöne Form nicht mehr dieselbe. Was haben wir davon zu halten? Eine Respektlosigkeit, eine Exekution, ein Frevel? Wer die ursprüngliche Gestalt von „Come Sunday“ für sakrosankt hält, muss wohl so empfinden. Wer sie dagegen als eine überlieferte Vorlage wertschätzt, die zur Auseinandersetzung einlädt, kann sich im Umgang mit ihr ohne schlechtes Gewissen alle Freiheiten nehmen. Braxton ist so frei. Der Antipop auch.