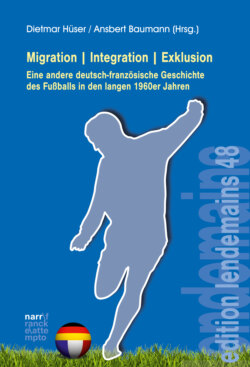Читать книгу Migration|Integration|Exklusion - Eine andere deutsch-französische Geschichte des Fußballs - Группа авторов - Страница 10
Ausgangsüberlegungen und Vergleichsprämissen
ОглавлениеSchon aus der allgemeinen Skizze zum aktuellen Stand der Fußball- und Migrationsforschung lässt sich ableiten, dass es längst an der Zeit wäre, Arbeitsmigranten der langen 1960er Jahre, die damals im bestehenden bundesdeutschen bzw. französischen Vereinswesen oder in selbst begründeten Clubs Fußball gespielt haben, näher in den Blick zu nehmen. Geschehen müsste dies freilich fernab statischer Assimilations- und einseitiger Integrationsmodelle, fernab abstrakter Prinzipien und starrer Leitbilder. Fernand Braudel hatte in seinem Spätwerk darauf aufmerksam gemacht, dass viele Schwarz-Weiß-Malereien um die Begriffe Assimilation, Integration und Eingliederung schlicht die gelebte Realität migratorischer „mariages culturels“ verschleierten.1 Solche Realitäten am fußballerischen „vécu anthropologique“2 der Betroffenen im Breiten- und Amateursport zu dokumentieren, könnte im Ergebnis ein Bild ebenso komplexer wie dynamischer, eher konfliktueller oder konsensualer Kulturkontakte jenseits klassischer Bipolaritäten entstehen lassen, das Zwischen- oder "dritte Räume" im Sinne Homi Bhabhas aufdeckt. Eine solche Herangehensweise böte Chancen, in den sozialen und kulturellen Praktiken des Fußballspielens und in dessen gesellschaftlichem Umfeld zeitgleiches Annähern und Absetzen, zeitgleiches Dazugehören und Fremdfühlen, zeitgleiches Integrieren und „Eigensinnig-Sein“ von Zuwanderern greifbar und zeigbar zu machen.3
Mit Blick auf den Freizeit- und Amateursport müsste es konkret darum gehen, nach der Relevanz fußballerischer Aktivitäten für Strategien, Spielräume und Entwicklungswege von Migrantengruppen in beiden Ländern zu fragen: Lassen sich die Folgewirkungen sportlicher Betätigung ausländischer Arbeitskräfte tatsächlich uneingeschränkt als integrationsförderlich bewerten, wie dies Politik- und Verbandsdiskurse allenthalben suggerieren? Oder sind nicht vielmehr – neben möglichen positiven Effekten: dem Aufbau sozialer Bindungen etwa, auch dem öffentlichen Wertschätzen sportlicher Leistungen einzelner Spieler oder ganzer Teams – auch gegenteilige Erlebnisse zu beobachten und negative Konsequenzen bilanzierend in Rechnung zu stellen: Benachteiligung und Ausgrenzung etwa, stereotype Fremdzuschreibungen und Rassismus oder auch radikal verschärfte nationale Chauvinismen in sportlichen Wettbewerbs- und Konkurrenzsituationen auf und neben dem Spielfeld?
Zudem käme es unter vergleichsgeschichtlichen Gesichtspunkten darauf an, angesichts divergierender Einwanderungstraditionen und politisch-kultureller Verfasstheit deutsch-französische Ähnlichkeiten und Unterschiede auf den Punkt zu bringen, gerade was mehrheitsgesellschaftliche Perzeptions- und Reaktionsmuster anbelangt. Tatsächlich kann Frankreich auf eine deutlich längere Vorgeschichte zurückblicken. Anders als Deutschland war es bereits im 19. Jahrhundert ein Einwanderungsland, das stets auf der Suche nach Arbeitsmigranten*innen war und mit dem gesetzlichen Einführen des Territorialprinzips den Kindern ausländischer Eltern bei Volljährigkeit die französische Staatsangehörigkeit verlieh.4 Damit einher ging seit den 1880er Jahren ein generalisiertes Selbstverständnis, das ganz im Sinne des republikanischen Modells umstandslos davon ausging, es müsse für Menschen aus Migrationskontexten – wie auch für regionale Minderheiten im Land oder auch autochthone Bevölkerungsgruppen in den Kolonien – ein Leichtes sein, sich über kurz oder lang, unabhängig von geographischer Herkunft und kulturellem Rucksack, gänzlich in das nationale Ganze einzupassen. Da in der République une et indivisible solche Grundhaltungen noch in den langen 1960er Jahren kaum ernsthaft zur Debatte standen, zeitgleich die Bundesrepublik faktisch Einwanderungsland wurde, ohne sich aber als solches zu verstehen,5 konnten die deutsch-französischen Gräben auf der Ebene dominanter Diskurse und Selbstbilder kaum breiter ausfallen.
Nichtsdestotrotz – und gerade auf der Folie solcher zeitgenössischer „Selbstverständlichkeiten“ – bleiben mehrere wichtige Fragen unbeantwortet: Verweist nicht die konkrete soziale und kulturelle Praxis des Fußballspielens und Vereinslebens auf eine durchaus vergleichbare Komplexität und Vielschichtigkeit damaliger Vor-Ort-Verhältnisse sowie auf ein Mehr an analogen Repräsentationen und Reaktionen als es das stete Betonen nationaler Traditionen und Besonderheiten nahelegt? Liefern fußballspielende Einwanderer nicht relevante Aufschlüsse über den Umgang mit Fremdem im Zeichen von „Wirtschaftswunder“ und „trente glorieuses“, auch über Distanz und Differenz im gesellschaftlichen Liberalisierungsgrad zwischen beiden Ländern? Näher zu überprüfen wäre in diesem Kontext die gern geäußerte Annahme, Frankreich müsse damals wegen verinnerlichter republikanischer Wertbestände und „einer längeren Tradition politischer und gesellschaftlicher Liberalität“ per se das tolerante Land gewesen sein.6