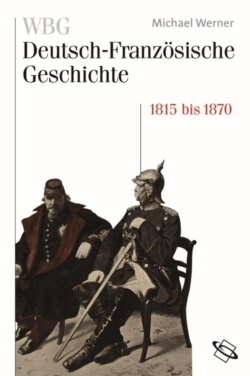Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. IV - Guido Braun - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Französische Reichsstandschaft?
ОглавлениеIn den Kontext der französischen Wahlpolitik gehören die um 1658 erneut intensivierten französischen Überlegungen, Ludwig XIV. aufgrund seiner territorialen Erwerbungen im Westfälischen Frieden selbst den Status als Reichsstand zu verschaffen. Das implizierte jedoch ein Vasallitätsverhältnis des Königs zu Kaiser und Reich, dessen Zulässigkeit von französischen Juristen und Publizisten nicht uneingeschränkt akzeptiert wurde. Doch auch der König von Spanien und seit dem Westfälischen Frieden die Königin von Schweden hatten aufgrund ihrer deutschen Besitzungen die Reichsstandschaft inne. Die französische Haltung zu diesem Problem war starken konjunkturellen Entwicklungen unterworfen49. Die kaiserliche Offerte vom Mai 1646, die drei lothringischen Hochstifte Metz, Toul und Verdun und Teile des Elsass zu souveränem Besitz zu nehmen, hatte die über die verwickelte Rechtslage im Elsass seinerzeit bereits gut unterrichtete französische Regierung unvorbereitet getroffen und anfänglich Misstrauen erweckt, weil die Kaiserlichen die Souveränität von sich aus anboten. In den folgenden Jahren bis zum Friedensschluss wurde innerhalb der französischen Delegation in Münster und in den Pariser Regierungskreisen intensiv und kontrovers das Problem erörtert, ob Ludwig XIV. das Elsass und die lothringischen Diözesen50 lieber zu Lehen (feudum) oder zu einem der französischen Krondomäne inkorporierten Allodium nehmen sollte. Für die uneingeschränkte Souveränität und das vollständige Ausscheiden der betreffenden Territorien aus dem Reichsverband schien neben der höheren Reputation vor allem die größere Sicherheit zu sprechen, dass die Erwerbungen nicht eines Tages wieder ganz an das Reich verloren gingen. Für die Reichsstandschaft sprach dagegen die Möglichkeit, eine eigene Reichstagsvertretung durchzusetzen und damit dauerhaften Einfluss auf die Entscheidungsfindung dieses zentralen legislativen Reichsverfassungsorgans zu erhalten51, dessen Wert die Franzosen für die eigene Deutschlandpolitik im 17. Jahrhundert (anders als im 18. Jahrhundert) hoch veranschlagten52. Sie taten dies zwar bereits vor 1648, verstärkt jedoch, seit sich 1663 der Regensburger Reichstag zu einem immerwährenden Deputiertengremium wandelte. Dies geschah zunächst eher zufällig – aufgrund der Vielzahl der schwer lösbaren Verhandlungsmaterien und daraus resultierender Unfähigkeit, einen allgemeinen Reichsschluss zu verabschieden –, dann aber auch in der Konsequenz der umfassenden Kompetenzzuschreibungen, die 1648 vollzogen worden waren. Mit der Frage nach der französischen Reichsstandschaft waren daher auch abweichende Konzeptionen des französischen Verhältnisses zum Reich nach dem Friedensschluss verbunden. Für die französische Annahme der kaiserlichen Souveränitäts-Offerte war letztlich die Position des 1648 allein in Münster verbliebenen Unterhändlers Servien entscheidend. Doch mit der Vertragsunterzeichnung war die Diskussion in den französischen Regierungskreisen keineswegs abgeschlossen, zumal der französische Botschafter in einer kurz vor der Unterfertigung aus Paris abgegangenen Weisung instruiert worden war, eventuell der Reichsstandschaft zuzustimmen. In den internen Überlegungen spielten im Laufe der 1650er und 60er Jahre immer wieder die gleichen Argumente eine Rolle, die schon in den Denkschriften des Jahres 1646 festgehalten worden waren53. Letztlich war diese Frage für die französische Seite ein gordischer Knoten. 1668 bezeichnete Ludwig XIV. zwar selbst im Nachhinein die Reichsstandschaft als die bessere Lösung, die in Münster verpasst worden sei54. Aber auch im Frieden von Aachen 1668 nahm er die spanischen Abtretungen im niederländischen Raum wiederum nicht zu Reichslehen. Das diplomatische Ränkespiel um die Sicherung der Vorteile einer Reichsstandschaft für Frankreich war für die deutsch-französischen Beziehungen über das tagespolitische Geschäft hinaus auch von grundlegender Bedeutung. Von der Lösung dieser Frage hing ab, inwieweit sich der französische König einerseits dauerhaft und irreversibel in die inneren deutschen Fragen einschalten und andererseits Territorien regieren würde, die der Lehenshoheit des Reiches und der Jurisdiktion der beiden obersten Reichsgerichte, des Reichskammergerichts und des Reichshofrates, unterstünden. In letzter Konsequenz ging es also darum, ob sich durch eine institutionelle Vernetzung die deutsche und die französische Geschichte noch stärker durchdringen würden, als dies ohnehin schon der Fall war.
Die Kaiserlichen haben diese Frage seit 1646 durchweg mit einem entschiedenen Nein beantwortet, weil sie von einer französischen Reichsmitgliedschaft vor allem eine Beschneidung des eigenen politischen Einflusses auf die Reichsstände erwarteten. Aufgrund der Inkonsequenz der französischen Haltung setzten sie sich in dieser Frage bei den Friedensverhandlungen in Westfalen und in den folgenden beiden Jahrzehnten mit ihrer klaren und beständig verfochtenen Position durch, die Frankreich unbedingt den Zutritt zum Reichstag und damit erweiterte Interventionsmöglichkeiten in die innerdeutschen Verhältnisse verstellen wollte. Die Reichsstände änderten dagegen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ihre Haltung grundlegend: Bis 1648 hatten viele von ihnen aus Solidarität mit den von den Abtretungen an Frankreich direkt oder indirekt betroffenen Ständen nachdrücklich den Verbleib der Territorien im Reichsverband betrieben und sich deshalb am 22. August 1648 sogar schriftlich unmittelbar an Ludwig XIV. gewandt. Unter dem Eindruck des Gefahrenpotenzials, das Frankreich nicht zuletzt wegen seiner Kriegführung im spanisch-niederländischen Raum darstellte, schwenkten viele Reichsstände jedoch in den 1650er und 60er Jahren zunehmend auf die kaiserliche Position ein.