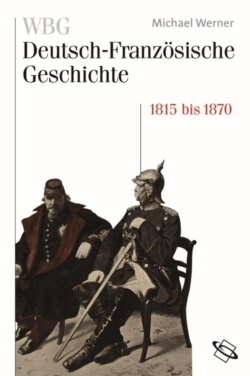Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. IV - Guido Braun - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Elsass und Straßburg nach 1681
ОглавлениеDas Elsass wurde umgehend infrastrukturell integriert. Es wurde nicht zuletzt in den Vauban’schen Festungsgürtel einbezogen, mit dem Frankreich seine Ostgrenze sicherte, und erhielt neue Verwaltungsstrukturen (Intendantenamt, königliches Prätorenamt in Straßburg etc.). Dennoch behielt das Elsass bis zum Ende des Ancien Régime eine vor allem kulturell-linguistische Sonderstellung. Zudem blieb es als province à titre étranger durch eine Zollgrenze vom restlichen Frankreich getrennt. Erstaunlich rasch vollzog sich die Eingliederung der administrativen Eliten und ihre Umfunktionierung zu einer dem Königtum gegenüber politisch loyalen, integrativen Kraft. Die administrativen Eliten gliederten nicht nur die neue Provinz ein, sondern wurden für die Monarchie zunehmend auch im diplomatischen Dienst tätig, da sie über hervorragend in Fragen des Reichsrechts ausgebildetes Fachpersonal verfügten78. Diese Karriere setzte allerdings die Konversion voraus. Gerade im konfessionellen Bereich waren – abgesehen von der Sphäre des Politisch-Rechtlichen – mit dem Beginn der französischen Herrschaft über Land und Leute des Elsass auch die am weitesten tragenden Umwälzungen verbunden: Straßburg war 1681 eine überwiegend lutherische Stadt, während sich 1789 die Mehrheit der Stadtbevölkerung zum katholischen Glauben bekannte. Ein augenfälliges Beispiel für die gelungene Elitenintegration ist die Biographie Ulrich Obrechts, der bereits 1685 königlicher Prätor in Straßburg wurde79.
Während die französische Herrschaft im Elsass insgesamt zu einer territorialen Vereinheitlichung führte, bildeten sich in Straßburg neue sprachliche, soziale und konfessionelle Differenzen heraus. Die königlichen Prätoren, Intendanten und Kommandanten repräsentierten fortan die Macht des Sonnenkönigs. Ihre Salons sowie der prachtvolle Hof, den die vier Straßburger Kardinäle aus der hochadligen Familie de Rohan von 1704 bis 1801 in der elsässischen Hauptstadt und im Zaberner Schloß unterhielten, bildeten den glänzenden Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens und machten den elsässischen Adel mit der französischen Adelskultur vertraut. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts schloss der elsässische Adel seine gesellschaftliche und sprachliche Integration weitgehend ab. Obwohl die konfessionelle Differenz die vollständige Integration des elsässischen Feudaladels bis zum Vorabend der Revolution verhinderte, gelang seine Anpassung an den Lebensstil des französischen Adels, namentlich über die Armee und Eheschließungen, insgesamt weitaus rascher und besser als die Akkulturation des elsässischen Bürgertums. Die Französisierung der Elsässer verlief in den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten sehr unterschiedlich. Das von den Sprösslingen der bürgerlichen Straßburger Elite frequentierte lutherische Gymnasium nahm den französischen Sprachunterricht erst 1751 in seinen Lehrplan auf, während die katholischen Bürger und die zugereisten französischen Beamten ihre Kinder auf das französischsprachige, jesuitische Collège royal schickten. Das konservative, alteingesessene Volk lutherischen Bekenntnisses bewahrte seinen Dialekt und seine Traditionen, es bildete jedoch am Vorabend der Französischen Revolution aufgrund von Konversionen und Zuwanderung aus Innerfrankreich nur mehr die konfessionelle Minderheit.
Trotz aller nötigen Einschränkungen und Differenzierungen, welche die jüngere Forschung eingefordert hat, fungierte das Elsass als Vermittler zwischen verschiedenen nationalen und konfessionellen Identitäten. Gerade durch die Bewahrung und Tradierung seiner „Alsatianität“, die sich vornehmlich auf die lutherisch-deutsche Kultur des Bürgertums gründete, konnte es trotz unbestreitbarer generationeller Differenzierungen seine Mittlerfunktion bis zur Französischen Revolution fast ungeschmälert ausüben. Aber die zweite Jahrhunderthälfte brachte auch erste Anzeichen für eine intensivere Orientierung nach Frankreich hin.