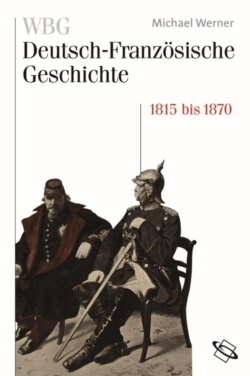Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. IV - Guido Braun - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Pfälzische Krieg
ОглавлениеDas Jahr 1685 markierte jedoch nicht nur durch das Edikt von Fontainebleau eine tiefe Zäsur im französischen Verhältnis zu den Reichsständen: In ihm begann die für das deutsche Frankreichbild so verheerende pfälzische Erbfolgekrise, deren Kriegsgreuel das übliche Maß deutlich überstiegen. Der Tod Karl-Ludwigs von Pfalz-Simmern (1685), mit dem die protestantische Kurlinie ausstarb und das Kurfürstentum an das katholische Pfalz-Neuburg fiel, bedeutete für das Reich nicht nur ein konfessionsrechtliches Problem, weil die Mehrheitsverhältnisse im Kurfürstenrat dadurch weiter zuungunsten der Protestanten verschoben wurden, sondern bot dem französischen König auch Anlass zu erneuter Intervention im Reich. Ludwig XIV. verlangte im Namen von Elisabeth-Charlotte von der Pfalz, ungeachtet ihres bei ihrer Heirat mit dem Herzog von Orléans geleisteten Erbverzichts, die Überlassung des Privatvermögens des verstorbenen Kurfürsten und des Allodialgutes der simmernschen Linie. Darunter befand sich ein Teil der Rheinpfalz. Nach ihn nicht zufriedenstellenden Verhandlungen am Regensburger Reichstag war Ludwig bereit, diesen Anspruch 1688 militärisch durchzusetzen.
Zu den wesentlichen französischen Kriegszielen gehörte aber neben der Ausdehnung des französischen Einflusses in der Pfalz vor allem die dauerhafte Sicherung der im Regensburger Stillstand 1684 Ludwig XIV. auf zwanzig Jahre überlassenen Reunionen99. Darüber hinaus wollte Frankreich seine Position in der Frage der umstrittenen Kölner Erzbischofswahl durchsetzen. Wie oftmals in der Frühneuzeit, bildete der dynastische Erbfall den Anlass, gleich auch andere politische Konflikte und Probleme mit zu „bereinigen“. 1688 war Frankreich jedoch keineswegs auf einen langen und erschöpfenden Krieg gegen eine europäische Koalition vorbereitet. Obwohl die wahrscheinlich niemals voll in Kraft getretene Augsburger Allianz (1686)100 – eine Assoziation des Kaisers mit mehreren Reichskreisen (Bayern, Franken, Oberrhein, Burgund mit Spanien), einigen Ständen und Schweden – dem Krieg zu Unrecht seinen Namen in der französischen Geschichtsschreibung gab101, bewies gerade der Ansatz zu dieser Allianzbildung doch, dass Ludwig XIV. unter den Reichsständen kaum noch eine Klientel besaß. Dies belegt auch der Ausgang eines erneuten französischen Versuches zur Konstituierung einer „dritten Partei“.
Die Interessenkonvergenz zwischen Schweden und Braunschweig-Lüneburg in der Friedensfrage erlaubte es Außenminister Croissy, die Bildung einer armierten neutralen Partei im Norden des Reiches ins Auge zu fassen, die sich um die schwedischen und hannoverischen Besitzungen im Niedersächsischen Reichskreis kristallisieren sollte. Für Herzog Ernst August von Braunschweig-Lüneburg waren diese Verhandlungen auch ein taktisches Druckmittel, um den Kaiser dazu zu bewegen, ihm die Kurfürstenwürde zu verleihen. Ludwig XIV. hatte dem Herzog seinerseits bereits zweimal vertraglich seine Unterstützung für den Erwerb des Kurfürstentitels zugesichert (1672 und 1687). Tatsächlich gelang es, den Herzog am 1. Dezember 1690 zu einem auf den 27. November rückdatierten Neutralitätsabkommen zu bewegen, in dem sich dieser gegen französische Subsidien und Unterstützung in der Kurfrage zum Anschluss an eine armierte dritte Partei bereit erklärte. Zudem konnte der französische Gesandte Bidal am 27. Januar 1691 einen Bündnisvertrag zwischen Münster und Braunschweig-Lüneburg erreichen, in dem beide Fürsten sich für neutral erklärten. Ein Abkommen zwischen dem Fürstbischof von Münster und Ludwig XIV. sollte am 25. März 1691 folgen. Doch Misshelligkeiten zwischen Frankreich und den deutschen Fürsten über die Kriegsziele und die angestrebte Einbindung Kursachsens, die wegen seines Streits mit Hannover über das sachsen-lauenburgische Erbe erhebliche Gefahren für das Bündnis barg, führten dazu, dass der Hannoveraner am 22. März 1692 mit dem Kaiser abschloss. Frankreichs Politik war von nun an darauf ausgerichtet, die Gegner der hannoverischen Rangerhöhung, insbesondere die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel und Kursachsen, zum Zentrum der dritten Partei zu machen. In den Jahren 1691–1693 bezahlte Ludwig XIV. an Hannover, Münster, Sachsen-Gotha, Wolfenbüttel und Dänemark in der Hoffnung auf die Bildung einer dritten Partei Subsidien in Höhe von mehr als 6,2 Mio. Livres aus, wozu noch Gratifikationen für die Staatsbeamten dieser Mächte kamen, die an den Bündnisverhandlungen mitgewirkt hatten. Obwohl Croissy die Gegner Frankreichs mit der Gefahr der Bildung einer dritten Partei mehrere Jahre lang in Schach halten und einen Teil der militärischen Unterstützung lahmlegen konnte, die der Kaiser von den betreffenden Ständen prinzipiell erwarten durfte, hatten diese Summen letztlich zu keinem greifbaren Ergebnis geführt. Der Misserfolg der Verhandlungen über die Bildung der dritten Partei lässt sich mit der grundlegenden Transformation des Verhältnisses zwischen dem König und den Reichsständen in den Jahren nach dem Friedensvertrag von Nimwegen erklären.
Im September 1689 war zu dem Wilhelm III. von England dem kaiserlichen Lager beigetreten: Das kaiserlich-englische Bündnis bildete fortan bis 1756 (wenn auch nicht ununterbrochen) einen Pol, um den sich die Gegner Frankreichs sammeln konnten. Der Plan Ludwigs, eine Art Blitzkrieg zu führen, um einen lang andauernden Waffengang zu vermeiden, scheiterte. Im Gegenteil konnte Wilhelm III., stadhouder der Vereinigten Provinzen und seit der Glorious Revolution 1688 König von England, eine Koalition schmieden, die – abgesehen von einigen neutralen Ländern wie Dänemark, der Schweizer Eidgenossenschaft und Portugal – fast alle europäischen Staaten gegen Ludwigs Forderungen auf den Plan brachte102. Um Braunschweig-Lüneburg in seiner Koalition zu behalten, erhob der Kaiser es in den Kurfürstenstand – eine Erhebung, deren Verfassungsmäßigkeit allerdings sowohl im Reich als auch von der französischen Diplomatie angefochten und erst 1708 (neben der vollen Readmission Böhmens) vom Reichstag sanktioniert wurde. Die von Kriegsminister Louvois angeordnete Politik der verbrannten Erde, die vor allem zur Verwüstung der Pfalz führte, zeitigte nachhaltige Konsequenzen für das deutsche Frankreichbild – noch Kurt von Raumer bezeichnet sie „als eine der bedrückendsten Niederungen in der Geschichte Frankreichs und Europas“103. Sie führte zur Perhorreszierung Ludwigs XIV., der nun endgültig vom Protector libertatis Germaniae zum Hostis imperii wurde, und seiner kriegführenden Generäle in der deutschen Publizistik und wurde darüber hinaus zu einem konstitutiven Element der Gallophobie104. Auch der Begriff des französischen „Erbfeindes“ stammt bereits aus der Zeit der ludovizianischen Expansionskriege im Reich105. Im Inneren sah sich der König mit einer wirtschaftlichen Depression, einer katastrophalen Missernte (1693) und einer darauf folgenden demographischen Krise konfrontiert. Trotz der bis zum Friedensschluss befristeten Einführung einer revolutionären Einkommenssteuer (capitation), der auch der Adel unterworfen war (18. Januar 1695), erreichte die Staatsschuld 1698 einen Rekordstand von 138 Mio. Livres. Dazu kam ein durch die Kriegsfolgen verstärkter Rückgang des Außenhandels106.
Im Frieden von Rijswijk (1697) machte Ludwig XIV. seinen Kriegsgegnern erstmals substantielle Konzessionen. Frankreich musste sich insbesondere verpflichten, alle rheinischen, nördlich und östlich des Elsass durch Reunionen oder Kriegseroberungen erworbenen Plätze und Territorien wieder abzutreten („Rijswijker Klausel“). Die während des Krieges besetzten linksrheinischen Gebiete zwischen Trier und Koblenz mussten den rechtmäßigen Reichsständen zurückgegeben werden, und auf die Annexion der Pfalz musste Ludwig ebenfalls verzichten. Freiburg im Breisgau ging an die Habsburger zurück. Darüber hinaus musste er das Herzogtum Lothringen (vermindert um die von Vauban befestigten Plätze Sarrelouis und Longwy) dem bis dahin landlosen Herzog Leopold von Lothringen restituieren. Das 1670 besetzte Herzogtum erlangte damit rechtlich und faktisch seine Autonomie zurück; die Vermählung Herzog Leopolds mit einer bourbonischen Prinzessin, Elisabeth Charlotte (1698), belegte allerdings umgehend das unverminderte dynastische und politische Interesse Frankreichs an diesem auf seine Unabhängigkeit im Schatten der Reichsprotektion pochenden Herzogtum. Schließlich sah sich Ludwig XIV. auch gezwungen, auf den Kölner Erzbischofsstuhl für seinen Protegé Wilhelm Egon von Fürstenberg zu verzichten, der gleichwohl das Bistum Straßburg behaupten konnte.
Frankreich konnte jedoch in Rijswijk durchaus beachtliche Gewinne verbuchen. Dazu gehörten vor allem die definitive völkerrechtliche Anerkennung der Zession des Elsass einschließlich Straßburgs und der 1684 nur vorübergehend zugestandenen Reunionen. Diese Resultate konnten vor allem deshalb erzielt werden, weil Kaiser und Reich wie zuvor schon in Nimwegen und später im Friedenswerk von Utrecht, Rastatt und Baden nach ihren Partnern Frieden schlossen und daher unter dem Druck der zerfallenen Allianzen verhandeln mussten.
Die Religionsklausel (Art. IV) schrieb die Beibehaltung des konfessionellen Status quo in den von Ludwig XIV. restituierten, außerhalb des Elsass ehemals reunierten und dabei rekatholisierten Gebieten fest. Diese Klausel bedeutete einen Bruch des 1648 reichsgrundgesetzlich fixierten Normaljahrsprinzips, dem zufolge der konfessionelle Stand von 1624 zu bewahren war. Die Festschreibung der französischen Gegenreformation wurde mehr als drei Jahrzehnte lang zu einem Streitfall, der den Regensburger Reichstag beschäftigte, konfessionelle Leidenschaften wieder anfachte, bisweilen sogar militärisch zu eskalieren drohte und auch die französische Diplomatie in Atem hielt.
Erhebliche Konsequenzen ergaben sich aus der Tatsache, dass die Nordgrenze des an Frankreich abgetretenen elsässischen Territoriums weder im Westfälischen Frieden noch in den späteren Friedensschlüssen zwischen Frankreich und dem Reich verbindlich festgelegt worden und eine Anerkennung der von den Franzosen seit 1680 beanspruchten Souveränität über das gesamte südlich der Queich gelegene Gebiet von Reichs wegen auch nicht zu erhalten war. Die daraus resultierenden Grenzstreitigkeiten konnten von Versailles in vielen Fällen sukzessiv durch lettres patentes ausgeräumt werden, in denen der französische König einseitig auf weitere Veränderungen verzichtete und deren Annahme durch die betroffenen Reichsstände das nach französischem Verständnis ohnehin geltende Recht bestätigte. Dennoch zogen sich in mehreren Fällen die Differenzen über den genauen Grenzverlauf bis ins spätere 18. Jahrhundert hin. Erst 1766 gelang es den Franzosen, durch Vereinbarungen mit Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz und Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken ihre Ansprüche auf Selz, Hagenbach und den rechts der Queich gelegenen Teil des Oberamtes Germersheim durchzusetzen; doch weil deren vollständige Umsetzung an das Ableben Karl Theodors geknüpft war und dieser ein hohes Alter erreichte, traten sie erst 1799 in Kraft, nachdem die französische Monarchie längst untergegangen war.