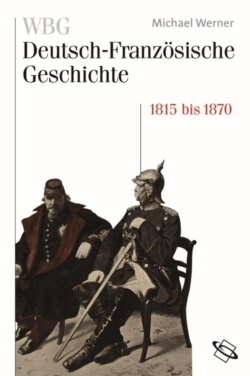Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. IV - Guido Braun - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die expansionistische Hegemonialpolitik Ludwigs XIV. oder der Beginn des „zweiten Dreißigjährigen Krieges“ (1667–1697)55
ОглавлениеIn der zweiten Hälfte der 1660er Jahre kam es zu einer dem Prestige Frankreichs als Schutz- und Garantiemacht abträglichen Neuausrichtung des französischen Verhältnisses zu den Reichsständen, die in mehrerlei Hinsicht eine Abkehr von den Prinzipien Richelieus und der Politik Mazarins bedeutete und bei der das Vorgehen im Elsass nur eine Facette bildete. Wenn sich bereits die französische Diplomatie des 18. Jahrhunderts und auch die spätere Historiographie teilweise auf die Reichspolitik Richelieus, Mazarins und Ludwigs XIV. bezog, so handelt es sich bei dieser unterstellten Gemeinsamkeit um ein Konstrukt, dessen ideologische Grundlagen im 18. Jahrhundert gelegt wurden. Dieser Befund gilt nicht allein im Hinblick auf die territorial zunehmend expansiveren Zielsetzungen und die Methode der bilateralen Bündnisverträge anstelle multilateraler Vertragsverhältnisse. Er gilt nicht zuletzt auch für den Wandel der Umgangsformen. Selbstverständlich hatte Frankreich auch bereits unter Richelieu versucht, seine Sachinteressen in aller Schärfe durchzusetzen; es hatte sich aber um eine glaubwürdige ideologisch-rechtliche Legitimation seiner Politik und um ein konziliantes Auftreten in der Reichsöffentlichkeit bemüht. Diese subtile Form der Politik wurde seit etwa 1667 mit den Worten Max Braubachs durch „ein System rücksichtslosen Machteinsatzes“ ersetzt56. Es folgten drei Jahrzehnte, in denen das deutsch-französische politische Verhältnis weitestgehend von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt war.
Die offensive Phase der Außenpolitik Ludwigs XIV. wurde nach einer Zeit der erfolgreichen inneren Konsolidierung (Wirtschaftsreformen Colberts und militärische Reorganisation durch Louvois) mit dem Devolutionskrieg 1667 eröffnet57. Den Anlass zum ersten Schritt dieses offensiven Ausgreifens auf fremdes Territorium an der französischen Ostgrenze bildete der Tod des spanischen Königs Philipp IV. (1665), aufgrund dessen Ludwig XIV. Erbansprüche im Namen seiner Frau anmeldete. Er hatte im Juni 1660 im Zuge der französisch-spanischen Aussöhnung nach dem Pyrenäenfrieden die Infantin Maria Theresia geheiratet, die zwar auf ihr Erbe verzichtet hatte, aber Spanien war die Zahlung der Mitgift in Höhe von 500.000 Scudi – eine angesichts des defizitären Staatshaushaltes exorbitante Summe – schuldig geblieben.
Nach dem Tode Philipps IV. leitete Ludwig XIV. aus dem im Hennegau und in Flandern zum Teil üblichen privatrechtlichen Devolutionsrecht Erbansprüche Maria Theresias auf einen Teil ihres väterlichen Erbes in den Spanischen Niederlanden ab. Das Devolutionsrecht gewährte den Kindern aus erster Ehe das Vorrecht vor den Nachkommen aus späteren Ehen und erlaubte ihnen beim Ableben des Vaters, ihren Erbteil einzufordern. Es gehörte jedoch nicht zur Sphäre des öffentlichen Rechts. Seine Anwendung auf den spanischen Erbfall in den Niederlanden wurde daher von Ludwigs Gegnern als unzulässig betrachtet. Paul Sonnino gelang der Nachweis, dass der französische König tatsächlich nach der Eroberung der Spanischen Niederlande strebte und der Devolutionskrieg letztlich der Vorbereitung einer größeren Offensive, des Niederländischen Krieges, diente58. Zugleich präfigurierte der Devolutionskrieg die große diplomatisch-militärische Auseinandersetzung zwischen Habsburg und Bourbon um das spanische Gesamterbe, die nach 1700 mit dem Tod des kränklichen und kinderlosen Karl II. zum gesamteuropäischen Krieg eskalierte. Die Politik Ludwigs XIV. im Kampf um den 1665 zur Disposition stehenden Erbteil ist daher auch vor dem Hintergrund der Heirat Leopolds I. mit der zweitgeborenen Tochter Philipps IV., Margarete Theresia (1651–1673), am 5. Dezember 1666 zu erklären. Dadurch waren die dynastischen Bande zwischen beiden habsburgischen Linien noch enger geknüpft und die französische Furcht vor einer spanisch-kaiserlichen Universalmonarchie nach dem Vorbild Karls V. geschürt worden.
Im Sommer 1667 versuchte Ludwig XIV. seine vermeintlichen Rechte in einem „Blitzkrieg“59 gegen die Spanischen Niederlande durchzusetzen. Der Devolutionskrieg wurde 1668 mit dem ersten Teilungsvertrag und dem Abschluss der Tripelallianz zwischen England, den Vereinigten Provinzen und Schweden beigelegt. Im Frieden von Aachen erreichte Ludwig XIV. die Abtretung wichtiger flandrischer Festungen, vor allem Lilles. In diesem Zusammenhang wurde in französischen Regierungskreisen wieder die Frage diskutiert, ob der König mit den flandrischen Gebietsabtretungen die Reichsstandschaft erwerben sollte. Zu einem nachdrücklichen französischen Drängen auf die Reichsstandschaft kam es aber auch in diesem Falle nicht.
Neben der militärischen Bedrohung des Burgundischen Reichskreises erregte auch die Tätigkeit der französischen Publizisten Missmut und Opposition auf deutscher Seite – sowohl beim Kaiser als auch bei den Reichsständen und sogar bei den mit Frankreich verbündeten Fürsten. 1667 formulierte Antoine Aubery in seiner Schrift „Des justes prétentions du Roy sur l’Empire“ die Ansprüche des französischen Königs auf Reichsgebiet, die sich auch im Sinne von Absichten auf das Kaisertum deuten ließen60. Franz Paul Freiherr von Lisola, ein aus der Franche-Comté stammender kaiserlicher Diplomat, antwortete umgehend (1667) mit seinem beim Lesepublikum erfolgreichen „Bouclier d’Estat et de justice“, um das französische Vorgehen als Rechtsbruch zu entlarven.
Das Prestige des Garantiemacht-Status führte dennoch dazu, dass Frankreich noch in den 1660er Jahren in inneren Reichsangelegenheiten durchaus mitentscheidenden Einfluss nehmen konnte. Zum Beispiel wurde auf dem Wege einer französisch-schwedischen Vermittlung der vom Pfälzer Kurfürsten Karl Ludwig seit Beginn der 1660er Jahre angefachte Streit um das Wildfangrecht durch einen von beiden Mächten garantierten Vergleich beigelegt. Im Zuge dieser Vermittlung befasste man sich auf französischer Seite intensiv mit den vom Wildfangrecht berührten Rechtsfragen61.
Die Tatsache, dass das reichsständische Vertrauen in Frankreich dennoch zunehmend erschüttert wurde und Ludwig XIV. eher als Bedrohung denn als Protektor erschien, musste nicht notwendigerweise einem Aufstieg des kaiserlichen Sterns dienen. Der Kaiserhof hatte von einem militärischen Eingreifen in den Devolutionskrieg abgesehen und eine Annäherung an Ludwig XIV. durch einen (alsbald von beiden Parteien verworfenen) Partagetraktat über die spanische Erbschaft favorisiert62. Obwohl viele Reichsstände auch in den 1680er Jahren dem Kaiser aufgrund der Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges noch immer misstrauten63, gelang es Leopold I., sich zunehmend als Schutzherr der Stände zu inszenieren. Gesteigert wurde die kaiserliche Reputation und Autorität im Reich nicht nur durch die erfolgreiche Verteidigung der deutschen Lande gegen den bedrohlichsten Reichsfeind, das Osmanische Reich, seit dem Entsatz Wiens 1683. Durch eine umsichtige, im Geist des Westfälischen Friedens betriebene Reichspolitik, welche die ständischen Mitwirkungsrechte achtete, und durch eine gewisse Distanzierung von Madrid, die den Ständen teilweise ihre Befürchtung nahm, ins Schlepptau der spanischen Politik genommen zu werden, hatte Leopold bereits vor den erfolgreichen Türkenkriegen viel Vertrauen zurückgewinnen können. Schon 1668 schätzte der Kurfürst von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, den Kaiser als Schutzherrn mehr als Ludwig XIV., der den Ständen gefährlich zu werden drohte64.
Diese Einschätzung erwies sich mit dem 1672 von Ludwig XIV. angezettelten Holländischen Krieg als begründet65. Der französische König schaffte dadurch nicht nur von neuem Unruhe im Grenzraum zu Deutschland, sondern dieser Krieg betraf die Reichsstände unmittelbar. Gleichwohl konnte er in den ersten Jahren des Niederländischen Krieges von allianzpolitisch sehr günstigen Voraussetzungen im Reich ausgehen. Zudem verstand sich der Kaiser 1671 zu einem Neutralitätsvertrag mit Ludwig XIV. Der Marienburger Allianz, die sich in der Tradition der reichsständischen Assoziationen gebildet hatte und Leopold I. einschloss, war daher kaum Erfolg beschieden.
Ludwig XIV. beabsichtigte, den Niederländischen Krieg auf einen lokalen Konflikt zwischen zwei Kriegsparteien zu begrenzen, und schickte daher den am 23. Februar 1673 instruierten Gesandten Dangeau zum Kurfürsten von Mainz, um einen neuen Rheinbund abzuschließen66. Der Mainzer sollte nach den französischen Plänen auch Kurpfalz und Kurtrier dazu bewegen, eine Schutzbarriere entlang des Rheins zu bilden, um so den kurbrandenburgischen Truppen den Weg in die Niederlande zu verlegen. Ludwig XIV. argumentierte, dass er in diesem Falle keinen Grund habe, selbst militärisch in dieser Region zu intervenieren. Doch der Vertrauensverlust, der die Beziehungen zwischen Ludwig XIV. und den Reichsständen seit dem Devolutionskrieg belastete, ließ dieses Projekt am Ende ebenso scheitern wie den alternativen französischen Plan der Konstituierung einer dritten Partei im Reich mit deutlich profranzösischer Tendenz67.
Nachdem das Reich 1674 faktisch in den Krieg gegen Frankreich eingetreten war, avancierte das Rheinland von der Peripherie der militärischen Operationen zum eigentlichen zentralen Kriegsschauplatz. Die unmittelbar nach dem Friedensschluss von Nimwegen einsetzenden Reunionen und die mit militärischen Mitteln vorgetragenen französischen Rechtsansprüche auf das pfälzische Erbe müssen nach Klaus Malettke vor diesem Erfahrungshintergrund, der strategisch zentralen Position des Rheinlandes im Kampf gegen Habsburg, gesehen werden68. Nicht nur im Reich, sondern auch in Europa büßte Ludwig XIV. jedoch gerade durch dieses Ausgreifen auf deutsches Territorium seinen Kredit als Friedensgarant weiter ein. Mehr noch: Der politische Leitbegriff der „Universalmonarchie“, dessen sich die französische Diplomatie und Propaganda jahrzehntelang erfolgreich gegen Habsburg bedient hatte, kehrte sich nun gegen den französischen König um. Sowohl außenpolitisch – Ludwig XIV. sah sich schließlich mit einer großen europäischen Koalition konfrontiert – als auch durch die innere Opposition geriet Frankreich im Niederländischen Krieg unter starken Druck. In der Frage, ob es im Holländischen Krieg 1674 zu einer förmlichen Reichskriegserklärung an Ludwig XIV. kam, ist sich die Forschung zwar nicht einig69 – dennoch sah ein französischer Publizist 1675 in den Reichstagsbeschlüssen geradezu eine Pervertierung der Regensburger Versammlung von einem Hort reichsständischer Libertät zu einem Instrument monarchischer Machtpolitik, durch das die Stände gezwungen würden, sich an einem bellum iniustum zu beteiligen70. Das war französische Propaganda. Der Holländische Krieg gilt jedoch nicht zu Unrecht als erster Reichskrieg seit dem Westfälischen Frieden71. Die diplomatischen Beziehungen wurden sowohl in Wien als auch in Regensburg abgebrochen; am 15. April 1674 reiste der ausgewiesene französische Reichstagsgesandte Robert Gravel ab. Durch die publizistisch heiß diskutierte, auf kaiserliche Order wegen Reichsrebellion erfolgte Gefangennahme Wilhelms von Fürstenberg in Köln verlor Ludwig XIV. eine einflussreiche Stütze seiner Reichspolitik72. Doch nicht nur (reichs-) politisch, sondern auch militärisch konnte von einem französischen Siegeszug keine Rede sein. Kurbrandenburg verdiente sich in diesem Krieg mit dem geradezu zum Mythos verklärten Sieg über den schwedischen Alliierten Ludwigs XIV. bei Fehrbellin (1675) seine ersten, zumindest à la longue international beachteten Sporen – die zeitgenössische französische Presse machte davon jedoch wenig Aufhebens73. Neben dem deutschen Westen und den reichszugehörigen Spanischen Niederlanden wurde auch der Norden des Reiches zum Kriegsschauplatz. Der französische „Sieg“ war letztlich nicht militärischer, sondern diplomatischer Natur: Nach ersten erfolglosen Ansätzen in Köln (1676) tagte in Nimwegen unter päpstlicher und englischer Vermittlung ein internationaler Friedenskongress, auf dem es Frankreich gelang, seine Gegner zu spalten. Die formale Konsequenz war, dass der Kongress nicht mit einer gemeinsamen Schlussakte auseinandertrat, sondern die Ergebnisse in einer Reihe bilateraler, 1678/79 unterfertigter Verträge fixiert wurden74. Frankreich arrondierte seinen Besitz an der Ostgrenze um die ehemals spanische Franche-Comté. Nimwegen wurde nach der ungeheuren inneren und äußeren Anspannung, die das Königreich im Verlauf dieses Krieges erfasst hatte, welcher entgegen allen militärischen und diplomatischen Plänen der französischen Kontrolle entglitten war, zu einem großen propagandistischen Erfolg des Sonnenkönigs stilisiert75, obwohl die ursprünglichen Kriegsziele überhaupt nicht erreicht werden konnten und der anfängliche Hauptgegner, die Generalstaaten, ungeschoren davonkam. Doch mit der territorialen Arrondierung des Königreiches war die in besonderem Maße für Ludwig XIV. prägende Leitvorstellung herrscherlicher Reputation schlechthin realisiert worden: die durch erfolgreiche Eroberungspolitik erreichte Expansion des Herrschaftsraumes, die nach dem Verständnis der Zeitgenossen Ruhm (gloire) und Ehre (honneur) des Fürsten steigerte – und gerade darin lag wohl der eigentliche Impetus der expansiven Logik des frühmodernen Fürstenstaates, insbesondere in seiner ludovizianischen Ausprägung. Der vermutlich wichtigste (und nachhaltige) Erfolg der Kaiserlichen war hingegen reichsverfassungsrechtlicher Natur und bestand darin, dass eine nach dem Westfälischen Frieden eigentlich vorgesehene Reichsdeputation unterbunden werden konnte und das reichische ius pacis faktisch wieder dem Kaiser – mit Bevollmächtigung und nachträglicher Sanktionierung durch den Reichstag – anheimfiel76.
Seit 1679 wurde der andauernde bourbonisch-habsburgische Antagonismus zunehmend durch den französisch-englischen Gegensatz überlagert, der sich in der Tripelallianz während des Devolutionskrieges angekündigt hatte und nun verschärfte. Zukunftsweisend war vielleicht – obwohl brandenburgische Allianzwechsel keine Seltenheit blieben – auch der Übertritt des Großen Kurfürsten von der kaiserlichen auf die französische Seite. Dass Wien dem Brandenburger in Reichslehensfragen kein Entgegenkommen gezeigt hatte, erschütterte das kurfürstliche Vertrauen in die Beziehung zum Reichsoberhaupt; die Ohnmacht des Kaisers dabei, dem Kurfürsten seine pommersche Kriegsbeute zu sichern, zeigte darüber hinaus die strukturelle Unzulänglichkeit einer Verbindung mit der Hofburg bei der Verwirklichung der brandenburgischen Ziele im Norden des Reiches. Dennoch erwies sich zunächst die Allianz mit Frankreich, die der Kurfürst nach dem Friedensschluss von Saint-Germain-en-Laye (1679) mit Ludwig XIV. einging, keineswegs als erfolgversprechender: 1683 konnten seine Absichten auf das schwedische Pommern auch in dieser neuen Konstellation nicht durchgesetzt werden, weshalb der Kurfürst wieder zum Kaiser übertrat Seine Allianzpolitik dieser Jahre wirkte gleichwohl wegweisend für eine extensive Auslegung des reichsständischen Bündnisrechts, bei der Reichs- und kaiserliche Rechte kaum noch formal gewahrt wurden, und zugleich stilbildend für die kurbrandenburgische Diplomatie, welche die Allianzverbindungen mit Frankreich und den vorübergehenden Ausgleich mit den Kaiserlichen stringent für den Aufstieg Brandenburgs bzw. Preußens zu einem Akteur von europäischem Rang ausnutzte.
Unmittelbar nach dem Nimwegener Friedenskongress avancierte allerdings der Westen des Reiches erneut zur deutsch-französischen Konfliktzone par excellence. In den Mittelpunkt des politischen Geschehens trat nun ein 1648 vertagtes und von der französischen Diplomatie in Nimwegen bewusst ausgeklammertes Kernproblem der Beziehungen zwischen Frankreich und dem Reich: die territoriale und rechtliche Entwirrung der Besitzverhältnisse im Elsass. Sie hatten in den Jahrzehnten seit dem Ende des Dreißgjährigen Krieges ein ständiges Konflikt- und Gefahrenpotenzial gebildet. Die Annexion Lothringens 1670 und die seit 1673 schließlich mit Waffengewalt vollzogene Eingliederung der Dekapolis (das heißt zehn elsässischer Reichsstädte, darunter Hagenau, über die Habsburg 1648 seine alten Landvogteirechte an Ludwig XIV. abgetreten hatte) in die französische Monarchie hatten schon vor Nimwegen als Fanal für den völkerrechtlich ungedeckten französischen Zugriff auf umstrittenes Gebiet an der Ostgrenze des Königreiches gewirkt.
Von Ludwig XIV. eingerichtete Reunionskammern stellten seit 1679 die historische oder rechtliche Abhängigkeit der französischen Territorialforderungen von den im Frieden von Münster abgetretenen Gebieten und Rechten fest und lieferten damit die Rechtstitel für die mit militärischen Mitteln und begleitenden administrativen Maßnahmen durchgesetzte, zwangsweise Eingliederung des gesamten Elsass in die französische Monarchie. Die 1648 ausdrücklich von der Zession ausgenommene Reichsstadt Straßburg, das gleichnamige Hochstift, in dem ein französischer Parteigänger aus dem Hause Fürstenberg als Fürstbischof residierte, die Reichsritterschaft und das übrige, bislang noch nicht französische Elsass fielen durch diese Krieg-im-Frieden-Politik sukzessiv der französischen Krone anheim. Die Kapitulation, die Louvois und der Straßburger Magistrat 1681 bei der Übergabe der Stadt unterzeichnet hatten, sicherte der ehemaligen, deutschsprachigen Reichsstadt zwar die Wahrung ihrer alten Privilegien und die freie evangelische Religionsausübung zu77, aber durch die neu eingesetzten zivilen, militärischen und religiösen Autoritäten verlagerten sich in den folgenden Jahrzehnten die Machtverhältnisse eindeutig zugunsten der Pariser Zentrale.
Bei dieser Zäsur von 1679/81 lohnt es sich, in der chronologischen Darstellung innezuhalten und einen Blick auf die Strukturen des Elsass nach seiner Annexion und auf die führende kulturelle Stellung Frankreichs in Europa um 1680 zu werfen, denn beides war für die französische und elsässische, aber auch für die deutsche Geschichte bis weit ins 18. Jahrhundert hinein von größter Bedeutung.