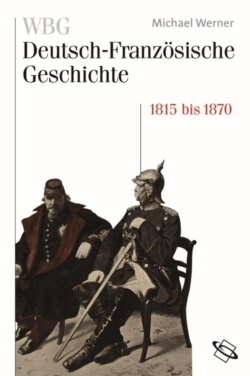Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. IV - Guido Braun - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Edikt von Fontainebleau und die Immigration französischer Hugenotten ins Reich
ОглавлениеNicht allein die Außen- und Deutschlandpolitik Ludwigs XIV. unterminierte sein Ansehen im Reich in den 1680er Jahren. Vor allem eine innenpolitische Maßnahme trug zu einer merklichen Verschlechterung im Verhältnis zu den protestantischen Mächten in Europa und im Reich bei, die über die Konfessionsgrenzen hinweg zu den traditionellen französischen Verbündeten im Dauerkonflikt mit Habsburg gehörten: die Revokation des Edikts von Nantes94, ein 1598 den Protestanten durch königliche Konzession eingeräumtes Ausnahmerecht, das ihnen an 200 spezifizierten Orten ihre Religionsausübung und sogar eine gewisse politische und militärische Autonomie zugestand. Gleichzeitig hatte das Edikt von Nantes jedoch den Katholizismus als Staatsreligion bestätigt95. Zum Widerruf dieses Edikts kam es unter veränderten außen- und innenpolitischen Vorzeichen 1685, als Ludwig XIV. im Edikt von Fontainebleau die den Hugenotten 87 Jahre zuvor zugestandenen Privilegien aufhob, obwohl sie ihnen explizit als unwiderruflich verbrieft worden waren. Wenngleich das Edikt von Fontainebleau die Hugenotten in Frankreich mit Ausnahme ihrer Pastoren nicht expressis verbis zur Konversion verpflichtete, so ließ die Beschneidung ihrer (beruflichen) Lebensgrundlagen vielen jedoch de facto keine Alternative zum Exil, wollten sie nicht zum Katholizismus übertreten oder sich in den Kryptokalvinismus flüchten. Trotz des Verbots der Emigration der Laienprotestanten traten viele Hugenotten daher den unsicheren Weg in die Fremde an. Nach 1685 verließen wahrscheinlich mehr als 200.000 französische Protestanten als Reaktion auf das Edikt von Fontainebleau ihre Heimat. Das Reich bildete mit etwa 43.000 Immigranten nicht das bevorzugte, aber ein wichtiges Aufnahmeland. Dort hatten schon 1648 die Kalvinisten im Artikel VII des Osnabrücker Vertrages ihre Aufnahme in den Religionsfrieden und damit reichsrechtliche Anerkennung, Gleichberechtigung und Rechtssicherheit erlangt, nachdem ihre Aufnahme unter die Stände der confessio Augustana invariata bis dahin nicht widerspruchsfrei akzeptiert worden war. Religiöse Toleranz war dadurch um 1685 im Reich zwar nicht geschaffen (und 1648 auch gar nicht intendiert) worden. Es gab jedoch in Deutschland dank dieser Rechtslage eine Reihe von Obrigkeiten, vor allem kalvinistischen, die gewillt oder im Rahmen der in der Nachkriegszeit initiierten Peuplierungspolitik sogar bestrebt waren, die hugenottischen französischen Exulanten in ihren Territorien anzusiedeln. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen erklären, warum es im Reich zu einer hugenottischen Einwanderung kommen konnte. Das hugenottische Refuge etablierte sich vornehmlich in reformierten, aber auch in lutherischen Territorien. Die Wahl des Exils folgte dabei oft den Wegen, welche bereits die Vorfahren der 1685 auswandernden Hugenotten beschritten hatten. Die Kontakte der Hugenotten ins Reich waren um 1685 zwar weniger intensiv als nach England und in die Generalstaaten, weil die protestantischen deutschen Territorialstaaten mit Ausnahme der Kurpfalz erst seit der Mitte des 17. Jahrhunderts zu Zentren der hugenottischen Immigration geworden waren, doch bestanden bereits wertvolle Verbindungen, welche die Ansiedlung der Hugenotten in den deutschen Territorien erleichterten.
Obwohl diese Immigration quantitativ weniger bedeutsam war als die Ansiedlung von Hugenotten in den nordwesteuropäischen Ländern des Refuge, sind ihre Konsequenzen für die deutsche Geschichte erheblich gewesen. Die Frage nach dem Beitrag der französischen Hugenotten zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung bestimmter Territorien, vor allem Brandenburg-Preußens, hat durchaus kontroverse Antworten hervorgerufen. Unbestreitbar ist gleichwohl, dass die hugenottische Immigration als gelungener Integrationsprozess zu einem ideellen deutschen Erinnerungsort geworden ist96. Entgegen einem im Rückblick idealisierten Bild von der hugenottischen Integration verlief ihre Eingliederung jedoch keineswegs allerorten problemfrei: An Drehscheiben des Refuge tauchten bestimmte Flüchtlinge immer wieder auf, weil sie anderswo keine feste Bleibe fanden, und wurden trotz begrenzter eigener Möglichkeiten wenigstens vorübergehend versorgt (Frankfurt am Main). Wenn nicht der Landesherr, so beäugten doch die lokalen Obrigkeiten und die Bevölkerung die Neuankömmlinge bisweilen kritisch und fürchteten die Konkurrenz (Leipzig). Eine Integrations- und Assimilierungspolitik wurde seitens der Obrigkeiten in der Regel gerade nicht intendiert, und mancherorts sollte die besondere Leistungsfähigkeit der Immigranten der einheimischen Bevölkerung zum Vorbild dienen (Brandenburg-Preußen). Die Neuankömmlinge durften daher teilweise ihre besonderen Institutionen beibehalten und wurden mit eigenen Privilegien ausgestattet (Potsdamer Edikt und Freiheitskonzession in Hessen-Kassel, 1685).
Bedingungen und Verlauf der hugenottischen Immigration gestalteten sich in den einzelnen deutschen Territorien durchaus unterschiedlich. Brandenburg-Preußen nahm mit etwa 20.000 Exulanten die meisten hugenottischen Einwanderer auf. Es folgten Hessen-Kassel, die Kurpfalz, Franken und Württemberg mit je mehr als 3000 Immigranten; der niedersächsische Raum und die Hansestädte nahmen jeweils ca. 1500 Exulanten auf97. Der herausragenden Zahl hugenottischer Immigranten in Brandenburg-Preußen entspricht ihr erstrangiger Platz in der deutschen Erinnerungskultur, durch den allerdings die Vielschichtigkeit der Hugenotten-Ansiedlung und der vielgestaltigen französisch-deutschen Migration in der Frühneuzeit überhaupt in den Hintergrund verdrängt zu werden droht. Zwischen Frankreich und Deutschland wanderten keineswegs nur Konfessionsgruppen, sondern viele andere Individuen und Gruppen mit diversen wirtschaftlichen, sozialen und wissenschaftlichen Hintergründen: Handwerker, Kaufleute, Studenten, Gelehrte, Militärs etc.98 Der wirtschaftliche Beitrag der hugenottischen Neuankömmlinge in Brandenburg und in den anderen Territorien ist sicherlich in der Geschichtsschreibung zum Teil überbewertet worden. Dass – ganz abgesehen von der sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Bereicherung – wichtige technische Kenntnisse und Fertigkeiten mit den Exulanten Einzug in das deutsche Handwerk und die Wirtschaft hielten und vor allem Brandenburg-Preußen von diesem Technologie-Import profitierte, darf gleichwohl als sicher gelten. In diesem Kontext verdient auch Erwähnung, dass es neben der konfessionell motivierten hugenottischen Immigration durchaus auch eine ökonomische gab (Hamburg).
Die Revokation des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. 1685 hatte für das Frankreichbild in Europa und für das französische Verhältnis zu den übrigen europäischen Ländern ambivalente Konsequenzen. Einerseits trugen die Hugenotten – auch wenn der tatsächliche Umfang ihres Wirkungskreises umstritten ist – sicherlich zur Propagierung der französischen Kultur und der französischen Sprache in den Ländern ihres Refuges bei, darunter auch in mehreren deutschen Territorialstaaten. Andererseits litt das Verhältnis Frankreichs zu den protestantischen Mächten und den protestantischen deutschen Fürsten unter dieser intoleranten Maßnahme. Langfristig begleiteten die Hugenotten – vor allem von Holland und Preußen aus – mit ihren französischen Büchern und Zeitschriften die politische, gesellschaftliche, religiöse, philosophische und wissenschaftliche Entwicklung Frankreichs aufmerksam und kritisch.