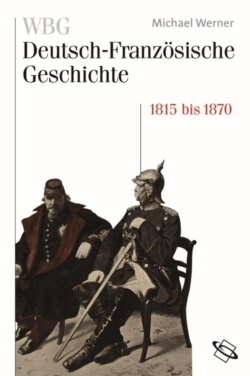Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. IV - Guido Braun - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Krise und Neubeginn. Das Reich und Frankreich um 1650 Der Friedensschluss von Münster und seine zeitgenössische Rezeption
ОглавлениеDer Westfälische Frieden gilt heute als einer der bedeutendsten Friedensschlüsse der Neuzeit und als Zäsur in der europäischen Geschichte. Doch wie nahmen ihn die Zeitgenossen wahr? Aufschlussreich für diese Frage ist die zeitgenössische Presseberichterstattung. Nachdem kaiserliche, französische, schwedische und reichsständische Gesandte am 24. Oktober 1648 die beiden Westfälischen Friedensverträge unterfertigt und besiegelt hatten, veröffentlichte die regierungsnahe französische Wochenzeitung „Gazette“ (bekannter unter ihrem von 1762 an geführten Titel „Gazette de France“) zwischen dem 17. November und dem 2. Dezember französische Zusammenfassungen des lateinischen Friedens von Münster und des am 6. August 1648 von Kaiserlichen und Schweden durch Verlesung und Handschlag kongressöffentlich vereinbarten Friedens von Osnabrück1. Die Zusammenfassung (Sommaire) des kaiserlich-französischen Friedens wurde durch einen redaktionellen Kommentar erläutert, der sich jedoch einzig auf § 3 des Friedens von Münster bezieht, worin das Verbot einer Assistenz für Spanien und den Burgundischen Reichskreis durch Kaiser und Reich stipuliert wird2. Das Gleiche lässt sich mit Blick auf die Sonderausgabe der „Gazette“ vom 13. November 1648 feststellen, in der dem französischen Leser erstmals von der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens berichtet wurde3. Dort wird mit keinem Wort die Abtretung des Elsass und der drei lothringischen Hochstifte Metz, Toul und Verdun durch Kaiser und Reich an Frankreich erwähnt, die doch in der französischen und der deutschen Historiographie seit dem 19. Jahrhundert (nicht zu Unrecht) als einer der bedeutendsten Erfolge der französischen Diplomatie in der Frühen Neuzeit gilt und in territorialer Hinsicht das Hauptergebnis des Friedens von Münster darstellt – mit nachhaltigen Folgen für das französischdeutsche Verhältnis bis ins 20. Jahrhundert. Ebenso wenig wurden damals in der französischen Presseberichterstattung die Reichsverfassungs-Bestimmungen des Friedens reflektiert, auf die eine spätere, nationalgeschichtlich orientierte Historiographie (allerdings in diesem Falle nicht zu Recht) einen entscheidenden französischen Einfluss ausmachte. Im Bericht der „Gazette“ wird die eigentliche politische Bedeutung des Friedens in der vollzogenen Trennung zwischen Spanien und dem Kaiser bzw. dem Reich gesehen: Für Frankreich war eben 1648 noch kein Friede an allen Fronten, keine Ruhepause – der Krieg gegen Spanien ging weiter.
Der Westfälische Frieden von 1648 bildete in der französischen Geschichte daher einen weniger markanten Einschnitt als im Hinblick auf das Reich4. Auch im Reich wurden sich die Menschen dieser grundlegenden Zäsur in der deutschen Geschichte jedoch nicht überall umgehend nach dem 24. Oktober 1648 bewusst. Der Frieden wurde vielerorts erst nach dem Nürnberger Exekutionstag und nach der Abdankung der schwedischen Truppen, das heißt nach 1650, zu einer konkreten Erfahrung für den Großteil der deutschen Bevölkerung. Die nicht zuletzt von französischer Seite untersuchten Friedensfeiern im Reich belegen die zeitliche Verzögerung zwischen dem Friedensschluss in Münster und den von den städtischen Magistraten und lokalen Obrigkeiten inszenierten Gedenkfeiern5. Der Dreißigjährige Krieg hatte die verschiedenen Regionen des Reiches wirtschaftlich, sozial und kulturell zwar in sehr unterschiedlicher Weise betroffen; dabei differenziert die Forschungsterminologie nach so bezeichneten Schongebieten, Zerstörungsgebieten und Übergangsräumen. Er wirkte aber mit seinen zum Teil katastrophalen Ausmaßen und Konsequenzen (verbunden mit einem Bevölkerungsverlust von ca. einem Drittel in den urbanen Zentren und 40 % im ländlichen Raum) insgesamt traumatisch auf die deutsche Bevölkerung und galt in der Geschichtsschreibung lange Zeit als größte Katastrophe in der deutschen Geschichte bis zum Zweiten Weltkrieg.
Aus französischer Sicht bildete der Frieden, den Ludwig XIV. an der Seite Schwedens mit Kaiser und Reich schloss, in der Wahrnehmung durch die Zeitgenossen – wie zum Beispiel die Berichterstattung der „Gazette“ belegt – zunächst nur eine Etappe und einen Teilerfolg in der Auseinandersetzung mit dem Hauptkriegsgegner Spanien. Dieser für die französische Regierung vorrangige Konflikt wurde erst 1659 mit dem Pyrenäenfrieden abgeschlossen. Für Frankreich waren 1648 jedoch vier wichtige Kriegsziele erreicht: Trennung der Linien Wien und Madrid; territoriale Gewinne an der französischen Ostgrenze, die Frankreich beim weiteren Waffengang mit Spanien begünstigten; der Ausschluss des Burgundischen Reichskreises aus dem Friedensschluss6; die Sicherung der zuvor zum Teil umstrittenen, jedenfalls nicht kodifizierten reichsständischen (Mitbestimmungs-) Rechte auf Reichs- und Territorialebene, insbesondere ihrer Landeshoheit, ihres Bündnisrechts (ius foederis), ihrer rechtlich verbürgten Teilhabe an Friedensschluss und Kriegserklärung (ius pacis ac belli) und ihrer legislativen Funktion auf dem Reichstag. Diese Bestimmungen verankerten de jure die souveränitätsähnliche, aber nicht souveräne reichsständische Zwitterstellung zwischen Reichs- und Völkerrechtssubjekten, die auch von den Franzosen – von Ausnahmen abgesehen – nicht mit der vollen Souveränität verwechselt wurde7. Der Westfälische Frieden sicherte den Reichsständen damit die Grundlagen zum Ausbau der Staatlichkeit auf Territorialebene, wohingegen es in Frankreich im Ancien Régime nichts dem deutschen Territorialstaat Vergleichbares gab, auch wenn jüngere Forschungen für die französische Monarchie verstärkt die Bedeutung von Partikulargewalten in der Provinz belegen. Eine komparatistische Betrachtung der deutschen und der französischen Verfassungsverhältnisse in der Frühen Neuzeit existiert noch nicht, obwohl sie für das bessere Verständnis der Unterschiede, aber auch der Gemeinsamkeiten der politisch-administrativen und rechtlichen, ja sogar der sozialen Ordnung Deutschlands und Frankreichs von großem Interesse wäre8. Ansatzpunkte dazu finden sich bereits in zeitgenössischen historischen und juristischen Werken: Französischerseits unternahm Voltaire, deutscherseits Pufendorf den Versuch, die Verfassungen des Königreichs Frankreich und des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation zu vergleichen.
Wie interpretierte nun die Nachwelt, das heißt die Politiker und die Historiker nach 1648, die Verfassungsordnung von Münster und Osnabrück? In den folgenden Jahrhunderten wurde sie in Deutschland und in Frankreich kontrovers diskutiert. Dabei eröffnen sich gerade in jüngster Zeit vielversprechende Perspektiven. Wo man in der älteren Geschichtsschreibung im Hinblick auf das Reich von „Kleinstaaterei“ sprach und der französischen Diplomatie unter Richelieu und Mazarin unterstellte, die politische Ohnmacht Deutschlands zugunsten einer dauernden französischen Interventionspolitik organisiert zu haben9, „erkennt die neuere Forschung plurale Partizipationschancen, eigenwertige symbolische Politikformen sowie wegweisende föderale und rechtsstaatliche Organisationsperspektiven“10. Es wird in der jüngeren deutschen Forschung auch die These vertreten, dass die Verfassung des Alten Reiches nach dem Westfälischen Frieden eine in der europäischen Staatenwelt einzigartige, territorial- und reichsstaatliche „deutsche Doppelstaatlichkeit“ generierte, die tendenziell „Rechtsstaatlichkeit“ mit „Friedensfähigkeit“ kombiniert habe11 und daher als durchaus positive Alternative zum französischen monarchischen Zentralismus zu sehen sei. Richtig und wichtig an dieser Revision ist jedenfalls die Aufwertung des Westfälischen Friedens, der gemäß dem alten „Dekadenzmodell“ der deutschen Geschichte als Tiefpunkt der deutschen Selbstbestimmung und Höhepunkt der Fremdsteuerung des Reiches durch fremde Mächte, insbesondere Frankreich galt12. De facto bot diese besondere Rechtsstellung der Reichsstände nach 1648 jedoch nur den größeren Territorialfürsten die Gelegenheit zu einer über den deutschen Raum hinauswirkenden politischen Aktivität (nicht zuletzt auf dem Wege von Bündnissen mit Frankreich). Diese trug um 1700, zum Teil im Zusammenspiel mit der engen dynastischen Vernetzung zwischen deutschen Fürsten- und außerdeutschen Herrscherhäusern, drei Kurfürsten den Königstitel für ihre außerdeutschen Territorien ein (Sachsen/Polen 1697, Brandenburg-Preußen 1701, Hannover/England 1714), während sich die mindermächtigen und besonders die kleinen Reichsstände unter der Obhut der Reichsinstitutionen und des Kaisers scharten, die ihre Existenz schützte. Wie in Deutschland, so prägten auch in Frankreich keineswegs die einzelnen Reichsstände und die Territorialstaaten die zeitgenössische Wahrnehmung und Repräsentation des Reiches: Das Reich wurde auf den politischen Landkarten kaum mit den inneren Territorialgrenzen dargestellt, die auf späteren Abbildungen, vor allem seit dem 19. Jahrhundert, nicht selten den irreführenden optischen Eindruck des „Flickenteppichs“ suggerierten; oftmals dienten (auch noch im späteren 18. Jahrhundert) die Reichskreisgrenzen der optischen Untergliederung13. Gerade die Rechtsstellung der um 1700 teilweise zu Königstiteln gelangten Kurfürsten war zwar im Westfälischen Frieden nachhaltiger beschnitten worden als die des Kaisers, dessen Reservatrechte im Friedensvertrag überhaupt nicht erwähnt wurden, und damit nur ex negativo durch die Aufzählung der zu den gesamt-reichsständischen iura comitialia zählenden Rechtsmaterien begrenzt waren14. Zuvor nämlich hatten die Reichsstände – besonders in der fast reichstagslosen Kriegsperiode – nicht kontinuierlich in Reichsangelegenheiten mitgewirkt. Das Reichsoberhaupt hatte oftmals allein die Kurfürsten konsultiert, die seit 1356 mit dem Vorrecht der römischen Königswahl ausgestattet waren und von daher eine Präeminenz in der Durchsetzung wichtiger allgemeiner Reichssachen besaßen. 1648 wurde die kurfürstliche Sonderstellung jedoch unterminiert und weitgehend auf das eigentliche Wahlrecht beschränkt. Für Frankreich, das sich mit seiner Forderung nach dem Verbot einer römischen Königswahl zu Lebzeiten des Kaisers (vivente Imperatore) auf dem Westfälischen Friedenskongress – namentlich gegen den kurfürstlichen Widerstand – nicht hatte durchsetzen können15, galten die Kurfürsten aber gerade aufgrund dieses Wahlrechts auch nach 1648 weiterhin als bevorzugte Ansprech- und Bündnispartner unter den Reichsfürsten. Die französische Publizistik bediente sich auch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts weiterhin ihrer traditionellen Motive eines drohenden kaiserlichen Dominats im Reich und der angeblichen universalmonarchischen Bestrebungen des Kaisers, die er gemeinsam mit Spanien verfolge. Doch lässt sich im Rückblick konstatieren, dass der Weg zur monarchischen Ausgestaltung der Reichsverfassung seit 1648 verlegt war. Während in den ersten Jahrzehnten nach dem Westfälischen Frieden zahlreiche Reichsstände Friedenssicherung weiterhin nur durch Assoziationen untereinander und auch mit auswärtigen Mächten wie Frankreich betreiben konnten, erwies sich in der zweiten Jahrhunderthälfte und im 18. Jahrhundert das Reich institutionell zunehmend als tragfähiger Friedenswahrungs- und Rechtssicherungsverband mit Modellcharakter auch für eine europäische Friedenspolitik – eine Vorbildfunktion, die nicht zuletzt bei den Exponenten der französischen politischen Theorie ihre Verfechter fand (Rousseau, Saint-Pierre)16. Doch diese spätere Entwicklung war für die Zeitgenossen, deren Wahrnehmung zunächst durch die lebensnotwendige Überwindung der unmittelbaren Kriegsfolgen geprägt war, noch keineswegs absehbar; die Funktionstüchtigkeit der Reichsverfassung – durch den Westfälischen Frieden nur zum Teil und unter Aufschub wesentlicher reformbedürftiger Problembereiche (Reichsjustiz, Reichsdefensionswesen) modernisiert – hatte ihre Probe aufs Exempel in den Augen der zeitgenössischen deutschen und französischen Beobachter erst noch zu bestehen. Bei dem französischsprachigen Autor Du May, der in württembergischen Diensten stand und seit 1659 mehrere Auflagen seines französischen Abrisses über die Reichsverfassung publizierte, erhielt der Westfälische Friede noch nicht die ihm später in der Literatur eingeräumte, herausragende verfassungsgeschichtliche Rolle; in einer französischen Reichsgeschichte wird sie erst 1684, in Heiss’ „Histoire de l’Empire“, recht deutlich.
Das Assoziationswesen spielte im Reich bis in den Spanischen Erbfolgekrieg hinein immer wieder eine die Reichsdefension zumindest ergänzende Rolle in den föderativen Friedenssicherungskonzepten der Reichsstände – allen voran beim Kurfürsten von Mainz, an dessen Residenz Leibniz sein Sekuritätsgutachten verfasste17. Ludwig XIV. schlüpfte dabei allerdings zunehmend vom Rang der Schutzmacht in die Rolle des Aggressors.
Auch dass die ausgeklügelte und hochkomplexe paritätische Religionsverfassung zu einer dauerhaften Befriedung des konfessionellen Nebeneinanders im Reich führen würde, musste nach dem Westfälischen Frieden erst noch unter Beweis gestellt werden: Einer der französischen Unterhändler in Münster, der Graf d’Avaux, hatte wenige Monate vor dem Friedensschluss noch die Gefahr des baldigen Ausbruchs eines neuen Religionskrieges im Reich heraufbeschworen. Vermutlich war es nach seiner Abberufung im Frühjahr 1648 derselbe Graf, der beim Friedensschluss den dilatorischen Formelkompromiss, mit dem die kaiserlichen und französischen Friedensunterhändler die politische Entscheidung über den genauen Umfang der Abtretungen auf die Zukunft vertagt hatten, als Keim künftiger deutsch-französischer Kriege geißelte18. In guter Kenntnis der komplexen Rechtsverhältnisse hatten diese Gesandten aus politischem Kalkül die Zession habsburgischer Herrschaftsrechte und Territorien im Elsass in Vertragsartikeln vereinbart, die der Nachwelt einen weiten Interpretationsspielraum eröffneten.
In den ersten Friedensjahren standen zudem weiterhin französische und schwedische Truppen auf Reichsboden. Die eigentlichen Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück waren quasi nahtlos in die Verhandlungen über die Friedensexekution (das heißt über die Ausführung der Friedensbestimmungen) und über die Abdankung und die Abfindung der Soldateska übergegangen, deren Kosten auf die Reichskreise und damit letztlich auf die vielfach bereits überschuldeten und unter dem Zwang der Finanzierung des Wiederaufbaus stehenden Stände umzulegen waren. Zu diesem Zwecke tagte ein Exekutionstag in Nürnberg unter Beteiligung kaiserlicher, französischer und schwedischer Diplomaten sowie reichsständischer Deputierter, der 1649/50 die beiden Exekutionshauptrezesse mit Frankreich (unterzeichnet am 2. Juli 1650) bzw. mit Schweden (26. Juni 1650) aushandelte19. Die reichsrechtliche Verankerung des Friedens, der bereits in den beiden Vertragsinstrumenten zum Reichsgrundgesetz (pragmatica imperii sanctio und lex fundamentalis) deklariert worden war20, wurde auf dem Regensburger Reichstag 1653/54 dadurch abschließend komplettiert, dass der gesamte Friedensschluss wörtlich in den Reichsabschied – den letzten ordentlichen und daher so genannten „jüngsten“ Abschied des Alten Reiches – aufgenommen wurde.