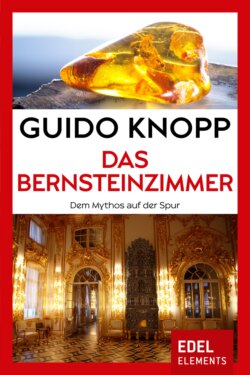Читать книгу Das Bernsteinzimmer - Guido Knopp - Страница 7
Rückkehr an die Ostsee
ОглавлениеZar Peter war gleichfalls zufrieden mit dem Tausch. »Ich habe ein höchst bedeutsames Praesent erhalten, ein Bernstein-Cabinett«, schrieb er voller Stolz an seine Gemahlin. Das innovative Tafel-Werk war dazu angetan, der Aufbauleistung des russischen Regenten ein besonderes Glanzlicht hinzuzufügen. Denn der »Kaiser aller Reußen« hatte während seiner Regierungszeit ein gewaltiges Werk in Angriff genommen. Ähnlich wie sein preußischer Amtskollege reformierte er die Zivilverwaltung und erweiterte seine Armee, mit deren Hilfe er Schweden aus seiner Vormachtrolle in Nordosteuropa verdrängte. Mit aller Gewalt und keineswegs immer förderlichen Folgen veränderte er das bäuerlich geprägte Riesenreich, ohne freilich die gesellschaftlichen Grundlagen wandeln zu können. Der tatkräftige Herrscher hatte sich vorgenommen, sein Land in jeder Hinsicht nach Westen zu öffnen. Dies war seine Vision, seit er als junger Mann in der Moskauer Ausländervorstadt in Kontakt mit Europäern verschiedener Nationen gekommen war. Damals lebten allein 18 000 Deutsche in Moskau.
Auf ausgedehnten Reisen in England, Österreich, Preußen und den Niederlanden hatte Peter wirtschaftlichen Aufbruch und westliche Lebensart aus der Nähe kennen gelernt. Zu diesem Zweck hatte er sich immer wieder von seinem Hauptberuf als aufgeschlossener Despot abgemeldet und die Fremde als anonymer Besucher bereist. Berühmtheit durch Lortzings Oper »Zar und Zimmermann« erlangte sein Aufenthalt in Amsterdam, wo der Zar sich inkognito als Zimmermann auf einer Werft verdingte. Das Symbol für sein westlich orientiertes Reformwerk ließ er selbst aus dem Sumpf erstehen: Sankt Petersburg, in nur wenigen Jahren aus menschenfeindlichem Morast zum neuen Regierungssitz seines Reiches erwachsen, war Peters Lebenswerk und sein Glaubensbekenntnis. Die neu erschaffene Hauptstadt, ein »Fenster nach Europa«, wie Puschkin schrieb, lag nicht nur geographisch im äußersten Westen der Großmacht, am Zufluss der Newa zur zunehmend russisch beherrschten Ostsee. Architekten aus den Niederlanden, Deutschland und Italien zauberten das barocke Flair ihrer Heimatländer in das Stadtbild des viel gerühmten »Venedig des Nordens«.
Freilich unter gewaltigen Opfern. Seit der Zar 1703 den ersten Spatenstich in dem von Mückenschwärmen bevölkerten Delta der Newa setzen ließ, fielen 30 000 der größtenteils zwangsrekrutierten Arbeitskräfte den Arbeitsbedingungen und Klimaverhältnissen zum Opfer. Allein zweihundertfünfzig Überschwemmungen machten die Baufortschritte immer wieder zunichte. Den Stadtbegründer kümmerten Ungemach und Menschenleben weniger, er sah sich mit seinem Wurf über derartige Widrigkeiten erhaben. Von der Geschichte erhielt der Zwei-Meter-Mann denn auch den Beinamen »der Große« zuerkannt.
Als Bewunderer holländischer Lebensart und Schaffenskraft taufte er seine neue Hauptstadt zunächst auf das Fremd-Wort »Sankt-Pieter-Burgh«, was für Weltoffenheit und Moderne stand. Später hieß die Neuschöpfung auf deutsche Art Sankt Petersburg. Das war kein Zufall. Deutsche wie der berühmte Hamburger Architekt Andreas Schlüter, zuvor schon in preußischen Diensten, standen dem Stadtgründer bei seinem Vorhaben zur Seite, Deutsche dienten dem Zaren als Berater, Architekten, Generäle, Ärzte und Kaufleute.
Da fügte es sich trefflich, dass er eines der entstehenden Schlösser an der Newa mit einer erlesenen Freundschaftsgabe aus Deutschland schmücken konnte. Die Bernsteintafeln aus Berlin waren für den Sommerpalast des Zaren bestimmt. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Noch bevor Peter der Große die Hauptstadt Preußens verließ, beauftragte er den russischen Gesandten vor Ort, die sachgerechte Verpackung zu überwachen. Nach sorgsamer Registrierung durch den Grafen wurden 22 mit Bernstein verkleidete Paneele sowie 150 Platten und Schnitzereien wie Tulpen, Rosen, Muscheln, Schnecken oder Figuren in insgesamt 18 Kisten gepackt. Dann begann der Abtransport des Bernsteinzimmers auf acht sechsspännigen Fuhrwerken zunächst nach Memel (heute Klaipeda) – der erste Ortswechsel am Beginn einer über zweihundert Jahre andauernden Odyssee mit zahlreichen Stationen. Nach sechswöchiger Reise traf der Transport im Januar 1717 in Memel ein.
Dort hatte der Zar seinem Gesandten bereits die Instruktionen zur Weiterbeförderung übermittelt: »Wenn aus Berlin das Bernstein-Cabinett, was Seine königliche Majestät von Preußen geschenkt hat, in Memel ankommt, so empfange und schicke es sofort über Kurland auf kurländischen Fuhren nach Riga, vorsichtig und mit dem Boten, welcher euch diesen Unseren Ukas mitteilt, und gebt ihm bis Riga eine Bedeckung von einem Unteroffizier und mehreren Dragonern; auch gebt dem Boten auf dem Weg bis Riga Geld zur Beköstigung, auf dass er zufrieden sei. Sollte er für den Transport des Kabinetts Schlitten fordern, so gebt ihm auch solche.«
1) Zwei Große Wandstücken, worinnen zwei Spiegelrahmen mit Spiegeln.
2) Zwei dergleichen Stücke, bei welchen nur ein lediger Spiegel Rahm.
3) Vier dergleichen Wandstücken, ein wenig schmäler, ein jedes mit einem ausgeschweifften Spiegel zum Blaker.
4) Zwei Flügel etwas breit, und nach zwey, so etwas schmäler. Diese 12 Stücke sind alle in einer Höhe.
5) Zehen aparte Paneel=Stücken, von egaler Höhe, aber differenter breite, alle complet besetzt.
6) Noch dabey gegeben folgende Stücke, so da können mit gebraucht werden, alß: ein vierekt Brett ganz belegt, ein fertig Schildt mit einem palmiten Kopff, drei fertige palmiten Köpffe aus Holz, sieben kleine Köpffe. Vierzehn fertige Tulipanen, zwölf fertige Rosen. Drey Stücken mit Muscheln und Schnecken ausgemacht. Zwey fertige Gesimmse. Zwei kleine Eckstücken. Ein klein länglichtes Brett, mit zwei Schrauben. Vier kleine auffgeschweiffter Bretter, so nur hin und wieder belegt. Noch zu einem Flügel ausgeschweiffter klarer Bernstein so in hundert und sieben kleine Stücken bestehen.
Verzeichnis des Bernsteinzimmers vor seiner Verschickung nach Russland 1717
Solchermaßen eskortiert, gelangten die Kisten im Mai 1717 wohlbehalten in Sankt Petersburg an, wo sie von Aleksandr Menschikow, dem Gouverneur der Stadt, in Empfang genommen wurden. Allein: Sein Dienstherr, Zar Peter der Große, sollte das begehrte Bernsteinzimmer nie zu Gesicht bekommen. Den konsternierten Palastbauherren gelang es nicht, die unzähligen Einzelstücke anhand der Aufbauanleitung aus Berlin wieder zu einem Gesamtkunstwerk zusammenfügen zu lassen. Das Ergebnis: Das erlesene Mitbringsel wanderte schließlich wieder zurück in die Kisten, wurde in einem Seitenflügel des Sommerpalastes in Sankt Petersburg abgestellt und geriet allmählich in Vergessenheit.
Auch die Nachfolger Peters des Großen brachten nach seinem Tod im Jahr 1725 wenig Interesse für das preußische Präsent auf. Weder seine Witwe Katharina I. noch sein Enkel Peter II., noch seine Nichte Anna Iwanowna und schon gar nicht der von Katharinas Tochter Anna Leopoldowna in der Regentschaft vertretene Säugling Iwan VI., die einander in rascher Folge auf dem Zarenthron ablösten, teilten die Vorliebe ihres legendären Vorgängers für Bernstein.
Das änderte sich erst, als Peters jüngere Tochter Elisabeth sich 1741 gleichsam an die Macht putschte. Sie versuchte in vielerlei Hinsicht, an das Werk ihres Vaters anzuknüpfen. Dazu gehörte auch die Bauwut. Den gerade neu errichteten, nunmehr dritten Winterpalast in Sankt Petersburg erwählte die Zarin zu ihrer neuen Residenz. Als somit die Frage im (noch leeren) Raume stand, wie die Säle ausgestaltet werden sollten, entsann sie sich der inzwischen etwas angestaubten 18 Kisten aus dem Erbe ihres Vaters. Sie wollte vollenden, was ihm versagt geblieben war: eines der Schlossgemächer in ein Bernsteinkabinett umzuwandeln.
Für dieses Vorhaben stand an ihrem Hofe ein versierter Meister bereit, den sie mit den Entwürfen beauftragte. Elisabeths leitender Architekt Francesco Bartolomeo Rastrelli, 1700 in Paris geboren, war schon als Jugendlicher mit seinem Vater, einem italienischen Bildhauer, nach Sankt Petersburg gekommen. Nach dem Architekturstudium begann der geniale Planer, seine Wahlheimatstadt mit herausragenden Werken des russischen Barock zu schmücken – wie dem Smolnyj-Kloster, dem Stroganow-Palast und einigen weiteren Zarenschlössern.
Im Auftrag der Zarin unternahm Rastrelli eine Bestandsaufnahme der seit nunmehr vierundzwanzig Jahren eingelagerten Einzelteile für das Bernsteinzimmer und ließ beschädigte Elemente instand setzen. Dann ging er daran, die Teilstücke wieder zu dem einst vorgesehenen Ensemble zusammenzusetzen. Doch wiederum erwies sich das komplizierte Puzzlespiel als beinahe unlösbare Aufgabe. Erst als Rastrelli den italienischen Bildhauer und Stuckateur Alessandro Martelli zur Unterstützung heranzog, gelang die Wiederherstellung des ursprünglichen Gesamtwerks.
Doch bei Lichte betrachtet erwies sich, dass Friedrichs einstiges tabacs-collegium sich in der Größenordnung bei weitem nicht mit dem Palastgemach der Zarin messen konnte. Die vorhandenen Paneele genügten nicht, um den vorgesehenen Saal im Winterpalast auch nur einigermaßen ausreichend auszukleiden. Um seine Aufgabe dennoch bewerkstelligen zu können, wendete Rastrelli mit Martellis Beistand einen Kunstgriff an. Sie schmückten die Ausgangsbestandteile mit zusätzlichen Architektur- und Dekorationselementen aus, mit bemalten Flächen und spiegelbesetzten Wandpfeilern, so genannten Pilastern. Die neu geschaffenen Verbindungsstücke erweiterten nicht nur die Fläche der Wandverkleidung um das notwendige Maß, ohne dass aufwendige Bernsteinarbeiten in Angriff genommen werden mussten, sie hoben auch die Wirkung des vorhandenen Bernsteins auf kunstvolle Art hervor, indem sie ihn nachahmten und widerspiegelten. Friedrichs Bernsteinkabinett erhielt einen neuen, großzügig wirkenden Rahmen.
Erneut stand ein spendabler preußischer König hilfreich zur Seite. Der Sohn des freigebigen Soldatenkönigs, Friedrich II., der wie Elisabeths Vater als »der Große« in die Geschichte eingehen sollte, stiftete 1745 einen vierten Spiegelrahmen mit kostbaren Bernsteinschnitzereien, den er in Königsberg nach einem Entwurf von Anton Reich anfertigen ließ. Zahlreiche allegorische Kompositionen aus Bernstein rückten die Zarin in ein ruhmreiches Licht und schmeichelten ihrem Selbstdarstellungsdrang. Doch diesmal blieb die Liebesgabe aus Berlin ohne die erwünschte Freundschaft erhaltende Wirkung: Nur ein Jahr später schloss Russland mit Österreich ein Verteidigungsbündnis, das sich vornehmlich gegen Preußen richtete, und schlug sich im Siebenjährigen Krieg auf die Seite der Kriegsgegner Preußens.
Bis dahin blieb der Werdegang des Bernsteinzimmers bewegt. Kaum war der Wandschmuck installiert, erteilte Zarin Elisabeth die Anweisung, ihn wieder in seine Bestandteile zu zerlegen. Als eine Art bewegliche Kulisse ließ die Schlossherrin die Bernsteinvertäfelung wiederholt ab- und wieder anmontieren, um sie, je nach Anlass, in verschiedenen Räumen des Winterpalastes zur Geltung zu bringen.