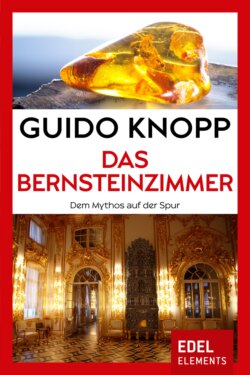Читать книгу Das Bernsteinzimmer - Guido Knopp - Страница 8
Wiederauferstehung im Zarenpalast
ОглавлениеDoch 1755 fand das Nomadendasein der Ausstattungsstücke – für annähernd zwei Jahrhunderte – ein Ende. Die Zarin hatte nämlich eine bleibende Verwendung für das Bernsteinzimmer in ihrem neuen Lieblingspalast gefunden. Schon 1718 hatte Peter der Große mit dem Bauvorhaben auf einem Hügel südlich von Sankt Petersburg begonnen. Seit den Zeiten skandinavischer Besiedlung trug die Anhöhe den finnischen Namen Saari Moijs, der sich später in Saarskoje Selo, schließlich in Zarskoje Selo (auf Russisch: Zarendorf) wandelte. Hier hatte der Gründer der neuen Hauptstadt beschlossen, einen Palast für den Aufenthalt der Zarenfamilie während der Sommermonate zu errichten. Benannt hatte er den Prachtbau nach seiner zweiten Gattin und vormaligen Mätresse Katharina Alexejewna, der er die gesamte Residenz zum Geschenk machte.
1736 wurde dieses Katharinenpalais bereits wieder restauriert und erweitert. Und auch die Thronfolgerin Elisabeth ließ es sich nach ihrem Amtsantritt nicht nehmen, den Palast unter tatkräftiger Inanspruchnahme ihres begnadeten Hofarchitekten Rastrelli für ihre Zwecke herzurichten. Zunächst beabsichtigte die verschwendungssüchtige Kaiserin, eines ihrer Gemächer mit Halbedelsteinen unterschiedlicher Färbung auszuschmücken. Doch dann erinnerte sie sich ihrer schon vorhandenen Bernsteinverkleidungen und verfügte, einen Saal ihres Schlosses vollständig und dauerhaft mit der hochwertigen Tapete zu verzieren. Ein weiteres Mal wurden die Einzelbestandteile im Winterpalast sorgsam abmontiert, in Behältnisse verpackt und für den Transport vorbereitet. Um die Vertäfelung auf keinen Fall zu gefährden, wurde diesmal sogar auf den Einsatz von Pferdefuhrwerken verzichtet. Jede der Kisten mussten Träger zu Fuß in das 25 Kilometer entfernte Zarenschloss verfrachten.
Angekommen in der Sommerresidenz, machte der Hofarchitekt im Sommer 1755 zunächst erneut Inventur: Aneinander gereiht füllten die zehn Sockelstücke und die zwölf Wandpaneele aus Bernstein eine Fläche von etwa 14 Meter Länge und weniger als 5 Meter Höhe aus. Der etwa 100 Quadratmeter große, annähernd quadratische Saal im Katharinenpalais kam indes, ohne die drei bis zum Fußboden reichenden Fenster und drei Flügeltüren, auf eine Wandlänge von über 40 Metern, in der Höhe maß er 6 Meter. Dieses Mal ergab die Bestandsaufnahme, dass die zu gestaltende Fläche gleich um das Sechsfache größer war als das zur Verfügung stehende Material. Wiederum waren Rastrellis Ideenreichtum und Kunstfertigkeit gefragt, um das weiträumige Problem zu lösen. Diesmal war es jedoch nicht mit kleineren Komplettierungen getan. Die Vervielfachung der Wandverkleidung kam einer Neuschöpfung des Zimmers gleich. Aus dem intimen, eher mystischen Ur-Kabinett sollte ein prachtvoller, schillernder Saal entstehen, der im Katharinenpalais an prominenter Stelle, zwischen den Paraderäumen der Galaflucht, seine Bestimmung finden sollte.
Elisabeths genialer Baumeister verstand es erneut mit großem Geschick, die zwölf bestehenden Bernsteinfelder aufzuwerten, indem er sie geschickt über die gesamte Wandfläche verteilte und mit neu geschaffenen Elementen umgab. Zu diesem Zweck ließ er eigens in Venedig 24 Kristallspiegelfelder mit Rahmen aus vergoldeten Holzschnitzereien verzieren. Später wurden diese aus Feuerschutzgründen durch goldgefärbte Bronzerahmen ersetzt. Die hohen und schmalen Spiegel ließen den Raum größer und majestätischer erscheinen. Ihnen zu Füßen setzte Rastrelli Sockelstücke ein, die aus Bernstein gefertigt waren. Die Wandflächen oberhalb der Eingänge ließ er mit Dekorationen aus vergoldetem Holz oder Bernstein, so genannten Supraporten, ausschmücken. Die drei Türen des Festsaals waren weiß gehalten und mit goldenen Holzornamenten verziert. Da diese Elemente immer noch nicht ausreichten, die gesamte Wandfläche auszufüllen, behalf sich der Meister vorläufig mit optischer Täuschung. Er ließ Leinwandflächen in die Wandverkleidung einfügen, die der Maler Iwan Iwanowitsch Belskij den Bernsteinschnitzereien täuschend ähnlich bemalte. Für den Fußboden gab der Architekt einen Parkettbelag mit hochwertigen Intarsien in Auftrag, in den auch Elemente aus Perlmutt eingefügt waren. Darin schimmerte die Pracht der Wände. Auf Höhe der oberen Türkanten waren Leuchter aus vergoldeter Bronze angebracht. Um das fehlende Stück zwischen den 4,75 Meter hohen Originalpaneelen und der Raumhöhe von 6 Metern auszufüllen, entwarf Rastrelli einen Fries mit allegorischen Figuren und üppigen Ornamenten für den Übergang zur Decke. Ein prachtvolles, mit Stuck umrahmtes Deckengemälde aus der Hand der Dekorationsmaler Giuseppe Valeriani aus Rom und Antonio Peresinotti aus Bologna krönte das Gesamtkunstwerk.
Nach der Fertigstellung der Ausgestaltung waren sich die Betrachter einig: Hier war nicht nur ein bestehendes Bernsteinkabinett auf umsichtige Art in eine andere Umgebung verpflanzt worden. Es war ein neues, einmaliges Meisterwerk entstanden, das jede bis dahin vollführte Innenausgestaltung eines Palastraumes übertraf. Mit viel Liebe zum Detail gefertigte Dekorationselemente im Stil des Rokoko vervollständigten auf harmonische Weise die barocke Ausdruckskraft des Originals aus Preußen. »Ich hatte mir einmal extra eine Lupe mitgenommen«, erläutert Aleksandr Aleksandrowitsch Kedrinskij, der knapp zweihundert Jahre später als Museumsmitarbeiter das Original zu Gesicht bekam, »und durch dieses Vergrößerungsglas entdeckte ich, wie da auf einem kleinen Fleck ein ganzes Bild mit Figuren eingraviert war. Da wurde mir erst bewusst, welche unglaublich riesige Menge an Details in diesem ganzen Bernsteinkunstwerk steckte, die der Besucher gewöhnlich gar nicht mitbekommt.«
Das Sonnenlicht, das durch die breite Fensterfront in den Raum flutete, die Wechselwirkung von Bernsteinflächen und Ornamenten, das Zusammenspiel von Wand-, Fußboden- und Deckengestaltung, das Glitzern und Funkeln von Lüstern und Leuchtern, der hundertfach reflektierende Widerschein in den Spiegeln, dies alles zusammen ließ die meisterhaft komponierte Wandverkleidung in einem ganz neuen Licht erscheinen.
Der Import aus dem Berliner Stadtschloss hatte zweifellos einen würdigen Rahmen gefunden. Aber dieses Zimmer war nicht mehr Friedrichs preußisches »Bernstein-Cabinett«. Es hatte – mit sachverständiger italienischer Hilfe – eine russische Renaissance erfahren – eine echte europäische Koproduktion. Einen Saal wie diesen hatte es zuvor nirgends auf der Welt gegeben. Und auch später hat niemand mehr den Versuch gewagt, dieses Vorbild andernorts nachzuahmen. Es war sicher auch seine Einzigartigkeit, die das Bernsteinzimmer zum Mythos machte.
Doch auch meisterhafte Schöpfungen haben irdische Schwächen. Schon bald nach dem Abschluss der Arbeiten war unübersehbar, dass die empfindlichen Bernsteinplättchen hier und dort zu bröckeln begannen. Der glanzvolle Eindruck drohte schon nach kurzer Zeit ramponiert zu werden. Um dies zu verhindern, musste ständig nachgebessert werden. So beschloss der Hofarchitekt, eigens einen Meister der Bernsteinzunft einzustellen, der ausschließlich für die Instandhaltung des Festsaales zuständig war. Der Ostpreuße Friedrich Roggenbuch, der 1758 sein Amt antrat, wachte künftig nicht nur über den tadellosen Zustand des Bernsteinzimmers. Er baute auch eine eigene Bernsteinwerkstatt am Hofe auf.
Schon bald beschränkte sich das Atelier des Meisters nicht mehr darauf, marode Teile der Wandverkleidung auszuwechseln. Roggenbuch wurde selbst zum Gestalter neuer Einrichtungsbestandteile für das Gemach der Zarin. 1760, die Jahreszahl für den Beginn dieses Wirkens, hat er selbst auf einem Panneau im Saal verewigt. Und er fand bald eine wohlwollende Auftraggeberin, die übrigens auch seine Muttersprache teilte.
Sophie Auguste Frederike von Anhalt-Zerbst, 1729 in Stettin geboren, war schon als junges Mädchen mit ihrer ehrgeizigen Mutter an den Petersburger Hof gekommen, wurde dort russisch-orthodox auf den Namen Katharina getauft und mit dem Neffen der Zarin verheiratet. Wie ihre Schwiegermutter und Amtsvorgängerin Elisabeth erkämpfte sie sich den Weg auf den Zarenthron auf gewaltsame Weise. Mit Hilfe der Leibgarde putschte sie gegen ihren eigenen Mann, Peter III., der diesen Staatsstreich mit dem Leben bezahlte. 1762 ließ sie sich als Katharina II. zur Zarin von Russland ausrufen.
Dementsprechend war die gebürtige Deutsche während ihrer gesamten Regierungszeit beharrlich darauf bedacht, Anerkennung als legitime Kaiserin Russlands zu finden. Doch Eindruck als »aufgeklärte Monarchin« erweckte die absolute Herrscherin vor allem im Westen Europas, während sie im eigenen Land mit harter Hand gegen rebellierende Leibeigene, Kosaken, Manufakturarbeiter und Muslime vorging. Dennoch trieb Katharina die Große die Umgestaltung der russischen Gesellschaft voran, festigte den russischen Zentralstaat und sorgte in der Nachfolge Zar Peters dafür, ihr Land noch weiter nach Westen zu öffnen. Die gebildete Frau verstand es, den Petersburger Hof in den kulturellen Mittelpunkt Europas zu rücken, und unterließ es auch nicht, ihrem eigenen Wirken im Land Denkmäler zu setzen. Dazu gehörte auch die Sommerresidenz in der Zarenvorstadt Zarskoje Selo, die sie sofort nach Regierungsantritt einer erneuten Schönheitskur unterzog.
Mit außerordentlicher Hingabe widmete sich die deutsche Zarin dabei der Fertigstellung des Bernsteinzimmers. Ihr besonderes Anliegen war es, die Wände möglichst flächendeckend mit Bernstein auszugestalten. Daher erteilte Katharina dem Hofarchitekten 1763 die Anweisung, die bemalten Leinwandflächen durch eine Vertäfelung aus echtem Bernstein zu ersetzen. Damit begann die letzte Etappe in der Vollendung des Saales, die alles in allem noch einmal acht Jahre in Anspruch nahm. Die neu geschaffene Bernsteinwerkstatt des Meisters Roggenbuch erwarb in dieser Zeit weithin hohe Anerkennung als letzter Hort in Europa für die hohe Kunst der Ausgestaltung von Räumen mit Bernsteinmosaiken und -schnitzereien.
Zusammen mit zwei weiteren Meistern und zwei Gehilfen aus Königsberg sowie russischen Lehrlingen verarbeitete Friedrich Roggenbuch 450 Kilogramm des edlen Rohstoffs. Anstelle der auf Leinwand gemalten Imitationen schufen sie acht Wandtafeln mit eingelegten Ornamenten und füllten die Lücken der Wandverkleidung, die bisher noch nicht aus Bernstein gefertigt waren. Tafeln aus unübersehbar vielen Plättchen wurden mit flachen Reliefs, kleinen Büsten, Figuren, Wappen, Trophäen und Initialen verziert, die mattgelb, dunkelbraun oder weißgolden schimmerten. Um weitere Farbeffekte zu erzielen, brachten die Meister unter transparenten Bernsteinelementen verschiedenfarbige Folien an. Je nach Lichteinfall und beim Übergang von Sonnen- zu Kerzenlicht wechselten sie chamäleongleich ihre Ausdruckskraft.
Aber nicht nur auf Wandschmuck beschränkte sich das Schaffen der Bernsteinkünstler. Auch Gegenstände für die Raumausstattung wie eine zierliche Eckkonsole mit reichhaltigem Schnitzwerk entstammten der Werkstatt. Darüber hinaus begannen die Kunsthandwerker des Hofes, alte Bernsteingegenstände aus den Beständen der Zarenfamilie zu restaurieren. Gebrauchsartikel aus Bernstein wie Tabaksbehälter, Puderdosen, Spiegel oder Spielsteine, besonders im 17. Jahrhundert als Präsente beim Hochadel beliebt, wurden im Atelier wieder auf Hochglanz gebracht und bereicherten die wachsende Kollektion für das Bernsteinzimmer. Kunstgegenstände aus Ostpreußen, Polen, Norddeutschland oder Dänemark fanden so im Zarenschloss ihre letzte Ruhestätte. Obwohl an vielen dieser Pretiosen die Zeit nicht spurlos vorüberging, blieb diese Sammlung, im Gegensatz zu dem sie beherbergenden Raum, bis heute immerhin vollständig erhalten.
Ein ganz besonderes Schmuckstück für ihre neu ausstaffierte Kammer erhielt Katharina die Große in jenen Jahren aus Italien. 1751 in Florenz nach Entwürfen des Malers Giuseppe Zocchi gefertigt, gelangten vier wertvolle Steinmosaike zu Beginn ihrer Amtszeit, möglicherweise als Geschenk des Habsburger Kaiserhauses aus Anlass ihrer Krönung, in den Katharinenpalast. Auf den Mosaiken sind allegorische Darstellungen der fünf menschlichen Sinne abgebildet, vor Trümmern der Antike in toskanischer Landschaft. Aus millimeterdünn geschliffenen Bruchstücken von Halbedelsteinen aller Farbabstufungen wurden sie so kunstvoll zusammengefügt, dass sie auf den ersten Blick wie Gemälde wirkten. Ähnlich wie die Bernsteinpräsente jener Zeit galten die Steinmosaike aus Florenz als begehrte Raritäten, weil sich nur einzelne ausgesuchte Spezialisten, in diesem Fall die Steinschneidemeister Cosimo und Luigi Siries, auf diese Kunst verstanden. Im Zimmer der Zarin fanden die mit feuervergoldeter Bronze gerahmten Steinintarsien Verwendung als Ersatz für die vier großen Berliner Spiegel.
1770 war es schließlich so weit. Nach über ein halbes Jahrhundert währenden Gestaltungs-, Erweiterungs- und Ausbesserungsarbeiten hatte das Bernsteinkabinett sein endgültiges Aussehen erhalten – wie es, abgesehen von Renovierungen in den Jahren 1833, 1865, 1893 bis 97 und zwischen den Weltkriegen, beinahe unverändert bis 1941 überdauerte und auf den verbliebenen Fotografien späterer Jahre überliefert ist. Das Wunder war vollbracht und konnte nun seine vollendete Wirkung entfalten. Besonders in der Dämmerung, wenn die sinkende Sonne die Bernsteintapete noch einmal goldgelb aufleuchten ließ, und am Abend, wenn sich der Kerzenschein der zahlreichen Leuchter tausendfach spiegelte und in der Wandverkleidung einen schimmernden Widerschein erhielt, bekam der Saal eine beinahe magische Ausstrahlung, die manchen Gast überwältigte. Im Bernstein schien die Sonne gefangen. »Die ganze Dekoration macht einen angenehmen Eindruck bei Sonnenlicht wie aber auch bei künstlicher Beleuchtung«, rühmte der Kunsthistoriker Wilkowskij später. »Hier ist nichts Aufdringliches, Schreiendes, die ganze Dekoration ist so bescheiden und harmonisch, dass so mancher Betrachter vielleicht durch den Saal geht, ohne sich zu fragen, aus welchem Material die Verkleidung der Wände, der Fenster- und Türrahmen und die Wandornamente bestehen. Die Bernsteinverkleidung erinnert am meisten an Marmor, ruft jedoch nie den Eindruck von Kälte und Pracht, der dem Marmor eigen ist, hervor und übertrifft dabei an Schönheit jede Verkleidung mit dem allerkostbarsten Holz.«
Die Zarin jedenfalls war ausgesprochen angetan und erkor diesen Raum fortan zu ihrem Lieblingsaufenthaltsort. Im warmen Schimmer ihrer edlen Tapete hätte sich Katharina die Große, so berichten Hofhistoriker, gerne am Kartenspiel delektiert. Möglicherweise, wie aus sachten Andeutungen hervorgeht, auch an anderen Formen des Zeitvertreibs, die im deutlichen Widerspruch zum Motiv des Deckengemäldes standen, das da lautete: »Der Sieg der Klugheit über die Wollust«.
Aber nicht nur dem sagenumwobenen Liebesleben ihrer Majestät bot der Raum eine stilvolle Kulisse. Empfänge, Besprechungen, musikalische Darbietungen und kurzweilige Veranstaltungen fanden hier einen würdigen Rahmen. Kaum ein Staatsgast und Besucher verließ den Hof, ohne das Schmuckstück des Zarenpalastes zu betrachten. Der aufrichtigen Bewunderung konnten sich die Hausherren sicher sein. So schrieb eine Kammerzofe der Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach in etwas ungelenker Sprache, aber offenbar schwer beeindruckt, an ihren Verlobten: »Wie wir von Pawlowsk zurückfuhren, mussten wir durch Zarskoje Selo, die Hoheit befahl, wir sollten dort halten und schickte einen Feldjäger mit, dass wir alles gezeigt bekamen, dessen Pracht gar nicht zu beschreiben ist. Da war ein Zimmer, beinahe so groß wie der neue Saal, der bei uns gemacht wird, von lauter Bernstein die Wände und ziemlich große Figuren aus einem Stück gearbeitet, dessen Wert dieses Zimmers gar nicht zu berechnen ist.« Von einem persischen Prinzen wird überliefert, dass er am Eingang des Saales seine Schuhe ablegte, weil er es nicht wagte, den Glanz des Saales mit Straßenstaub zu benetzen.
Der einzigartige Anblick blieb indes nur ausgesuchten Betrachtern vorbehalten. Zutritt zum Zarenschloss erhielten neben der Familie und dem Personal nur Angehörige des europäischen Hochadels samt Hofstaat sowie ausgewählte Ehrengäste. Das änderte sich erst 1917. Angesichts von Krieg, Hunger und Elend erhob sich im Februar (russischer Zeitrechnung) das Volk gegen den Zaren. Nachdem sich auch die Duma, das Parlament, und Befehlshaber der Armee der Rücktrittsforderung angeschlossen hatten, sah sich Zar Nikolaus II. gezwungen abzudanken und stand fortan als Bürger Nikolaj Romanow unter Hausarrest in der vormaligen Zarenresidenz Zarskoje Selo. Im August musste der letzte Zar den prachtvollen Palast vor den Toren der Hauptstadt verlassen und wurde mit seiner Familie »aus Sicherheitsgründen« auf die letzte Reise nach Sibirien, von dort nach Jekaterinburg geschickt.
Nach der Revolution der Sowjets im Oktober 1917 wurde Zarskoje Selo in Djetskoje Selo (Kinderdorf) umbenannt, und die Schlösser des Sommerresidenzortes wurden in »Volkseigentum« umgewandelt. Das Volk hatte zwar nicht viel von seinem neuen Besitz, aber nun immerhin die Gelegenheit, auch ohne blaues Blut in den Adern den verschwenderischen Reichtum der Zarenfamilie in Augenschein zu nehmen: die 600 Hektar große Parkanlage mit den beiden Meisterwerken des Barock, dem Katharinen- und dem Alexanderpalais, reichhaltig mit Säulen, Kapitellen, Skulpturen und Balustraden verziert, bei deren Errichtung die Bauherren nicht an der Verwendung von Gold und anderen hochwertvollen Materialien gespart hatten. Im beinahe 900 Quadratmeter Großen Saal des Katharinenpalais ließen die vergoldeten Spiegel das Licht von 56 Kron- und Wandleuchtern widerscheinen.
Publikumsmagnet wurde aber das Bernsteinzimmer. Nicht nur gekrönte Häupter waren von der Pracht gebannt. Auch ausländische Besucher pilgerten zu der neuen Wallfahrtsstätte. Otto Pelka, damals einer der fachkundigsten Kenner der Materie und ihrer Verarbeitung, kam 1920 zu dem Schluss: »Trotz der persönlichen und zeitlichen Stilmischungen, die sich aus dem Mangel eines einheitlichen Entwurfes und aus der langen Dauer der Fertigstellung erklären, macht das Ganze besonders bei Sonnenschein doch einen überwältigenden Eindruck.«
Allerdings hatte da das Bernsteinzimmer schon etwas von seinem ursprünglichen Glanz eingebüßt. Erhebliche Temperaturschwankungen hatten dem Kunstwerk zugesetzt, nachträgliche Restaurationsversuche mehr Schaden angerichtet als Nutzen erbracht. Die hohe Kunst der Bernsteinverarbeitung war mit den alten Meistern des Rokoko gleichsam ausgestorben. So waren etwa Lücken, die durch herausfallende Plättchen entstanden, reichlich stümperhaft mit Gips zugekleistert. Andere Restauratoren hatten kurz vor dem Ersten Weltkrieg die Wände mit einem Lack auf Olivenölbasis verziert, der sich dann braun färbte und kaum mehr zu entfernen war. An manchen Stellen kam wegen herausgebrochener Elemente schon der Holzuntergrund zum Vorschein.
Dem Gesamteindruck taten diese Schönheitsfehler indes einstweilen keinen Abbruch. So schrieb der deutsche Botschafter Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau 1927 unter dem Eindruck der Besichtigung an seine Tochter: »Wer einmal in Djetskoje Selo war, die faszinierende Anlage des Rastrelli-Schlosses gesehen hat, wer einmal im Schimmer der Kerzen das Bernsteinzimmer aufleuchten sah, der begreift die tiefe Bindung des russischen Menschen zu den Werken der Vergangenheit, wenn sie mit Schweigen in die brennenden Kerzen schauen, die das Gold des Meeres wie Karfunkelstein aufleuchten lassen.«
Jene Vergangenheit hatte viele Berührungspunkte mit dem Herkunftsland des Botschafters, und diese gemeinsame deutsch-russische Geschichte mit ihren Höhen und Tiefen spiegelte das Bernsteinzimmer auf geradezu symbolhafte Weise. Intarsien mit dem preußischen Adler oder den gekrönten Initialen Friedrichs I. (FR für Fridericus Rex) als wiederkehrende Motive im Wandgetäfel erinnerten stets daran, dass das Kabinett in Deutschland seinen Ursprung hatte und als Geschenk Ausdruck deutsch-russischer Verbundenheit war. Auch der Rohstoff entstammte weitgehend preußischen Quellen, einem Gebiet, das heute zu Russland gehört. Von hier kamen die Meister, die sich auf die kunstvolle Verarbeitung des Bernsteins verstanden – und das ist heute noch so.
In Zar Peter dem Großen fand das innovative Kabinett einen dankbaren Abnehmer. Er schätzte Güter und Techniken, die aus Deutschland kamen. Seine neue Metropole Sankt Petersburg erhielt ihren deutschen Namen nicht zuletzt deshalb, weil sie Russlands Schwelle zum Westen war. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts lebten zeitweise 40 000 Deutsche an der Newa, vorwiegend auf der Petersburger Wassiljewskij-Insel – unter ihnen zeitweise auch Otto von Bismarck und Heinrich Schliemann.
Das Bernsteinzimmer symbolisiert die enge Verflechtung beider Länder. In Berlin wie später in Sankt Petersburg gab es immer wieder die Kulisse ab für die Bekräftigung der preußisch-russischen Allianz. Obzwar die Großmächte Europas in wechselnden Koalitionen mit- wie gegeneinander Kriege führten, so gab es doch einen lange haltbaren Brückenschlag zwischen preußischem Königshaus und Zarenpalast – allerdings oft zu Lasten anderer Länder, vor allem von Polen.
Nicht zuletzt hatten zahlreiche Angehörige der Zarenfamilie ihre Wiege einst in den deutschen Landen stehen. Zar Peters Tochter Anna wurde mit einem schleswig-holsteinischen Herzog vermählt. Ihr Sohn wiederum, Herzog Karl Peter Ullrich von Holstein-Gottorp, bestieg als Peter III. den Thron und wurde damit zum Stammvater des letzten Zarengeschlechts. Seine Frau war ebenfalls eine Deutsche, Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, besser als Katharina die Große bekannt. Von nun an holten sich alle russischen Zaren, mit Ausnahme von Alexander III., ihre Gattinnen aus deutschen Landen an den Hof. Auch die Frau des letzten Zaren Nikolaus II., die mit ihm in den Tod ging, stammte aus Hessen-Darmstadt. Kurz: »Das Blut der Romanows war gründlich germanisiert«, wie der französische Historiker Pierre Miquel bemerkte.
Solche engen Bande hielten beide Länder freilich nicht davon ab, sich im Ersten Weltkrieg verheerende Materialschlachten zu liefern. Im Zarenreich war alles Deutsche nun mit einem Mal verboten. Bach, Beethoven oder Brahms durften nicht mehr zu Gehör gebracht werden, selbst der vermeintlich deutsche Brauch, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, war untersagt. Sankt Petersburg wurde in Petrograd umbenannt. Auch für das Kaiserreich war nun der Osten Feindesland und Schauplatz erbitterter Schlachten, die jedoch keine Entscheidung brachten. Doch auf andere Weise trug die deutsche Regierung dazu bei, die Geschichte Russlands umzuwälzen. Mit ihrer Unterstützung kehrte Wladimir Iljitsch Uljanow im versiegelten Güterwaggon aus dem Schweizer Exil in seine russische Heimat zurück, um dort unter seinem Kampfnamen Lenin die Oktoberrevolution anzufachen.
Trotz gegensätzlicher Staatssysteme gab es zwischen den Kriegen auf vielen Gebieten Annäherungen zwischen den beiden ehemaligen Monarchien. So unterwiesen Ausbilder der Reichswehr sowjetische Offiziere während der zwanziger Jahre in der Technik der Kriegsführung. Beginnend in Rapallo, sicherten sich Vertreter beider Staaten in Verträgen wechselseitige Unterstützung zu. Selbst der Hitler-Stalin-Pakt, 1939 im Schatten von Hitlers bevorstehendem Eroberungskrieg geschlossen, schien den gegenseitigen Verzicht auf einen Angriff bei allen ideologischen Gegensätzen noch einmal zu bekräftigen. Noch bis zum Sommer des Jahres 1941, nachdem beide Diktatoren bereits einvernehmlich die polnische Nation unter sich aufgeteilt hatten, rollten vertragskonform sowjetische Transporte mit Getreide als Lebensmittellieferung in Hitlers Reich.