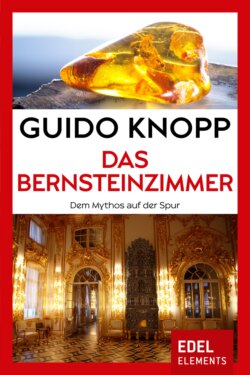Читать книгу Das Bernsteinzimmer - Guido Knopp - Страница 9
Zarenschloss an der Front
ОглавлениеDoch mit der Nacht zum 22. Juni 1941 wurde alles anders. Auf den Brücken über den Grenzfluss Bug, die sowjetische Güterzüge eben noch passiert hatten, rückten kurz nach drei Uhr morgens deutsche Soldaten in das sowjetische Besatzungsgebiet vor. Sie waren Vorauskommandos eines der größten Truppenaufmärsche der Weltgeschichte. Unter strengster Geheimhaltung hatte Hitler mehr als drei Millionen deutsche und verbündete Soldaten zwischen der Ostseeküste und dem Schwarzen Meer Stellung beziehen lassen, um zu dem Militärschlag auszuholen, der für ihn Kernstück seiner Eroberungspolitik war: dem Überfall auf die Sowjetunion.
Unter dem Codenamen »Barbarossa« stießen die Truppen, unterstützt von Kampfflugzeugen und Artillerie, auf einer Breite von 1600 Kilometern in sowjetisches Gebiet vor. Zunächst trafen die Angreifer kaum auf nennenswerten Widerstand. Fast alle Grenzbrücken wurden unzerstört genommen. Erbitterte Gefechte wie in Brest blieben die Ausnahme. In »Blitzkriegsmanier« drangen die deutschen Panzer in wenigen Tagen mehrere hundert Kilometer ins Landesinnere vor. Die sowjetische Führung traf der Überraschungsangriff reichlich unvorbereitet. Sie brauchte mehr als eine kostbare Woche, um die Landesverteidigung zu organisieren.
Neben Moskau, wo Stalin residierte, und dem industriell bedeutsamen Donezbecken im Südabschnitt der Front verfolgte der deutsche Vormarsch im Norden eine weitere Stoßrichtung: Die einstige Hauptstadt Sankt Petersburg, 1924 zu Ehren des Revolutionsführers in Leningrad umbenannt, galt der deutschen Wehrmacht als Angriffsziel von hoher strategischer Bedeutung. Die Eroberung der vermeintlichen »Wiege des Bolschewismus« hatte im Krieg der Ideologien aber auch politischen Signalwert.
Alarmiert vom raschen Vordringen der Angreifer, entsandte Stalin Anfang September seinen bewährten General Georgij Schukow nach Leningrad, um die Millionenstadt vor der drohenden Einkesselung zu bewahren. Die überstürzt aufgestellten 15 Divisionen der Roten Armee sahen sich einer Übermacht von 29 deutschen Divisionen gegenüber, die mit aller Macht vorwärts drängten. Noch in der ersten Septemberhälfte hatten Einheiten der deutschen Heeresgruppe Nord die ersten Vororte der Metropole an der Newa erreicht. Der »grüne Gürtel« im Süden und Westen der Stadt mit Parkanlagen, Palästen und Prachtbauten der Zarenzeit war jetzt unmittelbar bedroht. Das weltberühmte Schlösserensemble barg eine einmalige Fülle kulturhistorischer Kostbarkeiten. Allein Zar Peters des Großen einstige Sommerresidenz Peterhof, das »baltische Versailles«, war mit etwa 70 000 edlen Einrichtungsstücken, Gemälden, Skulpturen, Gobelins, Porzellan und Möbeln ausgeschmückt. Schloss Gatschina, ebenfalls eine Sommerresidenz der Zaren, barg eine erlesene Porzellansammlung, in der ein Service mit Jagdmotiven schon zweitausend Teile enthielt. In Pawlowsk beherbergte das Schloss, das Katharina die Große einst ihrem Sohn Pawel spendiert hatte, inmitten eines der schönsten europäischen Landschaftsparks unter anderem einen ägyptischen und einen italienischen Saal mit Originalausstattung. Auch das Alexander- und das Katharinenpalais waren Schatzkammern verschwenderischer Pracht. Das Residenzstädtchen, in dem sie sich befanden, einst Zarskoje, dann Djetskoje Selo genannt, war inzwischen auf den Namen des russischen Dichters Puschkin getauft, der hier als einer der ersten Schüler einst das Lyzeum besucht hatte.
Seit Tagen waren alle verfügbaren Kräfte, die nicht zur Vorbereitung der Verteidigung benötigt wurden, unermüdlich damit beschäftigt, Kunstschätze aus den Gemächern für den Abtransport zu verpacken. In den Gewölben der Leningrader Isaakskathedrale wurde das Inventar der Palastanlagen vor den bevorstehenden Kampfhandlungen in Sicherheit gebracht. Es waren vor allem Frauen, die in drei Schichten Tag und Nacht zu retten versuchten, was noch zu retten war. Allein aus dem Katharinenpalais bargen sie 20 000 Gegenstände: Schmuck, Utensilien, Bilder, Mobiliar, auch Tische, Sekretäre, Büsten aus Bernstein. Einige Güter wurden einfach im Keller eines nahe gelegenen Palastes eingemauert, andere im Schlosspark vergraben, wo sie unentdeckt das Kriegsende überdauerten. Manche Kleinodien trugen die Frauen eigenhändig nach Leningrad oder zogen sie auf Handkarren hinter sich her. »Für sie war die bevorstehende Aufgabe des Schlosses wie der Verlust eines nahen Angehörigen«, beschreibt der russische Museumsmitarbeiter Aleksandr Kedrinskij die Stimmungslage. »Für sie war das alles wie ihr eigen Hab und Gut. Wir, die wir in Petersburg geboren sind, haben uns von Kindheit an an dieser Schönheit erfreut. Für uns war das schrecklich, ein ganz schrecklicher Eindruck.«
Denn trotz aller Rettungsbemühungen mussten in den Palasträumen ganze Arsenale wertvoller Kunstgegenstände zurückbleiben – darunter das Hauptschmuckstück des Schlosses, das Bernsteinzimmer. Es erwies sich als ungeeignet für den eiligen Abtransport. Das Risiko, dass sich die unzähligen Plättchen von der Holzgrundlage lösten oder zu Bruch gingen, war so groß, dass eine überstürzte Verlagerung nach Leningrad unabsehbaren Schaden angerichtet hätte. Außerdem bewilligte die örtliche Parteiführung die erforderlichen Transportmittel für die Evakuierung in die Stadt nicht, da die verfügbaren Lastwagen zunächst das Parteiarchiv in Sicherheit bringen sollten. So beschloss die Museumsverwaltung schweren Herzens, die Wandverkleidungen im Katharinenpalais zurückzulassen und sie zumindest notdürftig gegen Schäden durch Kämpfe und Granatsplitter abzusichern.
Nach Angaben von Fjodor Morosow, der die Schlosshüter nach dem Krieg befragte hatte, scheiterte die sachkundige Demontage auch schlicht am Mangel kompetenter Fachleute: »Ein ehemaliger Restaurator des benachbarten Palastes von Pawlowsk hat mir erzählt, dass die fest angestellten Kunsthandwerker von Puschkin zu der Zeit alle an der Front waren. So standen nur Restauratoren aus Pawlowsk zur Verfügung, aber die verstanden natürlich nichts von Bernstein. So haben sie nur die Schutzmaßnahmen angewandt, die sie vom Umgang mit Gemälden kannten.« Die Bernsteinwände verschwanden hinter einer Schicht aus Spezialpapier, die mit Mull, Watte und dicker Pappe überklebt wurde. Aufgestellte Tafeln sollten überdies die wertvollen Wände vor Splittereinschlägen schützen. Die Fenster wurden mit Brettern vernagelt und in die Fensteröffnungen Sandsäcke gestapelt. Den wertvollen Intarsienboden bedeckten die Frauen mit einer dicken Sandschicht, um ihn nicht der Verwüstung durch Kampfhandlungen preiszugeben.
Erst als der Geschützdonner schon in unmittelbarer Nähe zu vernehmen war, ließen die Hüter des Palastes den zwei Jahrhunderte zuvor erschaffenen Bernsteinsaal zurück – in der Hoffnung, ihn eines Tages unbeschadet wieder in Besitz nehmen zu können. Schließlich wurde in den Haager Landkriegskonventionen, zu denen sich auch das Deutsche Reich verpflichtet hatte, Kulturgütern eines besetzten Landes Schutz vor Raub und Zerstörung gewährt. Unmissverständlich war in Artikel 56 dieser völkerrechtlichen Vereinbarung festgeschrieben, dass jede Beschlagnahme, jede absichtliche Zerstörung oder Beschädigung von Werken der Kunst untersagt war und geahndet werden sollte.
Am 14. September standen deutsche Infanteristen und Panzerverbände vor dem einstigen Sommersitz der Zaren. Doch in Puschkin leisteten die Verteidiger besonders erbitterten Widerstand, wie der Bericht der deutschen 269. Infanterie-Division über die Kämpfe bezeugt: »Die Russen verteidigten sich verzweifelt. Ein Häuserkampf tobte. Schritt für Schritt kämpften sich die Männer bis zur Stadtmitte durch, die um 14.00 Uhr erreicht wurde. Der Widerstand erlahmte. Um 15.00 Uhr stand das III./I.R. [Infanterie-Regiment] 489 an der Bahnlinie am Ostrand von Puschkin und organisierte seine Abwehr durch das Parkgelände am Südostrand. Das II./I.R. hatte seine Front bis an den Park verlängert und den Anschluss an das III. Btl. [Bataillon] hergestellt. Die SS-Männer hatten die russische Verteidigung am Westrand durchlöchert und waren in die Stadt eingesickert. Dadurch ließ das Flankenfeuer auf das I.R. 469 nach. Das Regiment ging von Puschkin-Mitte aus zum Angriff auf den Bahnhof über. Ein letzter Versuch des Gegners, in den Parkanlagen mit Panzern den vordringenden Deutschen den Weg zu verlegen, scheiterte nach kurzem Gefecht.«
Nach viertägigem heftigem Kampf war am Abend des 17. September 1941 das weltberühmte Residenzstädtchen fest in der Hand der Angreifer. Deutsche Soldaten, SS-Angehörige und Polizisten bezogen in den Schlössern der Zaren Quartier. Das Katharinenpalais wurde von gleich fünf Armee-Einheiten zum Sitz für ihre Stäbe erkoren.
Außer einem Granateinschlag hatte das über zweihundert Jahre alte Schloss die Kämpfe ohne größere Schäden überstanden. Offiziere der Wehrmachtsstäbe bezogen hier prunkvolle Schlafgemächer, Kommandostellen richteten sich in barockem Interieur häuslich ein. In Festsälen, Bibliotheken, Fluren und Wirtschaftsräumen wimmelte es von deutschen Soldaten, die die Pracht vergangener Zeiten bestaunten. Doch schon bald begannen viele, auf ihre Weise von der neu eroberten Residenz Besitz zu nehmen. Barockes Mobiliar und kostbare Stoffe dienten nun dazu, Unterstände und Quartiere wohnlich zu gestalten. Bedeutende Werke alter Meister schmückten die Wände von Schlafkammern der Soldaten, manche fanden auf Dauer neue Besitzer. Einen Eindruck von der Atmosphäre im Zarenschloss vermittelt der Augenzeugenbericht des damaligen Hauptmanns Hans Hundsdörfer, der mit den ersten Truppeneinheiten Puschkin, das frühere Zarskoje Selo, erreichte: »Im Verband der 6. Panzer-Division beim Vormarsch auf Leningrad passierte ich Zarskoje Selo am Tage der Besetzung. Staunend wanderte ich durch die Parkanlagen und anschließend durch den Katharinenpalast. Er war fast unversehrt. Lediglich ein Granateinschlag durch die Decke des ›Großen Saales‹ mit seinen fast 50 Metern Länge und 20 Metern Breite hatte Schaden angerichtet, einige Trümmer aus Stuck und Marmor bedeckten den Boden. Die Sowjets hatten offenbar vorgehabt, das bewegliche Kunstgut zu evakuieren. Sie konnten ihr Vorhaben wohl infolge unseres stürmischen Vormarsches nicht vollenden. Immerhin waren die eingelegten Böden mit einer Sandschicht abgedeckt und die großen Chinavasen mit Wasser gefüllt. Unsere Landser, übermüdet, hatten es sich in den vielen Räumlichkeiten des Palastes sofort bequem gemacht, leider mit nicht viel Rücksicht auf die wundervolle Einrichtung. Schlafende Soldaten mit verschmutzten Stiefeln auf den kostbaren Kanapees und Sesseln konnte man überall beobachten, auch schon mal ein grobes Schild, hingenagelt in die eingelegten Türen: ›Belegt von der 1. Kompanie.‹«
Auch das allerheiligste Gemach des Schlosses blieb von Kunstbanausen und gnadenlosen Souvenirjägern unter den Soldaten nicht verschont, wie Hundsdörfer feststellen musste: »So kam ich auch in das Bernsteinzimmer. Hier waren die Wände mit dicker Pappe zugeklebt und abgedeckt. Ich sah zwei Landser, wie sie sich mühten, aus Neugierde die Verkleidung herunterzureißen. Zutage kamen wunderbar leuchtende Bernstein-Schnitzereien als Rahmen eines Mosaikbildes. Als die beiden ihre Seitengewehre zückten, um sich ›Erinnerungsstücke‹ herauszubrechen, schritt ich ein. Anderntags sah das Bernsteinzimmer schon einigermaßen wüst aus. Viel Pappe war abgerissen, Schnitzereien abgeschlagen, Bernsteinspäne bedeckten den Fußboden entlang der Wände.«
Spuren von Abgesandten einer Kulturnation, die – laut Propaganda – aufgebrochen waren, die Zivilisation des Abendlandes gegen »bolschewistische Untermenschen« zu verteidigen. »Die Soldaten, die in die Gebäude eindrangen«, berichtet der russische Restaurator Aleksandr Kedrinskij, »haben das, was ihnen gerade so gefiel, einfach mitgenommen. Sie haben Bilder und Gemälde aus den Türverkleidungen geschnitten, Medaillons und Köpfe aus den Kaminen gerissen, die Verzierungen der Wände abgeschlagen und aus dem Bernsteinzimmer Reliefs und Medaillons entfernt, die gleich ins Auge sprangen, mit Motiven aus der Bibel oder der antiken Mythologie. Das haben sie abgenommen und sich in die Taschen gesteckt.«
Doch solcher Art blindem Kunstfrevel wurde schnell Einhalt geboten. Bereits am nächsten Tag ließ der zuständige »Kunstschutzbeauftragte« der Wehrmacht das Bernsteinzimmer absperren und gegen mutwillige Plünderer bewachen, die meistens nicht die geringste Ahnung von der wahren Bedeutung des »achten Weltwunders« hatten. Mit deutlichen Worten mussten die Wachsoldaten Kameraden in die Schranken weisen, die auf der Jagd nach Andenken mit gezücktem Dolch der Bernsteinwand zu Leibe rücken wollten.
Bleibendere Folgen als dieser wilde Vandalismus richteten Eingriffe an, die wesentlich behutsamer und unauffälliger vor sich gingen. Es muss in jenen Tagen nach der Eroberung Puschkins gewesen sein, dass komplette Bestandteile aus dem Bernsteinzimmer spurlos verschwanden – unverhohlene Selbstbedienung am Kulturerbe der Menschheit. Erst Jahrzehnte später sind einzelne dieser Diebesgüter aus dem Zarenzimmer in Deutschland wieder aufgetaucht, wovon später noch die Rede sein wird.
Die Wehrmachtsführung jedenfalls sah sich genötigt, Maßnahmen zum »Schutz« des Bernsteinzimmers zu veranlassen. So findet sich im Tagebuch der 18. Armee unter dem 29. September 1941 der Eintrag: »Rittmeister Graf Solms, vom O.K.W. [Oberkommando der Wehrmacht] mit Erfassung der Kunstgegenstände in den Zarenschlössern beauftragt, bittet um Schutz für das Zarenschloss Puschkin, das durch Bombentreffer leicht zerstört und zur Zeit in vorderster Linie durch unachtsames Verhalten der Truppe gefährdet ist.«
Nicht vor Kampfhandlungen allerdings musste das verletzliche Schmuckstück abgeschirmt werden, wie es ein deutsches Propagandaflugblatt aus jener Zeit glauben machen wollte: »Seit der Einschließung Leningrads durch deutsche Truppen, September 1941, lag das alte Zarenschloss in der vordersten Feuerlinie und war der Zerstörung ausgesetzt. Deutsche Soldaten retteten damals das alte Bernsteinzimmer Friedrichs I. aus der Feuerlinie ...«Es waren vorwiegend die eigenen Soldaten, vor denen das kostbare Getäfel des Schutzes bedurfte. Dabei ging es gar nicht in erster Linie darum, hochwertiges Kulturgut an Ort und Stelle möglichst unversehrt für die Nachwelt zu bewahren. In Wirklichkeit durfte das Bernsteinzimmer deshalb nicht angetastet werden, weil sein möglichst kompletter Diebstahl längst beschlossen war, und zwar auf höchste Weisung. Der vorgesehene Abtransport des historischen Saals war Teil eines groß angelegten Kunstraubzugs, wie er in der Geschichte der Kriege bis heute ohne Beispiel ist.