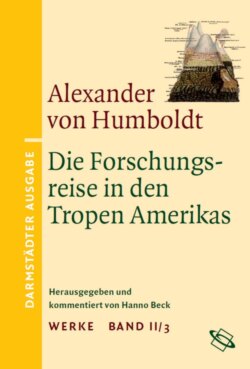Читать книгу Werke - Hanno Beck - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[Von tropischen Zugvögeln]
ОглавлениеDie Ufer des oberen Guainía sind von viel weniger fischfangenden Vögeln bewohnt als die des Casiquiare, des Meta und des Aranca, wo den Ornithologen überaus reiche Ausbeute zur Vermehrung der europäischen Sammlungen zu Gebote stehen. Die Seltenheit dieser Tiere beruht wohl teils auf dem Mangel an Untiefen und niedrigen Ufern, teils auf der Beschaffenheit dieser Schwarzen Wasser, die (ihrer Reinheit wegen) den Wasserinsekten und Fischen weniger Nahrung bieten. Trotz dieser Seltenheit nähren sich die Indianer der Gegend zweimal im Jahr von Zugvögeln, welche auf ihren weiten Wanderungen auf den Gewässern des Río Negro ausruhen. Wenn im Orinoco das erste Hochwasser eintritt, nach dem Frühlingsäquinoktium nämlich, zieht eine unzählbare Menge Enten (patos carreteros) von 8 und 3° nördlicher Breite zu 1 und 4° südlicher Breite in südsüdöstlicher Richtung. Diese Tiere verlassen dann das Tal des Orinoco, vermutlich weil die zunehmende Tiefe der Wasser und die Überschwemmung der Ufer sie am Fang der Fische, Insekten und Wassergewürme hindern. Sie werden dann beim Übergang des Río Negro zu Tausenden getötet. Sie erscheinen auf der Reise zum Äquator sehr fett und schmackhaft; wenn hingegen im September, da der Orinoco fällt und in sein Bett zurücktritt, die Enten – sei es durch die Stimme der erfahrensten Zugvögel belehrt oder durch den inneren Trieb geleitet, der, weil er nicht erklärt werden kann, Instinkt heißt – vom Amazonenstrom und vom Río Branco ihre Rückreise nach Norden unternehmen, sind sie zu mager, um die Eßlust der Indianer des Río Negro zu reizen.; sie entgehen der Verfolgung dann um so eher, da sie von einer Art Reiher (gavanes) begleitet werden, die eine vortreffliche Nahrung abgeben. So speisen dann die Eingeborenen im März Enten und im September Reiher. Sie konnten uns nicht sagen, was zur Zeit der Hochwasser des Orinoco aus den gavanes wird und warum diese die patos carreteros auf ihren Wanderungen vom Orinoco zum Río Branco nicht begleiten. Diese regelmäßigen Reisen der Vögel aus einem Tropenland ins andere, in einer Zone, deren Temperatur das ganze Jahr hindurch unverändert bleibt, sind sehr außerordentliche Erscheinungen. Auch auf den Südküsten der Antillen-Inseln treffen alljährlich zur Zeit der Überschwemmungen der großen Ströme der Tierra Firme zahlreiche Schwärme von Zugvögeln vom Orinoco und seinen Zuflüssen ein. Es ist wahrscheinlich, daß die Wechsel von Trockenheit und Feuchtigkeit in den Äquinoktialländern auf die Gewohnheiten der Tiere ähnliche Wirkungen haben wie in unseren Zonen die großen Temperaturwechsel. Die Sommerwärme und die Insektenjagd locken die Kolibris in die nördlichen Länder der Vereinigten Staaten und nach Kanada bis zu den Parallelkreisen von Paris und Berlin; ebenso zieht ein erleichterter Fischfang die Schwimmvögel und die Stelzenläufer von Norden nach Süden, vom Orinoco zum Amazonenstrom. Kaum ist eine andere Erscheinung wunderbarer und in geographischer Hinsicht noch weniger aufgeklärt als die Richtung, die Ausdehnung und die Grenzen der Züge der Vögel.
*
Sobald wir aus dem Pimichín in den Río Negro gelangt waren und den kleinen Katarakt beim Zusammenfluß beider Ströme passiert hatten, entdeckten wir in einer Viertelstunde Entfernung die Mission Maroa. Dieses Dorf, worin 150 Indianer wohnen, bot einen überraschend wohlhabenden und gedeihlichen Anblick. Wir kauften hier etliche schöne Arten lebendiger Tukane (piapoco), eines kühnen Vogels, dessen Intelligenz sich wie die unserer zahmen Raben entwickelt. Oberhalb von Maroa kamen wir zu unserer Rechten erst an der Mündung des Aquio, danach an der des Tomo vorbei. An den Ufern dieses letzteren Flusses wohnen die Cheruvichachena-Indianer, wovon ich einige Familien zu San Francisco Solano gesehen habe. Nebenbei ist der Tomo durch die heimlichen Verbindungen bemerkenswert, die er mit den portugiesischen Besitzungen begünstigt. Er nähert sich dem Río Guaicia (Xié), und die Mission von Tomo erhält zuweilen auf diesem Wege Indianer-Flüchtlinge des unteren Guainía. Wir betraten die Mission nicht, aber der Pater Zea erzählte uns lächelnd, wie die Indianer von Tomo und Moroa einst in großen Aufstand gerieten, als sie gezwungen werden sollten, den berüchtigten Teufelstanz auszuführen. Der Missionar hatte den Einfall, die Zeremonien, wodurch die piaches, welche gleichzeitig Priester, Ärzte und Zauberer sind, den bösen Geist jolokiamo beschwören, auf eine possierliche Art nachäffen zu lassen. Er glaubte, im Teufelstanz ein treffliches Mittel zu finden, um seine Neubekehrten zu überzeugen, daß der jolokiamo nun weiter keine Gewalt über sie habe. Etliche den Zusagen des Missionars vertrauende Indianer waren bereit, die Rolle der Teufel zu übernehmen; auch hatten sie schon die Jaguarfelle mit langen Schleppschwänzen angezogen und sich mit schwarzen und gelben Federn geschmückt. Der Platz vor der Kirche wurde mit den in die Mission verlegten Soldaten umstellt, damit das Vorhaben der Ordensmänner desto besser Eingang finden könne. Die Indianer, welche dem Erfolg dieses Tanzes und der verheißenden Ohnmacht des bösen Geistes nicht recht trauten, wurden genötigt, dem Fest beizuwohnen. Nun aber gewann die Partei der Alten und Furchtsamen die Oberhand; ein abergläubischer Schrecken bemächtigte sich ihrer, und jedermann wollte al monte [in den Wald] fliehen, so daß der Missionar sein Vorhaben, den Dämon der Eingeborenen zu verspotten, auf weitere Zeit zu verschieben gutfand. Was für seltsame Einfälle erzeugt nicht die Phantasie eines müßigen Mönchs, der sein Leben in den Wäldern zubringt, entfernt von allem, was ihn mit menschlicher Zivilisation in Verbindung halten könnte! Der Eifer, womit in Tomo der geheimnisvolle Teufelstanz öffentlich dargestellt werden sollte, ist jedoch um so befremdlicher, als alle schriftlichen Berichte der Missionare von ihren Bemühungen Kunde geben, die Totentänze, die „Tänze der heiligen Trompete“ und den alten „Schlangentanz“, den queti, auszurotten, worin die listigen Tiere dargestellt werden, welche vom Wald herkommen und mit den Menschen trinken, um sie zu hintergehen und ihnen die Frauen zu rauben.
Nach zweistündiger Fahrt trafen wir bei der Mündung des Tomo in der kleinen Mission von San Miguel de Davipe ein, die 1775 nicht von einem Ordensmann, sondern von einem Leutnant der Miliz, Don Francisco Bobadilla, gegründet worden war. Der Missionar dieser Station, der Pater Morillo, bei dem wir ein paar Stunden verweilten, empfing uns sehr gastfreundlich; er setzte uns sogar Madeirawein vor. Als Tafelluxus hätten wir ein Stück Weizenbrot vorgezogen. Die Entbehrung des Brotes wird auf die Dauer empfindlicher als die eines geistigen Getränks. Die Portugiesen vom Amazonenstrom bringen von Zeit zu Zeit kleine Vorräte von Madeirawein an den Río Negro, und da das Wort madera im Kastilianischen Holz bedeutet, tragen arme Mönche, die im Studium der Geographie wenig bewandert sind, Bedenken, das Meßopfer mit Madeirawein zu begehen; sie hielten ihn für einen aus einem Baumstamm herrührenden, gegorenen Saft wie den Palmwein, und sie verlangten vom guardián der Missionen Aufschluß, ob der vino de madera ein Traubenwein (de uvas) oder der Saft eines Baumes (vino de algún palo) sei. Schon in den ersten Zeiten nach der conquista war Zweifel aufgestiegen, ob den Priestern gestattet werden könne, sich zum Meßopfer eines dem Traubenwein ähnlichen gegorenen Pflanzensaftes zu bedienen. Die Frage wurde, wie man denken kann, verneinend entschieden.
Wir kauften in Davipe einige Speisevorräte, hauptsächlich Hühner und ein Schwein. Dieser Einkauf hatte großen Wert für unsere Indianer, die lange kein Fleisch gegessen hatten. Sie drängten uns zur Abreise, um die Insel Dapa zu erreichen, wo das Schwein geschlachtet und nachts gebraten werden sollte. Kaum hatten wir Zeit, im Kloster (convento) große Haufen von Maniharz und das Tauwerk zu untersuchen, welches aus dem Palmbaum chiquichiqui verfertigt wird und in Europa bekannter zu sein verdiente. Dieses Tauwerk ist überaus leicht; es schwimmt auf dem Wasser und ist zum Gebrauch für Stromfahrten dauerhafter als Tauwerk aus Hanf. Auf der See erfordert seine Erhaltung öftere Befeuchtung und Schutz vor der brennenden Sonne des Tropenhimmels. Der durch seine Reise zur Erforschung des Parima-Sees im Land berühmte Don Antonio Santos ist es, welcher die Indianer des spanischen Río Negro die Blattstiele des chiquichiqui zu benutzen gelehrt hat, eines Palmbaums mit gefiederten Blättern, von dem uns weder die Blüten noch die Früchte zu Gesicht gekommen sind. Dieser Offizier ist der einzige Weiße, welcher von Angostura nach Gran Pará auf dem Landweg von den Quellen des Río Caroní zu denen des Río Branco gelangt ist. Er hatte die Verfertigung des Tauwerks aus der Chiquichiqui-Palme in den portugiesischen Kolonien erlernt und diesen Industriezweig nach seiner Rückkehr vom Amazonenstrom in den Missionen von Guayana eingeführt. Es wäre zu wünschen, daß große Seilereien an den Gestaden des Río Negro und des Casiquiare errichtet werden könnten, um dieses Tauwerk zu einem Gegenstand des Handelsverkehrs für Europa zu machen. Eine kleine Menge davon wird bereits von Angostura [Ciudad Bolívar] nach den Antillen ausgeführt. Sie werden hier um 50 bis 60 % wohlfeiler verkauft als die Taue aus Hanf. Weil nur junge Palmbäume dafür benutzt werden können, müßten diese angepflanzt und kultiviert werden.
Ein wenig oberhalb der Mission von Davipe nimmt der Río Negro einen Arm des Casiquiare auf, dessen Dasein eine sehr merkwürdige Erscheinung in der Geschichte der Stromverzweigungen ist. Dieser Arm geht nordwärts von Vasiva vom Casiquiare aus, unter dem Namen des Itinivini; und nachdem er eine flache und fast völlig unbewohnte Landschaft in einer Länge von 25 lieues durchzogen hat, ergießt er sich in den Río Negro als Río Conorichite. Er schien mir nahe seiner Mündung über 120 Toisen breit zu sein; er vergrößert das Volumen seines schwarzen durch eine große Masse weißen Wassers. Obgleich der Conorichite eine sehr reißende Strömung hat, kürzt man die Fahrt von Davipe nach Esmeralda durch diesen natürlichen Kanal um drei Tagereisen ab. Man kann über die doppelte Verbindung zwischen dem Casiquiare und dem Río Negro nicht erstaunt sein, wenn man sich erinnert, wie viele amerikanische Ströme bei ihrem Zusammenfluß mit anderen Strömen Arten von Deltas bilden. So ergießen sich der Río Branco und der Río Japurá mit zahlreichen Armen in den Río Negro und in den Amazonenstrom. Beim Japurá gibt es noch eine viel außerordentlichere Erscheinung. Ehe dieser Fluß sich mit dem Amazonenstrom verbindet, entsendet er, der der Hauptsammler ist, drei Arme – Uaranapu, Manhama und Avateparana – zum Japurá, welcher doch nur ein Nebenfluß ist. Der portugiesische Astronom, Herr Ribeiro, hat diese bedeutende Tatsache festgestellt. Der Amazonenstrom gibt sein Wasser an den Japurá ab, bevor er selbst diesen Nebenfluß aufnimmt.
Der Río Conorichite oder Itinivini hat früher eine wichtige Rolle im Sklavenhandel der Portugiesen auf spanischem Boden gespielt. Die Sklavenhändler fuhren den Casiquiare und den Caño Mee aufwärts in den Conorichite; von da brachten sie ihre Piroge durch eine Portage zu den Rochelas von Manuteso, um in den Atabapo zu gelangen. Ich habe diesen Weg auf meiner Reisekarte des Orinoco verzeichnet. Dieser abscheuliche Handel hat bis gegen 1756 gedauert. Die Expedition von Solano und die Errichtung der Missionen an den Gestaden des Río Negro haben ihm ein Ende gemacht. Alte von Karl V. und von Philipp III. erlassene Gesetze hatten unter den schwersten Strafen (wie der Verlust bürgerlicher Ämter und Geldbußen von 2000 Piastern) „die Glaubensbekehrung der Eingeborenen durch gewaltsame Mittel und den Gebrauch von Soldaten gegen sie“ untersagt; trotz dieser humanen und weisen Gesetze hat der Río Negro noch um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts, wie Herr de La Condamine sich ausdrückt, der europäischen Politik kein anderes Interesse gewährt als die Erleichterung der entradas oder feindseligen Überfälle und die Begünstigung des Sklavenverkaufs. Die Cariben, ein Handel und Krieg treibendes Volk, erhielten von Portugiesen und Holländern Messer, Angeln, Spiegelchen und allerlei Glaswaren. Sie reizten die indianischen Häuptlinge zu gegenseitigen Fehden auf; sie kauften ihnen die Gefangenen ab und führten zugleich noch andere weg, deren sie sich durch List oder Gewalt bemächtigen konnten. Diese Überfälle der Cariben umfaßten ein sehr ausgedehntes Gebiet. Sie nahmen ihren Weg von den Gestaden des Essequibo und des Caroní durch den Rupunuri und den Paraguamuzi einerseits in gerader südlicher Richtung zum Río Branco; andererseits in südwestlicher Richtung mittels der Portagen zwischen dem Río Paragua, dem Caura und dem Ventuari. Nachdem sie bei den zahlreichen Völkerschaften des oberen Orinoco eingetroffen waren, trennten sich die Cariben in verschiedene Abteilungen, um durch den Casiquiare, den Cababury, den Itinivini und den Atabapo an vielen Stellen zugleich die Gestade des Guainía oder Río Negro zu erreichen und mit den Portugiesen Sklavenhandel zu treiben. So ist den unglücklichen Eingeborenen die Nähe der Europäer verderblich geworden, lange bevor sie mit ihnen in Berührung kamen. Die gleichen Ursachen haben allenthalben gleiche Wirkungen zur Folge. Der barbarische Handel, den zivilisierte Völker an der afrikanischen Küste getrieben haben und zum Teil noch treiben, dehnt seinen verderblichen Einfluß bis in Gegenden aus, wo das Dasein weißer Menschen völlig unbekannt ist.
Nachdem wir die Mündung des Conorichite und die Mission von Davipe verlassen hatten, trafen wir bei Sonnenuntergang auf der Insel Dapa ein, die mitten im Strom eine sehr malerische Lage hat. Zu unserem größten Erstaunen fanden wir hier einiges bebautes Land und auf einem kleinen Hügel eine indianische Hütte. Vier Eingeborene saßen um ein Feuer aus Strauchwerk und aßen eine Art weißen schwarzgefleckten Teig, der unsere Neugierde nicht wenig reizte. Es waren vachacos, große Ameisen, deren Hinterteil einem Fettknopf gleicht. Sie waren gedörrt und im Rauch geschwärzt worden. Wir sahen mehrere Säcke voll über dem Feuer hängen. Die guten Leute achteten nur wenig auf uns; inzwischen fanden sich in der engen Hütte über 14 Personen, die völlig nackt in übereinander angebrachten Hängematten lagerten. Als der Pater Zea eintraf, wurde er mit großen Freudenäußerungen empfangen. Der Grenzwache wegen finden sich am Río Negro mehr Soldaten als an den Ufern des Orinoco, und allenthalben, wo Soldaten und Mönche sich die Herrschaft über die Indianer streitig machen, zeigen diese mehr Anhänglichkeit an die Mönche. Zwei junge Frauen verließen die Hängematten, um uns Cassave-Kuchen zu bereiten. Auf die Frage eines Dolmetschers, ob der Boden der Insel fruchtbar sei, antworteten sie, der Manioc gedeihe nicht gut, hingegen sei es „ein gutes Ameisen-Land“, und an Lebensmitteln hätten sie keinen Mangel. Diese vachacos liefern wirklich den Indianern am Río Negro und am Guainía ein wichtiges Nahrungsmittel. Die Ameisen werden nicht als Leckerei gespeist, sondern weil, wie die Missionarien sich ausdrücken, das Ameisenfett (der weiße Teil des Unterleibs) ein sehr kräftiges Nahrungsmittel ist. Als die Cassave-Kuchen fertig waren, ließ der Pater Zea, dessen Fieber die Eßlust mehr anzureizen als zu schwächen schien, sich einen kleinen Sack mit geräucherten vachacos bringen. Er mengte die zerquetschten Insekten dem Manioc-Mehl bei und lud uns ein, die Mischung zu kosten. Diese glich ein wenig einer Mischung aus Brotkrumen und ranziger Butter. Der Manioc schmeckte nicht sauer; allein ein Überrest europäischer Vorurteile hinderte uns, den Elogen beizupflichten, welche der gute Missionar dem, was er eine vortreffliche Ameisenpaste nannte, spendete.
Der Regen fiel so gewaltig, daß wir genötigt waren, in der sonst schon vollgepfropften Hütte zu übernachten. Die Indianer schliefen nur von 8 bis 2 Uhr; die übrige Zeit brachten sie in ihren Hängematten mit Schwatzen zu, oder sie bereiteten ihren bitteren Cupana-Trank, schürten das Feuer an und klagten über Kälte, obgleich die Temperatur der Luft 21° betrug. Die Sitte, vier bis fünf Stunden vor Aufgang der Sonne wach und auch auf den Beinen zu sein, herrscht überall bei den Indianern am Guianía. Wenn man daher bei den entradas die Eingeborenen überraschen will, werden dafür die Stunden des ersten Schlafs von 9 Uhr bis Mitternacht gewählt.
Wir verließen die Insel Dapa lange vor der Morgendämmerung, und trotz der schnellen Strömung und des angestrengten Fleißes unserer Ruderer trafen wir erst nach zwölf Stunden Flußfahrt beim Fortín [Schanze] von San Carlos del Río Negro ein. Zur Linken sahen wir die Mündung des Casiquiare und zur Rechten die kleine Insel Cumarai. Im Land glaubt man, das Fortín liege gerade unter dem Äquator; aber den Beobachtungen zufolge, die ich auf dem Felsen Culimacari angestellt habe, liegt es unter 1° 54′ 11″. Jede Nation ist geneigt, den Raum ihrer Besitzungen auf den Karten zu erweitern und ihre Grenzen auszudehnen. Weil man unterläßt, die Reiseentfernungen auf Distanzen in gerader Linie zu reduzieren, sind die Grenzen überall am meisten verzerrt. Die Portugiesen geben, vom Amazonenstrom ausgehend, die Lage von San Carlos und São José de Marabitanas zu weit nördlich an, während die Spanier, von den Küsten von Caracas ausgehend, dieselbe zu weit südlich rücken. Diese Betrachtung gilt für alle Karten der Kolonien. Sobald man weiß, wo sie verfertigt wurden und in welcher Richtung man an die Grenzen gekommen ist, läßt sich voraussagen, nach welcher Seite die Irrtümer in Breiten- und Längenbestimmungen gehen.
In San Carlos wurden wir beim Kommandanten des Forts, einem Milizleutnant, einquartiert. Auf einer Galerie des Hauses genoß man eine hübsche Aussicht über drei sehr lange und mit dichter Vegetation bewachsene Inseln. Der Strom läuft in gerader Richtung von Norden nach Süden, als ob sein Bett durch Menschenhand gegraben wäre. Der immer bewölkte Himmel verleiht dieser Landschaft ein ernstes und finsteres Aussehen. Im Dorf fanden wir etliche Stämme der juvia, des majestätischen Gewächses, von dem die dreieckigen Mandeln herkommen, die in Europa Mandeln vom Amazonenstrom [Para- oder amerikanische Nüsse; Anmerkung des Hrsg.] heißen. Wir haben es unter dem Namen Bertholletia excelsa bekanntgemacht. Die Bäume erreichen in acht Jahren eine Höhe von 30 Fuß.
Die militärische Besatzung dieser Grenze bestand aus 17 Soldaten, wovon 10 zur Sicherheit der benachbarten Missionare abgestellt waren. Die Luft ist so feucht, daß kaum vier Flinten zum Feuern tauglich waren. Die Portugiesen haben 25 bis 30 besser gekleidete und besser bewaffnete Soldaten im Fortín São José de Marabitanas. In der Mission von San Carlos fanden wir nichts als eine garita, ein viereckiges, aus ungebrannten Backsteinen aufgeführtes Gebäude, worin sechs Feldstücke standen. Das Fortín oder, wie man hier gerne sagt, das Castillo de San Felipe liegt San Carlos gegenüber, am westlichen Ufer des Río Negro. Der Kommandant trug Bedenken, die fortaleza dem Herrn Bonpland und mir zu zeigen; unsere Pässe drückten zwar die Befugnis aus, Berghöhen zu messen und trigonometrische Arbeiten überall auf dem Lande, wo ich es gut fände, vorzunehmen, nicht aber feste Plätze zu besichtigen. Unser Reisegefährte, Don Nicolas Soto, ein spanischer Offizier, war glücklicher als wir. Man erlaubte ihm, über den Fluß zu setzen. Er fand auf einer kleinen abgeholzten Ebene den Anfang einer Erdfestung, die, wäre sie vollendet, 500 Mann Besatzung für ihre Verteidigung erfordert hätte. Es ist ein viereckiger umschlossener Raum mit kaum sichtbarem Graben. Die Brustwehr hat fünf Fuß Höhe; sie wird durch Steinblöcke verstärkt. Zwei Bastionen auf der Stromseite könnten 4 bis 5 Stücke aufnehmen. Das ganze Werk enthält 14 oder 15 Kanonen, die großenteils demontiert sind und von zwei Mann bewacht werden. Um das Fortín her stehen drei oder vier indianische Hütten. Man nennt sie das Dorf San Felipe, und um das Ministerium in Madrid an das Wachstum dieser christlichen Niederlassungen glauben zu machen, werden für das angebliche Dorf eigene Kirchenspielregister geführt. Abends, nach dem Angelus, wurde dem Kommandanten Rapport erstattet und in ganz ernsthaftem Ton gemeldet, daß um die Festung her alles ruhig zu sein scheine. Das erinnerte mich an die Erzählungen der Reisenden von den Festungen an der Küste Guineas, die zum Schutz europäischer Faktoreien dienen und 4 oder 5 Mann Besatzung haben. Die Soldaten von San Carlos sind nicht glücklicher als die der afrikanischen Faktoreien, weil auf diesen so entfernten Stationen dieselben Mißbräuche der Milizverwaltung herrschen. Einer von alters her geduldeten Gewohnheit zufolge wird die Truppe nicht in Geld bezahlt, sondern die Hauptleute liefern ihr zu hohen Preisen Kleidungsstücke (ropa), Salz und Lebensmittel. In Angostura ist die Sorge, nach den Missionen von Caroní, Caura und Guainía versetzt oder, richtiger gesprochen, verbannt zu werden, so groß, daß man Mühe hat, die nötigen Rekruten zu erhalten. Die Lebensmittel sind sehr teuer an den Ufern des Río Negro, weil nur sehr wenig Manioc und Bananen gepflanzt werden und weil der Strom (gleich allen, die schwarzes und klares durchsichtiges Wasser haben) fischarm ist. Die besten Vorräte kommen aus den portugiesischen Besitzungen am Río Negro, wo mehr Arbeitsfleiß und Wohlstand unter den Indianern herrschen. Dessenungeachtet beträgt dieser Handel mit den Portugiesen kaum eine jährliche Einfuhr von 2000 Piaster an Wert.
Die Ufer des oberen Guainía werden einst mehr hervorbringen, wenn die Ausrottung der Wälder die ungemein große Feuchtigkeit der Luft und des Bodens vermindert haben wird und wenn die Insekten, welche die Wurzeln und Blätter der krautartigen Pflanzen fressen, weniger häufig sein werden. Im gegenwärtigen Zustand des Ackerbaus gedeiht der Mais fast gar nicht; der Tabak, welcher von vorzüglicher Qualität und an der Küste von Caracas sehr begehrt ist, wird nur an Stellen, wo sich altes Mauerwerk und verfallende Hütten beim pueblo viejo finden, mit Erfolg angepflanzt. Die nomadische Lebensweise der Eingeborenen hat zur Folge, daß es an solchen alten Bauplätzen, wo der Boden aufgewühlt und, ohne Pflanzen zu tragen, dem Einfluß der Luft ausgesetzt ist, nicht fehlt. Der in frisch abgeholzten Boden ausgesäte Tabak ist wässerig und ohne Aroma. Der Indigo wächst wild in der Nähe der Dörfer Maroa, Davipe und Tomo. Unter einer Verwaltung, die von der jetzt in diesen Gegenden anzutreffenden verschieden ist, wird am Río Negro eines Tages künftig Indigo, Kaffee, Cacao, Mais und Reis im Überfluß gedeihen.
Da man in 20 bis 25 Tagen von der Mündung des Río Negro nach Gran Pará gelangt, hätten wir nur wenig mehr Zeit gebraucht, den Amanzonenstrom hinab bis an die brasilianische Küste zu fahren, als wir benötigten, um auf dem Casiquiare und dem Orinoco die Nordküste von Caracas zu erreichen. In San Carlos vernahmen wir, daß es wegen der politischen Verhältnisse für den Augenblick sehr schwierig sein würde, aus den spanischen nach den portugiesischen Niederlassungen zu gelangen; erst nach unserer Rückkehr nach Europa sind wir mit dem ganzen Umfang der Gefahr bekannt geworden, welcher uns einer Fortsetzung der Reise bis Barcelos ausgesetzt haben würde. In Brasilien wußte man vielleicht aus Zeitungen, deren wohlmeinende und unvorsichtige Geschäftigkeit den Reisenden öfters nachteilig geworden ist, daß ich die Missionen am Río Negro besuchen und den natürlichen Kanal besichtigen wollte, welcher zwei große Stromsysteme verbindet. In diesen öden Wäldern hatte man Instrumente bisher nur in den Händen der Grenzkommission gesehen, und die Unterbeamten der portugiesischen Regierung begriffen ebensowenig wie der gute Missionar, von welchem ich im vorhergehenden Kapitel gesprochen habe, wie ein vernünftiger Mensch sich den Beschwerden einer langen Reise aussetzen könnte, „um Ländereien zu messen, die nicht sein Eigentum sind“. Man hatte Befehle erteilt, um sich meiner Person, meiner Instrumente und besonders meiner für die Sicherheit der Staaten so gefährlichen Verzeichnisse astronomischer Beobachtungen zu bemächtigen. Man wollte uns auf dem Amazonenstrom nach Gran Pará führen und von da nach Lissabon zurücksenden. Wenn ich diese Pläne erwähne, deren Gelingen einen nachteiligen Einfluß auf die Dauer einer zu fünf Jahren berechneten Reise gehabt hätte, geschieht es, um darzutun, wie sehr überhaupt der die Regierung der Kolonien beseelende Geist von dem verschieden ist, welcher die Angelegenheiten im Mutterland leitet. Sobald das Ministerium in Lissabon vom Diensteifer seiner Unterbeamten Kenntnis erhielt, wurde Befehl erteilt, meine Arbeiten nirgends zu stören, sondern sie vielmehr zu begünstigen, falls ich irgendwo meinen Weg durch die portugiesischen Besitzungen nehmen sollte. Dieses aufgeklärte Ministerium war es auch, das mir die erste Kunde von seiner mich betreffenden Fürsorge gab, die ich aus so großer Entfernung unmöglich hätte anrufen können.
Unter den Portugiesen, die wir in San Carlos antrafen, fanden sich verschiedene Militärs, welche die Reise von Barcelos nach Gran Pará gemacht hatten. Ich will hier all das zusammenstellen, was ich über den Lauf des Río Negro in Erfahrung bringen konnte. Weil man nur selten den Amazonenstrom weiter als bis zur Mündung des Cauaburi, eines durch den Ertrag der Sarsaparille, die hier eingesammelt wird, berühmten Flusses, hinauffährt, ist alles, was neuerlich selbst in Río de Janeiro über die Geographie dieser Gegenden publiziert wurde, höchst verworren. Beim Hinunterfahren des Guainia oder Río Negro kommt man rechts beim Caño Maliapa, links bei den Caños Dariba und Eny vorbei. Auf 5 lieues Entfernung, also etwa unter 1° 38′ nördlicher Breite, befindet sich die Insel San José, welche provisorisch (denn es ist in diesem endlosen Grenzprozeß alles provisorisch) als das südliche Ende der spanischen Besitzungen betrachtet wird. Etwas unterhalb dieser Insel, an einer Stelle, wo viele verwilderte Orangenbäume wachsen, zeigte man uns einen kleinen 200 Fuß hohen Felsen mit einer Höhle, der die Missionare den Namen der Glorieta von Cocuí geben. Dieser Lustort, denn dies ist die Bedeutung des kastilianischen Wortes glorieta, weckt wenig angenehme Erinnerungen. Hier hielt Cocuí, der Häuptling der Manitivitano, der nämliche, von dem schon früher die Rede war, seinen Harem; und – um alles darzulegen – aus einer besonderen Vorliebe verzehrte er die schönsten und fettesten Frauen. Ich zweifle nicht, daß Cocuí ein wenig Menschenfresser gewesen sei. „Es ist dies“, sagt der Pater Gili mit der Einfalt eines amerikanischen Missionars, „eine schlimme Gewohnheit dieser sonst so guten und milden Völker von Guayana.“ Ich sollte aber auch der Wahrheit zuliebe hinzusetzen, daß die Erzählungen vom Harem und von den Orgien des Cocuí am unteren Orinoco viel mehr als an den Ufern des Guainia verbreitet sind. In San Carlos wird sogar der Verdacht einer die menschliche Natur entehrenden Handlung geleugnet; vielleicht weil Cocuís Sohn, der ein Christ geworden ist und mir ein verständiger und gesitteter Mann zu sein schien, gegenwärtig Hauptmann der Indianer von San Carlos ist?
Unterhalb der Glorieta folgen auf portugiesischem Gebiet das Fort Säo José de Marabitanas, die Dörfer Joam Baptista de Mabbe, São Marcelino (unfern der Einmündung des Guaicia oder Xié, wovon oben öfters die Rede war), Nossa Senhora da Guya, Boavista in der Nähe des Río Içana, São Felipe, São Joaquim de Coana an der Mündung des bekannten Río Guape [Uaupés], Calderón, Saõ Miguel de Iparaña mit einem Fortín, Säo Francisco de las Caculbäes und endlich der feste Platz São Gabriel de Cachoeiras. Ich verweile absichtlich bei diesen geographischen Angaben, um zu zeigen, wie viele Niederlassungen die portugiesische Regierung selbst in diesem entlegenen Teil Brasiliens gegründet hat. Es finden sich 11 Dörfer auf einem Umfang von 25 lieues; bis zur Einmündung des Río Negro sind mir deren noch 19 bekannt, ungerechnet die Städte von Thomare, Moreira (nahe beim Río Demenene oder Uaraca, wo vormals die Guayanna-Indianer wohnten), Barcelos, San Miguel del Río Branco in der Nähe des gleichnamigen Flusses, welcher in den Märchen über Dorado eine so bedeutende Rolle spielte, Moura und Villa de Río Negro. Demnach haben die Ufer dieses einzigen Zuflusses des Amazonenstroms eine zehnmal stärkere Bevölkerung als sämtliche Ufer des oberen und unteren Orinoco, des Casiquiare, des Atabapo und des spanischen Río Negro zusammengenommen. Dieser Kontrast beruht keineswegs auf der verschiedenen Fruchtbarkeit des Bodens oder auf der bequemeren Flußfahrt des Río Negro in seiner unveränderten Richtung von Nordwesten nach Südosten; vielmehr ist er das Ergebnis politischer Institutionen. Bei der portugiesischen Kolonialverwaltung stehen die Indianer gleichmäßig unter Militär- und Ziviloberen und unter den Karmeliter-Ordensmännern. In dem gemischten Regiment erhält sich die weltliche Regierung unabhängig. Die Franziskaner-Mönche hingegen, welchen die Missionen am Orinoco zustehen, vereinigen alle Gewalten in einer Hand. Beide Regierungen sind in verschiedener Hinsicht drückend; doch findet der Mangel der Freiheit durch etwas mehr Wohlstand und Gesittung in den portugiesischen Kolonien einigen Ersatz.
Unter den Zuflüssen, welche der Río Negro von der Nordseite erhält, befinden sich drei, die unsere Aufmerksamkeit vorzugsweise verdienen, weil sie durch ihre Verzweigungen, ihre Portagen und die Lage ihrer Quellen auf das so vielfältig erörterte Problem des Orinocoursprungs wesentlichen Einfluß erhalten. Die südlichsten dieser Zuflüsse sind der Río Branco, von dem lange geglaubt wurde, er entspringe gemeinsam mit dem Orinoco aus dem Parima-See, und der Río Padaviri [port. Padauiri], welcher durch eine Portage mit dem Mavaca und demnach mit dem oberen Orinoco ostwärts der Mission von Esmeralda zusammenhängt. Wir werden Gelegenheit finden, vom Río Branco und vom Padaviri zu sprechen, wenn wir diese Mission erreicht haben; hier wollen wir nur beim dritten Zufluß des Río Negro, dem Cababuri [port. Cauaburi], verweilen, dessen Verzweigungen mit dem Casiquiare in hydrographischer und in kommerzieller Hinsicht (der Sarsaparille wegen) gleich wichtig sind.
Die hohen Gebirge vom Parima, die das nördliche Gestade des Orinoco an einem höheren Abschnitt oberhalb von Esmeralda begrenzen, senden eine Bergkette südwärts, worin der Cerro de Unturán einen Hauptgipfel bildet. Dieses an Umfang nur kleine Bergland, welches aber an vegetabilischen Produkten reich ist, worunter sich das zur Fabrikation des Curaregifts gebräuchliche Schlinggewächs Mavacure, Mandelbäume [amerikanische Nuß] (juvia oder Bertholletia excelsa), die aromatischen puchery und der wilde Cacao auszeichnen, bildet eine Wasserscheide zwischen den zum Orinoco, zum Casiquiare und zum Río Negro fließenden Gewässern. Die nördlichen oder die Zuflüsse des Orinoco sind der Mavaca und der Daracapo, die westlichen des Casiquiare sind der Idapa und der Pacimoni, die südlichen des Río Negro sind der Padaviri und der Cababuri. Dieser teilt sich unfern seiner Quelle in zwei Arme, von denen der westlichere unter dem Namen Baria bekannt ist. Die Indianer der Mission von San Francisco Solano haben uns sehr ausführliche Angaben über seinen Lauf geliefert. Er gewährt das höchst seltene Beispiel einer Gabelung, wodurch ein unterer Zufluß nicht die Wasser des oberen Zuflusses empfängt, sondern umgekehrt ihm einen Teil seiner Gewässer in einer der Richtung des Hauptsammlers entgegengesetzten Richtung sendet. Ich habe auf ein und derselben Tafel in meinem Atlas verschiedene Beispiele dieser Verzweigungen durch Gegenströmung dieses scheinbaren Wasserlaufs bergan, dieser Gabelteilung der Flüsse, deren Kenntnis den hydrographischen Ingenieuren [den Wasserbauern] wichtig ist, zusammengestellt. Diese Tafel stellt klar, daß nicht alles als chimärisch angesehen werden darf, was von der Regel abweichend erscheint, die wir aus Beobachtungen gebildet haben, welche auf einem allzu engen Kreis unseres Erdballs angestellt worden sind.
Der Cababuri mündet in den Río Negro nahe der Mission von Nossa Senhora das Caldas; die Flüsse Ya und Dimity aber, welches höhere Zuflüsse sind, haben auch Vereinigungen mit dem Cababuri, so daß vom Fortín São Gabriel de Cachoeiras bis São Antonio da Castanheira die Indianer der portugiesischen Besitzungen durch den Baria und den Pacimoni ins Territorium der spanischen Missionen gelangen können. Wenn ich das Wort Territorium gebrauche, geschieht es der Sitte der Observanten [Franziskaner] gemäß. Es ist schwer zu sagen, worauf sich das Eigentumsrecht in unbewohnten Ländern gründet, deren natürliche Grenzen unbekannt sind und wo auch keine Kulturversuche angestellt wurden. Die Bewohner der portugiesischen Missionen behaupten, ihr Gebiet dehne sich nach allen Punkten aus, wohin sie im Kanu auf einem Strom gelangen können, dessen Mündung in den portugiesischen Besitzungen liegt. Die Besitznahme ist jedoch eine Tatsache, welche nicht immer ein Eigentumsrecht begründet; und zufolge demjenigen, was früher über die mannigfachen Verzweigungen der Flüsse erläutert worden ist, dürfte die Bestätigung des seltsamen Axioms der Missionsrechtskunde den Höfen von Madrid und Lissabon gleich gefährlich sein.
Der Hauptzweck der Streifzüge auf dem Río Cababuri (port. Cauaburi) besteht in der Einsammlung der Sarsaparille und der aromatischen Beeren des Puchery-Lorbeers (Laurus pichurim). Man holt diese köstlichen Erzeugnisse bis zu zwei Tagereisen weit von Esmeralda am Ufer eines Sees, der nördlich vom Cerro Unturán liegt, indem man mit Portagen vom Pacimoni zum Idapa und vom Idapa zum Mavaca nahe beim gleichnamigen See gelangt. Die Sarsaparille dieser Gegenden ist in Gran Pará, in Angostura, in Cumaná, in Nueva Barcelona und in anderen Teilen der Tierra Firme unter dem Namen der Zarza del Río Negro berühmt. Es ist die wirksamste, welche man kennt, und sie wird der Zarza aus der Provinz Caracas und von den Mérida-Bergen weit vorgezogen. Sie wird mit viel Sorgfalt getrocknet und absichtlich geräuchert, um ihr eine schwärzere Farbe zu geben. Diese Schlingpflanze wächst häufig an den feuchten Abhängen der Berge von Unturán und Achivaquery. Herr Decandolle vermutet mit Recht, daß verschiedene Smilax-Arten unter dem Namen der Sarsaparille gesammelt werden. Wir haben zwölf neue Arten gefunden, worunter die Smilax siphilitica vom Casiquiare und die Smilax officinalis vom Magdalenenstrom ihrer harntreibenden Eigenschaften wegen die gesuchtesten sind. Weil unter den Weißen wie unter den gemischten Schichten die syphilitischen Krankheiten sehr allgemein und gutartig sind, wird eine überaus große Menge Sarsaparille in den spanischen Kolonien als Hausmittel gebraucht. Aus den Werken des Clusius wissen wir, daß am Anfang der conquista die Europäer diese wohltätige Arzeneisubstanz von der mexicanischen Küste bei Honduras und aus dem Hafen von Guayaquil bezogen haben. Heutzutage wird der Handel mit Zarza lebhafter in den Häfen betrieben, die innere Verbindungen mit dem Orinoco, dem Río Negro und dem Amazonenstrom haben.
Die in verschiedenen europäischen Botanischen Gärten angestellten Versuche beweisen, daß die virginische Smilax glauca, welche für Linnés Smilax sarsaparilla gehalten wird, überall im Freien gezogen werden kann, wo die mittlere Temperatur den Winter über 6 bis 7° des hundertteiligen Thermometers ansteigt; die Arten aber, deren Kräfte wirksamer sind, gehören ausschließlich der heißen Zone an und erfordern einen viel höheren Wärmegrad. Wer die Werke des Clusius gelesen hat, begreift nicht, wie man in unseren Arzneimittellehren darauf beharren kann, eine Pflanze der Vereinigten Amerikanischen Staaten als das Vorbild der offiziellen Smilax-Arten anzugeben.