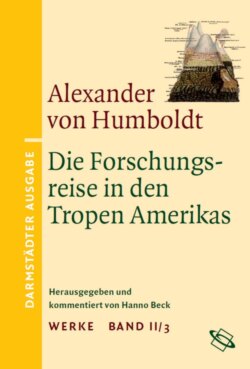Читать книгу Werke - Hanno Beck - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Achtes Buch Kapitel XXIII Río Negro – Die Grenzen Brasiliens – Casiquiare – Die Gabelteilung des Orinoco [Von der Konkurrenz Spaniens und Portugals im Zentrum Amazoniens]
ОглавлениеDer Río Negro kann im Vergleich mit dem Amazonenstrom, dem Río de la Plata und dem Orinoco nur ein Strom zweiten Ranges heißen. Sein Besitz ist seit Jahrhunderten der spanischen Regierung überaus wichtig gewesen, weil er einer rivalisierenden Macht, Portugal, einen leichten Weg in die Missionen Guayanas und zur Beunruhigung der südlichen Grenze der Capitanía general von Caracas bietet. Drei Jahrhunderte sind in vergeblichen Territorialstreitigkeiten verflossen. Nach Verschiedenheit der Zeiten und nach dem Grad der Zivilisation stützte man sich bald auf die Autorität des Papstes, bald auf die Hilfe der Astronomie. Weil man überhaupt den Kampf eher zu verlängern als zu beendigen strebte, hat dieser endlose Rechtsstreit einzig der Schiffahrtskunde und der Geographie des Neuen Kontinents Gewinn gebracht. Man erinnert sich, daß die Bullen der Päpste Nicolaus V. und Alexander VI., der Vertrag von Tordesillas und das Bedürfnis, die Demarkationslinie festzusetzen, ein mächtiger Sporn und Antrieb für die Arbeiten zur Lösung des Längenproblems, für die Berichtigung der Ephemeriden und für die Vervollkommnung der Instrumente geworden sind. Als die Verhältnisse von Paraguay und der Besitz der Kolonie del Sacramento den beiden Höfen von Madrid und Lissabon eine wichtige Angelegenheit waren, sandte man Grenzkommissare an den Amazonenstrom und an den Río de la Plata.
Neben müßigen Leuten, die Proteste und Protokolle für die Archive fertigten, fanden sich auch etliche sachkundige Ingenieure, etliche Seeoffiziere, denen das Verfahren zur Aufnahme von Ortsbestimmungen fern der Küsten bekannt war. Das wenige, was wir bis zum Schluß des letzten Jahrhunderts von der astronomischen Geographie des Landesinneren von Amerika gewußt haben, verdankt man diesen achtenswerten und tätigen Männern, den französischen und spanischen Akademikern, welche die Meridianmessung von Quito angestellt haben, und zwei Offizieren [Don José de Espinosa und Don Felipe Bauzá], die von Valparaíso nach Buenos Aires mit der Expedition Malaspinas gekommen sind. Gerne mag man der Vorteile gedenken, welche den Wissenschaften fast zufälligerweise von diesen Grenzkommissionen erwachsen sind, die dem Staat lästig fielen und die von denen, welche sie angeordnet hatten, öfter noch vergessen als wieder aufgelöst wurden.
Wer die Unzuverlässigkeit der amerikanischen Landkarten kennt und wer das nicht angebaute Land zwischen dem Japurá und dem Río Negro, dem Madeira und dem Ucayali, dem Río Branco und den Küsten von Cayenne in der Nähe gesehen hat, worüber in Europa bis auf unsere Zeit ernsthaft gestritten wurde, der kann sich über die Beharrlichkeit des Rechtens um den Besitz einiger Quadratlieues Land nicht genug wundern. Von dem angebauten Teil der Kolonie ist das strittige Land überhaupt durch Wüsten, deren Umfang man nicht kennt, getrennt. In den berühmten Konferenzen von Puente de Caya [vom 4. Nov. 1681 bis zum 22. Jan. 1682] wurde die Frage aufgeworfen, ob der Papst bei Bestimmung der Demarkationslinie bei 370 spanischen lieues westlich der Kap Verden verlangt habe, der erste Meridian solle vom Mittelpunkt der Insel St. Nicolaus [São Nicolão] oder (wie der Hof von Lissabon behauptete) vom westlichen Ende der kleinen Insel San Antonio [São Antão] gezählt werden. 1754, zur Zeit der Expedition von Ituriaga und Solano, unterhandelte man über den Besitz der damals öden Gestade des Tuamini und über ein Stück Sumpfland, das wir an einem Abend, um von Javita zum Caño Pimichín zu gelangen, durchwandert haben. Jüngst noch wollten die spanischen Kommissare die Scheidungslinie an die Einmündung des Apoporis in den Japurá setzen, wogegen die portugiesischen Astronomen sie bis zum Salto Grande zurückzuschieben verlangten. Die Missionare und das Publikum überhaupt zeigen viel Teilnahme an diesen Territorialfehden. In den spanischen wie in den portugiesischen Kolonien wird die Regierung der Sorglosigkeit und Lässigkeit beschuldigt. Überall, wo die Völker keine auf Freiheit gegründeten Institutionen haben, wird der Gemeingeist nur dann rege, wenn es sich um Ausdehnung oder Verengung der Landesgrenzen handelt.
Der Río Negro und der Japurá sind zwei Zuflüsse des Amazonenstroms, die an Länge der Donau gleichen und deren Oberläufe den Spaniern gehören, während die unteren Teile im Besitz der Portugiesen sind. An diesen zwei majestätischen Strömen hat die Bevölkerung sich dort vermehrt, wo sie dem Mittelpunkt der ältesten Zivilisation am nächsten ist. Die Ufer des oberen Japurá oder Caquetá sind durch Missionen angebaut worden, welche von den Cordilleren von Popayán und Neiva hinabgekommen waren. Von Mocoa bis zur Einmündung des Caguán finden sich die christlichen Niederlassungen sehr zahlreich, wogegen vom unteren Japurá die Portugiesen kaum Dörfer angelegt haben. Am Río Negro aber konnten die Spanier nicht als Konkurrenten ihrer Nachbarn auftreten. Wer möchte sich auf eine so entfernte Bevölkerung stützen wie die der Provinz von Caracas? Durch fast völlig öde Steppen und Wälder und auf 160 lieues Entfernung ist der angebaute Teil des Küstenlandes von den vier Missionen von Maroa, Tomo, Davipe und San Carlos, den einzigen, welche die spanischen Franziskanermönche längs des Río Negro anzulegen vermocht haben, getrennt. Bei den brasilianischen Portugiesen behielt das Militärregime, das System der Presidios [Zuchthäuser; hier = Ort, an dem Zwangsarbeiter wirken] und der Capitanes pobladores, das Übergewicht vor dem der Missionare. Gran Pará liegt allerdings in weiter Entfernung von der Mündung des Río Negro; aber die bequeme Fahrt auf dem Amazonenstrom, der sich wie ein unabsehbarer Kanal in gerader Richtung von Westen nach Osten ausdehnt, hat der portugiesischen Bevölkerung ermöglicht, sich schnell diesem Strom entlang auszubreiten. Die Ufer des unteren Marañón von Vistoza bis Serpa sowie die Ufer des Río Negro von Forte da Bara bis São José da Marabitanas sind durch reichen Anbau verschönert und mit vielen Städten und ansehnlichen Marktflecken besetzt.
Diese lokalen Betrachtungen stehen mit anderen, welche die moralischen Verhältnisse dieser Völkerschaften betreffen, in Verbindung. Die Nordwestküste von Amerika hat bis dahin außer den russischen und spanischen Kolonien noch keine anderweitigen festen Niederlassungen. Bevor die Einwohner der Vereinigten Staaten in ihrer fortschreitenden Bewegung von Ost nach West das Küstenland erreichten, welches lange Zeit zwischen dem 41. und 50. Breitengrad die kastilianischen Mönche von den sibirischen Jägern getrennt hatte, haben diese sich südwärts des Río Columbia angesiedelt. So waren in Neu-Californien die Franziskaner-Missionare, Männer von rühmlichen Sitten und landwirtschaftlicher Betriebsamkeit, nicht wenig erstaunt, zu vernehmen, daß griechische Priester in ihrer Nähe eingetroffen und daß zwei das östliche und das westliche Ende von Europa bewohnende Nationen auf einer China gegenüberliegenden Küste Amerikas Grenznachbarn geworden seien. Andere Verhältnisse haben sich in Guayana dargestellt: Die Spanier sind hier an ihren Grenzen wieder denselben Portugiesen begegnet, mit denen sie, durch Sprache und Munizipaleinrichtungen verwandt, einen der edelsten Überreste des römischen Europa bilden, die aber ein aus ungleicher Kraft und allzugroßer Nähe entstandenes Mißtrauen in eine öfters feindselige und allzeit nebenbuhlerische Macht verwandelt hat. Wer von den Küsten Venezuelas (wo wie in Havanna und den übrigen Antillen die Handelspolitk Europas ein Gegenstand des täglichen Gesprächs ist) südwärts reist, der fühlt sich mit jedem Tag mit wachsender Geschwindigkeit allem, was an das Mutterland erinnern kann, entrückt. Inmitten der Steppen oder Llanos, in diesen mit Ochsenfellen bedeckten und von wilden Herden umgebenen Hütten, ist nur die Rede von der Pflege des Viehs, von der den Weiden nachteiligen Trockenheit des Klimas, von dem Schaden, welchen die Fledermäuse unter den Kälbern und Füllen anrichten. Gelangt man auf dem Orinoco in die Missionen der Wälder, findet man hier die Aufmerksamkeit der Einwohner auf andere Gegenstände gerichtet, auf den unsteten Sinn der Indianer, welche aus den Dörfern ausreißen, auf die mehr oder minder reiche Ernte der Schildkröteneier, auf die Beschwerden des heißen und ungesunden Klimas. Wofern die Stiche der Moskitos den Mönchen an etwas anderes zu denken erlauben, kommen leise Klagen über den Vorsteher der Missionen zum Vorschein und Seufzer über die Verblendung derer, die im nächsten Kapitel den guardián des Klosters von Nueva Barcelona in seinem Amt bestätigen wollen. Alles hat hier ein lokales Interesse, und dieses bezieht sich ausschließlich, wie die Ordensmänner sagen, auf die Angelegenheiten der Gemeinde, „auf diese Wälder, estas selvas, welche Gott uns zur Wohnung angewiesen hat“. Dieser etwas lange und ziemlich traurige Ideenkreis erweitert sich, wenn man den oberen Orinoco mit dem Río Negro vertauscht und sich der Grenze Brasiliens nähert. Hier scheint der Dämon europäischer Politik alle Gemüter zu beherrschen. Das Nachbarland, welches sich über den Amazonenstrom ausdehnt, heißt in der Sprache der spanischen Missionen weder Brasilien noch Capitanía general von Gran Pará, sondern Portugal; die kupferfarbigen Indianer, die halbschwarzen Mulatten, die ich von Barcelos ins spanische Fortín San Carlos ziehen sah, heißen Portugiesen. Diese Namen sind volksüblich bis an die Küsten von Cumaná; und man versäumt nicht, den Reisenden behaglich zu erzählen, welche Wirkung sie zur Zeit der Grenzexpedition von Solano auf einen aus den Bergen von Bierzo abstammenden Befehlshaber von Vieja Guayana gehabt hatten. Der alte Krieger beschwerte sich, daß er die Reise an den Orinoco habe übers Meer machen müssen. „Wenn wirklich“, sagte er, „wie mir dies hier versichert wird, diese weitläufige Provinz des spanischen Guayana sich bis nach Portugal (zu den Portugueses) erstreckt, warum ließ mich der Hof in Cádiz einschiffen? Ich würde recht gern einige lieues weiter zu Land gereist sein.“ Dieser Ausdruck naiver Unwissenheit erinnert an eine seltsame Meinung des Kardinals Lorenzana. Dieser in der Geschichte übrigens nicht unbewanderte Prälat sagt in einem vor kurzem in Mexico gedruckten Werk, die Besitzungen des Königs von Spanien in Neu-Californien und in Neu-Mexico (ihr nördliches Ende liegt unter 37° 48′ der Breite) grenzten landwärts an Sibiren.
Wenn zwei Völker, deren Besitzungen in Europa aneinandergrenzen, die Spanier und die Portugiesen, in Amerika gleichfalls Nachbarn geworden sind, so ist dieses Verhältnis, um nicht zu sagen, dieser Nachteil, eine Wirkung des unternehmenden Geistes und der kühnen Tätigkeit, die das eine und das andere zur Zeit ihres kriegerischen Ruhms und ihrer politischen Größe entwickelt haben. Die kastilianische Sprache wird heutzutage in beiden Amerika in einer Ausdehnung von mehr als 1900 lieues angetroffen; wenn jedoch das südliche Amerika allein ins Auge gefaßt wird, findet sich die portugiesische Sprache hier auf ausgedehnterem Landesgebiet von einer kleineren Menschenzahl gesprochen als die kastilianische. Das Band, welches die schönen Mundarten von Luis de Camões und Lope de Vega innig verbindet, hat hier, möchte man sagen, nur gedient, die Völker, welche unfreiwillige Nachbarn geworden waren, noch mehr voneinander zu trennen. Der Nationalhaß gestaltet sich nicht allein nach Verschiedenheiten der Herkunft, der Sitten und der Fortschritte in der Kultur: Überall, wo er kräftig ausgebildet ist, muß er als eine Wirkung der geographischen Lage und der sich daraus ergebenden widersprüchlichen Interessen angesehen werden. Man verabscheut einander etwas weniger, wenn man weiter voneinander entfernt lebt und bei radikal verschiedenen Sprachen auch nicht einmal versucht ist, miteinander in Berührung zu treten. Die Reisenden durch Neu-Californien, durch die inneren Provinzen von Mexico und die nördlichen Grenzländer Brasiliens haben diese Schattierungen in den sittlichen Anlagen der Nachbarvölker auffällig gefunden.
Zur Zeit meines Aufenthalts am spanischen Río Negro fand sich infolge der divergierenden Politik der zwei Höfe von Lissabon und Madrid das Mißtrauen gesteigert, welches die kleinen Befehlshaber der benachbarten Forts auch in den ruhigsten Zeiten zu unterhalten bestrebt sind. Die Kanus fuhren von Barcelos bis zu den spanischen Missionen herauf; aber es waren nur seltene Verbindungen. Der Befehlshaber einer Truppe von 16 oder 18 Mann quälte „die Garnison“ mit Sicherheitsmaßnahmen, welche „die schwierigen Umstände“ erforderlich machten; er hoffte, im Fall eines Angriffes, „den Feind einzuschließen“. Wenn wir von der Gleichgültigkeit sprachen, womit die portugiesische Regierung in Europa wahrscheinlich die vier kleinen Dörfer betrachte, welche von den Franziskanermönchen am oberen Guainía errichtet wurden, fanden sich die Einwohner eben dadurch beleidigt, womit wir sie zu beruhigen gehofft hatten. Völkern, welche seit Jahrhunderten die Lebhaftigkeit ihres Nationalhasses beibehalten, kommt jede Gelegenheit, diesen zu nähren, erwünscht. Man findet Vergnügen in allem, was leidenschaftlich ist; im Bewußtsein kräftiger Gefühle, wie der Liebe so auch dem von veralteten Vorurteilen ausgehenden gehässigen Neid. Jede Individualität der Völker ist vom Mutterland in die entferntsten Kolonien herübergekommen, und die Nationalantipathie findet ihre Grenze auch da nicht, wo der Einfluß gleicher Sprachen aufhört. Wir wissen aus der anziehenden Erzählung in Krusensterns Reise, daß der Haß zweier flüchtiger Matrosen, eines Franzosen und eines Engländers, die Ursache eines langen Krieges zwischen den Bewohnern der Marquesas-Inseln geworden ist. Die Indianer der benachbarten portugiesischen und spanischen Dörfer am Amazonenstrom und am Río Negro hassen einander tödlich. Es sind amerikanische Sprachen, die diese armen Leute reden, und was am anderen Ufer des Ozeans, jenseits der großen salzigen Lache vorgeht, ist ihnen völlig unbekannt; aber die Kutten ihrer Missionare sind von anderer Farbe, und dies ärgert sie im höchsten Grad.