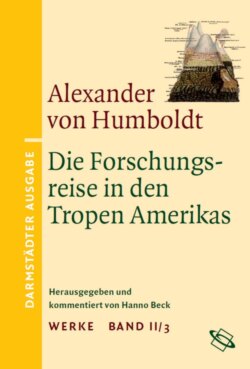Читать книгу Werke - Hanno Beck - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[Über Anthropophagie]
ОглавлениеEhe wir in der Mission von Mandavaca eintrafen, kamen wir bei ziemlich stürmischen rápides vorbei. Das Dorf, das auch den Namen Quirabuena führt, zählt nur 60 Eingeborene. Der Zustand dieser christlichen Ansiedlungen ist überhaupt so elend, daß auf der ganzen Länge des Casiquiare in einer Ausdehnung von 50 lieues keine 200 Einwohner angetroffen werden. Auch waren diese Flußgestade vor der Ankunft der Missionare bevölkerter. Die Indianer haben sich ostwärts in die Wälder zurückgezogen; denn die westlichen Ebenen sind fast völlig unbewohnt. Die Eingeborenen nähren sich einen Teil des Jahres hindurch von den großen Ameisen, die oben bereits beschrieben wurden. Diese Insekten sind hier ebenso beliebt, wie es auf der südlichen Halbkugel die zur Gattung Epeira gehörigen Spinnen sind, die den Wilden in Neu-Holland [Australien] als Leckerbissen gelten. In Mandavaca trafen wir den guten alten Missionar, der schon zwanzig Moskitojahre in den bosques del Casiquiare zugebracht hatte und dessen Schenkel von Insektenstichen dermaßen getigert waren, daß man Mühe hatte, seine weiße Haut zu erkennen. Er sprach uns von seiner Verlassenheit und von der traurigen Notwendigkeit, derzufolge er in beiden Missionen von Mandavaca und Vasiva nicht selten die grauenhaftesten Verbrechen unbestraft lassen müsse. An letzterem Ort hatte vor etlichen Jahren ein indianischer Alkalde eine seiner Frauen gefressen, nachdem er sie in seinen conuco gebracht und hier zur Mast gut genährt hatte. Die Menschenfresserei der Völkerschaften in Guayana ist niemals das Ergebnis des Mangels an Nahrung oder eines abergläubischen Kultes wie auf den Inseln der Südsee. Sie ist vielmehr allgemein eine Wirkung der Rachgier des Siegers oder (wie die Missionare sich ausdrücken) einer entarteten Eßlust. Der Sieg über eine feindliche Horde wird mit einer Mahlzeit gefeiert, worin einige Stücke vom Leichnam eines Gefangenen verzehrt werden. Ein andermal wird zur Nachtzeit eine wehrlose Haushaltung überfallen, oder ein Gegner, den man zufällig im Wald trifft, wird mit einem vergifteten Pfeil getötet. Die Leiche wird in Stücke zerhauen und als Trophäe in die heimatliche Hütte gebracht. Die Zivilisation ist es, welche dem Menschen die Einheit des Menschengeschlechts bewußtgemacht und ihm seine Verwandtschaft mit Geschöpfen, deren Sprache und Sitten ihm fremd sind, sozusagen offenbart hat. Die Wilden kennen einzig ihre Familie. Ein Stamm ist in ihren Augen nur ein zahlreicherer Verein von Verwandten. Wenn unbekannte Indianer aus den Wäldern in den von ihnen bewohnten Missionen eintreffen, bedienen sie sich eines Ausdrucks, der mir wegen seiner natürlichen Herzlichkeit mehrmals aufgefallen ist: „Es sind gewiß Verwandte von mir, denn ich verstehe, wenn sie mit mir reden.“ Eben diese Wilden verabscheuen alles, was nicht zu ihrer Familie oder zu ihrem Stamm gehört. Sie kennen die Pflichten gegen Familie und Verwandte, nicht aber die der Menschlichkeit, welche die Überzeugung eines gemeinsamen, alle uns gleichartigen Geschöpfe umfassenden Bandes voraussetzt. Kein Mitleidsgefühl hält sie ab, die Frauen und Kinder eines feindlichen Stammes zu morden. Die letzteren sind es dann auch vorzugsweise, die bei den Mahlzeiten verzehrt werden, womit der Ausgang eines Gefechtes oder eines entfernten Kriegszugs gefeiert wird.
Der Haß der Wilden gegen die meisten eine andere Sprache redenden Menschen, die ihnen als Barbaren eines niedrigeren Stammes erscheinen, erneuert sich oftmals in den Missionen, nachdem er lange geschlummert hat. Nachstehender Vorfall hatte sich wenige Monate vor unserer Ankunft in Esmeralda ereignet. Ein Indianer, aus dem Wald hinter dem Duida gebürtig, unternahm eine Reise mit einem anderen Indianer, welcher früher an den Gestaden des Ventuario von den Spaniern gefangengenommen worden war, seither aber im Dorf oder, wie man hier sagt, „unter der Glocke, debajo de la campana“, ruhig gelebt hatte. Der letztere konnte nur langsam gehen, weil er an dem Fieber litt, wovon die Eingeborenen befallen werden, wenn sie in die Mission kommen und ihre Lebensart plötzlich ändern. Über die Verzögerung ärgerlich, mordete ihn sein Reisegefährte und verbarg den Leichnam in dichtem Gebüsch unfern von Esmeralda. Dieses Verbrechen wäre wie so viele andere der Indianer untentdeckt geblieben, wenn der Mörder nicht den folgenden Tag ein Gastmahl zu geben unternommen hätte. Er wollte seine Kinder, die in der Mission erzogen und Christen geworden waren, bereden, sie sollten ihn begleiten, um einige Teile des Leichnams zu holen. Die Kinder hielten ihn nur mit viel Mühe davon ab, und infolge des häuslichen Streits, zu dem dies in der Familie führte, erfuhr der in Esmeralda postierte Soldat, was die Indianer ihm gerne verbergen wollten.
Bekanntlich wird die Anthropophagie und die damit öfters verbundene Sitte der Menschenopfer in allen Weltgegenden und unter Menschen von sehr ungleicher Abstammung angetroffen; was jedoch beim Studium der Geschichte noch auffallender erscheint, sind die Menschenopfer, die sich mitten in einer ziemlich vorgerückten Zivilisation erhalten haben, und der Umstand, daß Völker, welche weder zu den dümmsten noch zu den rohesten gehören, sich es zur Ehre rechnen, ihre Gefangenen zu verzehren. Diese Beobachtung weckt eine traurige und widrige Empfindung, welche den Missionaren nicht entgangen ist, die aufgeklärt genug sind, um über die sittlichen Verhältnisse der benachbarten Völker nachzudenken. Die Cabres, die Guipunavi und die Cariben sind immer mächtiger und zivilisierter gewesen als die übrigen Horden des Orinoco; und doch waren die beiden ersteren der Anthropophagie ergeben, welche den letzteren fremd blieb. Man muß sorgfältig die verschiedenen Zweige unterscheiden, in welche die große Familie der Cariben-Völker zerfällt. Es sind ihrer ebenso viele wie bei den Mongolen oder Westtartaren oder Turkmenen. Die Cariben des Festlandes, die in den Ebenen zwischen dem unteren Orinoco, dem Río Branco, dem Essequibo und den Quellen des Oyapoc wohnen, verabscheuen die Sitte, besiegte Feinde zu fressen. Zur Zeit der ersten Entdeckung von Amerika wurde diese barbarische Gewohnheit nur bei den Cariben der Antillen angetroffen. Diese sind es, durch welche die Worte Kannibalen, Cariben und Anthropophagen gleichbedeutend wurden; ihre Grausamkeiten waren es, welche das im Jahr 1504 erlassene Gesetz veranlaßten, wodurch die Spanier ermächtigt wurden, die Angehörigen aller amerikanischen Völkerstämme, deren Caribenherkunft erwiesen werden konnte, zu Sklaven zu machen. Ich glaube inzwischen, daß die Anthropophagie der Bewohner der Antillen in den Erzählungen der ersten Reisenden sehr übertrieben worden ist. Ein ernster und besonnenener Historiker, Herera, hat diese Erzählungen der Aufnahme in die ›Décadas históricas‹ gewürdigt und sogar einen außerordentlichen Vorfall glaubwürdig gefunden, welcher die Cariben veranlaßt haben soll, auf ihre barbarischen Sitten zu verzichten. „Die Eingeborenen einer kleinen Insel hatten einen von der Küste Puerto Ricos entführten Dominikaner-Mönch verspeist, worauf sie alle krank wurden und von da an weder Mönche noch Laien essen mochten.“ Wenn die Cariben vom Orinoco bereits zu Anfang des 16. Jahrhunderts in ihrer Lebensart von denen der Antillen verschieden waren und wenn sie stets zu Unrecht der Anthropophagie beschuldigt worden sind, dann wird es schwerfallen, diesen Unterschied aus einer Verbesserung ihres gesellschaftlichen Zustandes zu erklären. Es finden sich die seltsamsten Kontraste in diesem Gemisch von Völkerschaften, von denen die einen ausschließlich von Fischen, Affen und Ameisen leben, während andere mehr oder weniger Ackerbauern sind, sich mehr oder weniger mit Anfertigung und Bemalung von Töpferware, mit Weberei von Hängematten oder Baumwolltüchern beschäftigen. Mehrere dieser letzteren haben unmenschliche Gebräuche beibehalten, die den ersteren völlig unbekannt sind. Charakter und Sitten einer Nation sind wie ihre Sprache Ausdruck und Zeugnis ihres vergangenen sowohl als gegenwärtigen Zustands. Die gesamte Geschichte der Zivilisierung oder der Verwilderung einer Horde, die fortschreitende Entwicklung der verschiedenen Stationen ihres Lebens müßte man kennen, um die Probleme lösen zu können, welche die alleinige Kenntnis der gegenwärtigen Verhältnisse nicht erhellen kann.
„Sie können sich nicht vorstellen“, sagte der alte Missionar von Mandavaca, „welche Verderbtheit in dieser familia de Indios herrscht. Man nimmt Ankömmlinge eines neuen Stammes im Dorf auf; sie scheinen sanft, ehrlich und arbeitsam zu sein. Doch erlaubt man ihnen nur die Teilnahme an einem Streifzug (entrada), um Eingeborene einzubringen, werden Sie Mühe haben, sie vom Morden dessen, was ihnen in die Hände fällt, und vom Verstecken einiger Stücke der Leichen abzuhalten. Beim Nachdenken über die Sitten dieser Indianer erschrickt man gleichsam über den Anblick dieser Vereinigung von Gefühlen, die sich gegenseitig auszuschließen scheinen, über diese Neigung der Völker, sich nur teilweise zu humanisieren, dieses Übergewicht der Bräuche, Vorurteile und Traditionen über natürliche Herzensneigungen.“ In unserer Piroge befand sich ein flüchtiger Indianer vom Río Guaicia, der sich innerhalb weniger Wochen soweit ausgebildet hatte, daß er uns bei der Aufstellung der für unsere nächtlichen Beobachtungen erforderlichen Werkzeuge behilflich sein konnte. Er schien ebenso sanft wie verständig, und wir hatten vor, ihn in unseren Dienst zu nehmen. Mit großem Bedauern vernahmen wir von ihm in einem durch den Dolmetscher vermittelten Gespräch, das Fleisch der Marimondes-Affen, obwohl es schwärzlich aussehe, schiene ihm wie Menschenfleisch zu schmecken. Er versicherte, seine Verwandten (das heißt die Leute von seinem Stamm) bevorzugten beim Menschen wie Bären das Innere der Hände. Während dieser Erzählung drückten seine Gebärden eine wilde Lust aus. Wir ließen diesen jungen Mann, der übrigens ruhig und in den kleinen Diensten, die er uns leistete, sehr gefällig war, befragen, ob er zuweilen noch einige Neigung in sich verspüre, „von Cheruvichahena-Indianern zu essen". Er antwortete hierauf gelassen, in der Mission werde er nur speisen, was er die los Padres essen sehe. Die Vorwürfe, welche den Eingeborenen über die verabscheuenswürdige Sitte, von der hier die Rede ist, gemacht werden, verhallen, ohne irgendeinen Eindruck zu machen; es verhält sich damit gerade, wie wenn ein Brahmane vom Ganges, der in Europa reist, uns den Genuß des Tierfleischs vorwerfen würde. Der Indianer vom Guaicia hielt den Cheruvichahena für ein von ihm selbst völlig verschiedenes Wesen, und er glaubt, ihn töten zu dürfen wie den Jaguar des Waldes. Aus Rücksichten des Anstandes nur wollte er sich während seines Aufenthalts in der Mission ausschließlich an die Speisen halten, welche die Padres genossen. Wenn aber die Eingeborenen entweder zu den Ihren (al monte) zurückkehren oder vom Hunger geplagt werden, nehmen sie bald ihre Anthropophagen-Gewohnheiten wieder an. Wie sollten wir uns über diesen Unbestand bei den Völkern des Orinoco wundern, wenn furchtbare und nur allzu wahre Beispiele uns an Ereignisse erinnern, die in großen Hungersnöten unter zivilisierten Völkern stattgefunden haben? Im 13. Jahrhundert hatte sich in Ägypten die Gewohnheit, Menschenfleisch zu essen, unter allen Klassen der Einwohner verbreitet, besonders den Ärzten wurden arge Fallstricke gelegt. Hungernde gaben sich für krank aus und ließen den Arzt rufen, nicht um seines Rates willen, sondern um ihn zu verspeisen. Ein völlig glaubwürdiger Historiker, Abd Allatif, meldet uns, „wie eine Sitte, die anfangs Abscheu und Schrecken verursachte, in kurzer Zeit keinerlei Befremden mehr erregte".
*
Obgleich die Indianer des Casiquiare sehr leicht ihre barbarischen Gewohnheiten wieder annehmen, zeigen sie doch in den Missionen Verstand, einige Arbeitsliebe und besonders viel Leichtigkeit beim Lernen der kastilianischen Sprache. Weil die meisten Dörfer von drei bis vier Nationen bewohnt sind, die einander nicht verstehen, bietet eine fremde Sprache, welche gleichzeitig die der bürgerlichen Obrigkeit und die Sprache der Missionare ist, den Vorteil eines allgemeinen Verständigungsmittels. Ich habe einen Poignave- sich mit einem Guahibo-Indianer in kastilianischer Sprache unterhalten gesehen, obgleich beide erst seit drei Monaten ihre Wälder verlassen hatten. Von Viertelstunde zu Viertelstunde brachten sie einen mühsamen Satz zusammen, worin das Zeitwort, ohne Zweifel der grammatischen Wendung ihrer eigenen Sprachen gemäß, ständig als Gerundium erschien: Als ich sehend Padre, Padre mir sagend (statt: Als ich den Missionar sah, sagte er zu mir). Ich habe an einer anderen Stelle geäußert, wie verständig mir die Idee der Jesuiten erschien, eine der Sprachen des kultivierten Amerika, zum Beispiel die der Peruaner [die Ketschua-Sprache, lengua del Inca], zur allgemeinen Sprache zu erklären und die Indianer in einer Mundart zu unterrichten, welche ihnen in den Wurzeln, nicht aber in ihrer Struktur und grammatischen Formen fremd ist. Sie handelten hierin nach den Grundsätzen, welche die Inca oder Priesterkönige von Peru seit Jahrhunderten befolgt hatten, um ihre Herrschaft zu erhalten und die barbarischen Völkerschaften des oberen Marañón zu humanisieren; dieses Verfahren ist unstreitig nicht so seltsam wie das, nach dem die Eingeborenen Amerikas Latein reden sollten, wie es in einem mexicanischen Provinzial-Consilium mit vollem Ernst vorgeschlagen wurde.
Wir hörten, daß die Indianer vom Casiquiare und vom Río Negro am unteren Orinoco, hauptsächlich in Angostura, ihrer Intelligenz und Tätigkeit halber den Bewohnern der übrigen Missionen vorgezogen werden. Die von Mandavaca sind unter den Völkerschaften ihrer Rasse wegen der Verfertigung des Curaregifts berühmt, das dem Curare vom Esmeralda an Stärke nicht nachsteht. Leider beschäftigt diese Arbeit die Eingebornen viel mehr als der Ackerbau. Der Boden an den Ufern des Casiquiare ist jedoch ausgezeichnet. Es findet sich da ein braun-schwärzlicher Granitsand, welcher in den Wäldern mit Schichten von dichtem Humus bedeckt ist; die Ufer des Flusses sind mit fast wasserdichtem Ton bekleidet. Der Boden des Casiquiare scheint fruchtbarer zu sein als der des Río-Negro-Tals, wo der Mais nur schlecht gedeiht. Reis, Bohnen, Baumwolle, Zucker und Indigo geben reiche Ernten überall, wo ihr Anbau versucht wurde. Wir haben wild wachsenden Indigo in der Nähe der Missionen von San Miguel de Davipe, von San Carlos und von Mandavaca gesehen. Es ist zweifellos so, daß verschiedene amerikanische Völkerschaften, besonders die Mexicaner, sich lange vor der Eroberung des Landes für ihre Hieroglyphen Bilder eines echten Indigos bedient haben und daß dieser Farbstoff in kleinen Broten auf dem großen Markt von Tenochtitlán verkauft wurde. Es kann jedoch ein chemisch identischer Farbstoff aus Pflanzen verwandter Gattungen gezogen werden, und ich könnte gegenwärtig nicht entscheiden, ob die einheimischen Indigofera von Amerika nicht einige Gattungsunterschiede von der Indigofera anil und der Indigofera argentea des Alten Kontinents aufweisen. Im Kaffeebaum beider Welten ist dieser Unterschied wahrgenommen worden.
Die feuchte Atmosphäre und die Masse Insekten, welche ihre natürliche Folge ist, bilden hier wie am Río Negro fast unüberwindliche Hindernisse neuer Landkulturen. Selbst beim hellen und blauen Himmel haben wir de Lucs Hygrometer nie unter 52° gefunden. Überall trifft man jene großen Ameisen an, die in gedrängten Reihen ihre Züge unternehmen und über die angebauten Pflanzen um so gieriger herfallen, als sie krautartig und saftig sind, während die Wälder dieser Gegenden nur holzige Gewächse kennen. Wenn ein Missionar versuchen will, Salat oder ein anderes europäisches Gemüse zu ziehen, ist er genötigt, seinen Garten gleichsam in die Luft zu hängen. Er füllt nämlich ein altes Kanu mit guter Erde, und wenn er diese besät hat, hängt er es etwa vier Fuß über der Erde an Stricke der Chiquichiqui-Palme auf; meist stellt er es auf ein leichtes Gerüst. Durch diese Einrichtung werden die jungen Pflanzen vor Unkraut, Erdwürmern und jenen Ameisen geschützt, die ihre Wanderungen in gerader Linie fortsetzen und, unbekannt mit dem, was über ihnen wächst, nicht leicht die Richtung ihres Weges ändern, um die Pfähle, deren Rinde abgeschält ist, zu erklimmen. Ich erwähne diese Tatsache, um zu erklären, wie schwierig zwischen den Wendekreisen, an den Ufern großer Flüsse, die ersten Versuche des Menschen sind, sich auf diesem großen von Tieren okkupierten und mit wilden Pflanzen überwachsenen Naturgebiet einen Erdenfleck anzueignen.
Den 13. Mai [1800]. In der Nacht hatte ich einige Sternbeobachtungen erhalten, leider die letzten am Casiquiare. Die Breite von Mandavaca ist 2° 4′ 7″; seine Länge, nach dem Chronometer, 69° 27′. Die magnetische Inklination fand ich bei 25,25° der Centesimaleinteilung. Sie hatte demnach seit dem Fortín von San Carlos bedeutend zugenommen. Die Gesteine der Nachbarschaft bestehen jedoch aus demselben Granit, mit etwas Hornblende gemischt, den wir in Javita gefunden hatten und der ein syenitisches Aussehen hat. Wir verließen Mandavaca um 2½ Uhr in der Nacht. Noch mußten wir acht Tage lang gegen die Strömungen des Casiquiare ankämpfen, und das Land, über das wir wieder nach San Fernando de Atabapo gelangen wollten, war dermaßen menschenleer, daß wir nach einer Reise von dreizehn Tagen erst einen anderen Franziskanermissionar, den von Santa Bárbara, erreichen zu können hoffen durften. Nach sechsstündiger Flußfahrt kamen wir östlich bei der Einmündung des Idapa oder Siapa vorbei, welcher auf dem Berg Unturán entspringt und in der Nähe seiner Quellen eine Portage zum Río Mavaca, einem der Zuflüsse des Orinoco, erlaubt. Dieser Fluß hat Weißes Wasser und ist halb so breit wie der Pacimoni, dessen Wasser schwarz ist. Sein oberer Lauf findet sich sehr entstellt auf den Karten von La Cruz und von Surville, die allen späteren Karten als Vorbild dienten. Ich werde von den Voraussetzungenn, die diese Irrtümer veranlaßt haben, zu sprechen Gelegenheit finden, wenn ich vom Ursprung des Orinoco berichte. Hätte der Pater Caulin die Karte sehen können, welche seinem Werk beigefügt worden ist, er wäre nicht wenig erstaunt gewesen, darin Irrtümer wiederholt zu finden, die er durch zuverlässige, an Ort und Stelle erhobene Angaben widerlegt hatte. Dieser Missionar sagt lediglich, der Idapa entspringe in einem Bergland, in dessen Nähe die Amuisanas-Indianer leben. Diese Indianer wurden zu Amoizanas oder in Amazonen travestiert, und der Ursprung des Río Idapa wurde von einer Quelle hergeleitet, die sich, wo sie aus der Erde kommt, alsbald in zwei Äste teilt, welche in völlig entgegengesetzter Richtung laufen. Diese Gabelteilung einer Quelle ist völlig erdichtet.
Wir biwakierten nahe beim Raudal von Cunuri. Die Nacht über verstärkte sich das Getöse dieses kleinen Katarakts merklich. Unsere Indianer versicherten, dies sei ein gewisser Vorbote des Regens. Ich erinnere mich, daß auch die Bewohner der Alpen ein großes Vertrauen in dieses Wetterzeichen setzen. Wirklich regnete es geraume Zeit vor Aufgang der Sonne. Übrigens hatten uns die Araguatos-Affen durch ihr andauerndes Geheul noch früher als das verstärkte Getöse des Wasserfalls den nahen Regenguß angekündigt.
Den 14. Mai [1800]. Die Moskitos und mehr noch die Ameisen vertrieben uns vom Ufer vor zwei Uhr nachts. Bis dahin hatten wir geglaubt, diese kröchen nicht über die Stricke, an welche man die Hängematten zu befestigen gewöhnt ist. Allein, sei es, daß dies ein Irrtum war oder daß diese Tierchen von den Gipfeln der Bäume auf uns herabfielen, gewiß ist, daß wir Mühe hatten, uns von den lästigen Insekten zu befreien. Der Strom wurde nun zusehends schmaler; seine Gestade waren dermaßen sumpfig, daß sich Herr Bonpland nur mit großer Mühe dem Stamm einer Cyrolinea princeps, die voll großer purpurner Blüten hing, nähern konnte. Dieser Baum ist die schönste Zierde sowohl dieser Wälder wie der vom Río Negro. Den Tag über untersuchten wir verschiedentlich die Temperatur des Casiquiare. Auf der Oberfläche des Stroms zeigte das Wasser nur 24° (wenn die Luft 25,6° zeigte), was ungefähr die Temperatur des Río Negro ist, hingegen 4 bis 5° weniger als die des Orinoco. Nachdem wir westlich bei der Mündung des Caño Caterico vorbeigekommen waren, dessen Wasser schwarz und ungemein durchsichtig sind, verließen wir das Flußbett, um an der Insel zu landen, auf der die Mission von Vasiva errichtet ist. Der See, welcher diese Mission umgibt, ist eine lieue breit und hängt durch drei Abflüsse mit dem Casiquiare zusammen. Die sehr sumpfige Umgegend ist ein arges Fieberland. Der See, dessen Wasser durch Übertragung gelb sind, trocknet in der Trockenzeit aus, und dann widerstehen auch die Indianer seinen sich aus dem Schlamm entwickelnden Miasmen nicht. Die völlige Windstille trägt viel dazu bei, das Klima dieser Gegenden noch verderblicher zu machen. Ich habe die Zeichnung der Ebene von Vasiva stechen lassen, wie ich sie am Tag unserer Ankunft aufnahm. Ein Teil des Dorfs ist an eine trockene Stelle nordwärts versetzt worden, und diese Änderung veranlaßte einen langen Streit zwischen dem Statthalter von Guayana und den Mönchen. Der Statthalter behauptete, diese seien nicht berechtigt, ohne Bewilligung der Zivilbehörde ihre Dörfer zu versetzen; jedoch mit der Lage des Casiquiare völlig unbekannt, hatte er seine Beschwerde an den Missionar von Carichana gerichtet, welcher 150 lieues von Vasiva entfernt wohnt und gar nicht verstehen konnte, worum es ging. Solche geographischen Mißgriffe sind sehr verbreitet in Ländern, die meist von Statthaltern verwaltet werden, die nie eine Karte besaßen. Im Jahre 1785 wurde dem Pater Valor die Mission von Padamo übertragen mit der Weisung, sich ungesäumt zu den Indianern zu verfügen, die keinen Pfarrer hätten. Seit länger als fünfzehn Jahren war das Dorf Padamo verschwunden und die Indianer al monte [in den Wald] gegangen.
Vom 14. bis zum 21. Mai hatten wir stets unter freiem Himmel übernachtet; ich kann aber die Stationen unseres Biwaks nicht angeben. Diese Gegenden sind so wild und so wenig besucht, daß mit Ausnahme einiger Flüsse die Indianer die Stellen, welche ich mit der Bussole aufgenommen habe, nicht benennen konnten. Keine Sternbeobachtung konnte mir die Breitenbestimmung in der Distanz von einem Grad gewährleisten. Nachdem wir bei dem Punkt vorbeigekommen waren, wo der Itinivini sich vom Casiquiare trennt, um seinen Lauf westwärts nach den Granithügeln von Daripabo zu nehmen, fanden wir die Sumpfgestade des Flusses mit Bambusrohren bewachsen. Diese baumartigen Gräser wachsen rund 20 Fuß hoch; ihr Schilf ist oben stets bogenförmig gekrümmt. Es ist eine neue Art des Bambus mit sehr breiten Blättern. Herr Bonpland hatte das Glück, ein Individuum blühend anzutreffen. Ich bemerke diesen Umstand, weil die Gattungen Nastus und Bambusa bis dahin sehr mangelhaft unterschieden waren und weil diese Riesengewächse äußerst selten in der Neuen Welt blühend vorgefunden werden. Herr Mutis hat zwanzig Jahre in einer Landschaft herborisiert, wo die Bambusa guadua mehrere lieues breite Sumpfwälder bildet, ohne je ihre Blüten zu sehen. Wir haben diesem Gelehrten die ersten Ähren der Bambusa der gemäßigten Täler von Popayán zugesandt. Was mag die Urache sein, warum sich die Befruchtungsorgane nur so selten entwickeln bei einer einheimischen Pflanze, die ausnehmend kräftig von der Wasserfläche des Ozeans bis zur Höhe von 900 Toisen gedeiht, also bis in eine subalpine Region, deren Klima zwischen den Wendekreisen dem des südlichen Spaniens gleicht? Die Bambusa latifolia scheint den Becken des oberen Orinoco, des Casiquiare und des Amazonenstroms spezifisch anzugehören; sie ist eine geselliglebende Pflanze wie alle zur Nastoiden-Familie gehörigen Gräser; aber in dem von uns bereisten Teil des spanischen Guayana bildet sie die ausgedehnten Gesellschaften nicht, welche die amerikanischen Spanier guaduales oder Bambuswälder nennen.
Unser erstes Biwak oberhalb Vasiva war bald aufgeschlagen. Wir fanden einen kleinen, trockenen und von Gesträuch freien Flecken Erde südwärts vom Caño Curamuni an einer Stelle, wo Kapuzineraffen, durch den schwarzen Bart und ihr trauriges und scheues Aussehen kenntlich, langsam auf den waagerechten Ästen einer Genipa daherschritten. Die fünf folgenden Nächte waren um so beschwerlicher, als wir uns der Gabelteilung des Orinoco näherten. Die Üppigkeit des Pflanzenwuchses vermehrt sich in einer Weise, von der man sich kaum eine Vorstellung machen kann, selbst wenn man bereits auch mit dem Anblick der Wälder zwischen den Wendekreisen bekannt ist. Man hat einen 200 Toisen breiten Kanal vor Augen, welcher mit zwei gewaltigen, durch Schlinggewächse und Laubwerk bekleideten Mauern eingefaßt ist. Wir versuchten öfters zu landen, ohne einen Fuß außerhalb des Fahrzeuges setzen zu können. Bisweilen suchten wir gegen Sonnenuntergang eine Stunde lang am Ufer nicht eine Lichtung im Wald (denn deren gibt es gar keine), sondern eine weniger dichte Stelle zu finden, wo wir mit Mühe und mittels Axthieben unserer Indianer einen Landeplatz für 12 bis 13 Personen bereiten könnten. In der Piroge zu übernachten war unmöglich. Die Moskitos, welche uns den Tag über quälten, häuften sich nachts unter dem toldo, das heißt unter dem Dach aus Palmblättern, das uns vor dem Regen schützen sollte. Nie hatten wir so angeschwollene Hände und Gesichter gehabt. Pater Zea, welcher sich bisher rühmen konnte, in seinen Missionen an den Katarakten die größten und die tapfersten (las mas feroces) Moskitos zu besitzen, legte nun allmählich das Geständnis ab, die Insektenstiche am Casiquiare seien schmerzhafter als alle, die er je zuvor verspürt habe. Mitten im dichten Wald war es eine schwierige Aufgabe, Holz für die Feuer zu erhalten; denn in diesen Äquatorialgegenden, wo beständiger Regen fällt, sind die Baumäste dermaßen saftreich, daß sie fast gar nicht brennen. Wo es keine dürren Ufer gibt, kann man sich das alte Holz, von dem die Indianer sagen, es sei „an der Sonne gebraten“, fast gar nicht verschaffen. Inzwischen bedurften wir des Feuers nur noch als Schutzmittel gegen wilde Tiere; an Lebensmitteln war so großer Mangel bei uns eingetreten, daß wir für ihre Zubereitung seiner fast ganz entbehren konnten.
Am 18. Mai [1800], gegen Abend, entdeckten wir eine Uferstelle, die mit wilden Cacaobäumen besetzt war. Ihre Bohne ist klein und bitter; die Indianer des Waldes saugen die Fleischhülle aus und werfen die Bohne weg, welche von den Indianern der Missionen aufgehoben wird. Man verkauft sie an solche, die nicht allzu feinfühlig bei der Bereitung ihrer Schokolade sind. „Hier ist der Puerto del Cacao“, sagte unser Pilot, „hier übernachten los Padres, wenn sie nach Esmeralda reisen, um Sarbacanen [Blasrohre] und juvias (die schmackhaften Mandeln [Nüsse] der Bertholletia) einzukaufen.″ Inzwischen gehen das Jahr über keine fünf Fahrzeuge durch den Casiquiare; und von Maipures aus, also seit einem Monat, hatten wir auf den Flüssen, welche wir hinaufgefahren sind, außer in der unmittelbaren Nähe der Missionen, keine lebende Seele angetroffen. Südwärts vom Duractumuni-See brachten wir die Nacht in einem Palmenwald zu. Der Regen fiel in Strömen; aber Pothos, Arum und Schlingpflanzen bildeten ein so dichtes Geflecht, daß sie uns wie unter einer gewölbten Laubdecke schützten. Die zunächst ans Ufer verlegten Indianer hatten aus ineinandergeflochtenen Heliconien und anderen Musaceen eine Art Dach über ihren Hängematten errichtet. Unsere Feuer beleuchteten auf 50 bis 60 Fuß Höhe die Palmenstämme, die mit Blüten beladenen Schlinggewächse und die weißlichen, senkrecht aufsteigenden Rauchsäulen. Es war ein prachtvoller Anblick, dessen ruhiger Genuß jedoch eine von Insekten befreite Atmosphäre erfordert hätte.
Unter allen körperlichen Leiden sind die erschöpfendsten die, welche einförmig andauern und nur durch lange Geduld bekämpft werden können. Wahrscheinlich hat Herr Bonpland sich in den Ausdünstungen der Wälder des Casiquiare den Keim der furchtbaren Krankheit geholt, die ihn bald nach unserer Ankunft in Angostura dem Tod nahebrachte. Zu seinem und meinem Glück hatten wir keinerlei Ahnung der ihm drohenden Gefahr. Wir fanden die Ansicht des Stroms und das Gesumme der Moskitos etwas eintönig; aber ein Rest natürlicher Fröhlichkeit half uns die Langeweile ertragen. Wir entdeckten, wenn wir kleine Portionen von zerriebenem Cacao ohne Zucker aßen und viel Flußwasser dazu tranken, daß die Eßlust für mehrere Stunden gestillt wurde. Die Ameisen und die Moskitos beschäftigten uns mehr als die Feuchtigkeit und der Mangel an Lebensmitteln. Trotz der Entbehrungen, welche wir während unserer Wanderungen durch die Cordilleren erlitten haben, ist uns doch immer die Fahrt von Mandavaca nach Esmeralda als die beschwerlichste Zeit unseres Aufenthalts in Amerika vorgekommen. Ich rate den Reisenden, nicht die Fahrt auf dem Casiquiare der auf dem Atabapo vorzuziehen, wenn sie kein besonderes Verlangen fühlen, die große Gabelteilung des Orinoco zu betrachten.
Oberhalb des Caño Duractumuni verfolgt der Casiquiare eine gleichtönige Richtung von Nordosten nach Südwesten. Hier ist es, wo man am rechten Ufer das neue Dorf Vasiva zu gründen begonnen hat. Die Missionen von Pacimona, von Capivari und von Buenaguardia sowie das angebliche fortín beim See von Vasiva sind bloß Erdichtungen unserer Karten. Überraschend war uns zu sehen, wie durch die plötzlich eintretenden Wasserhöhen die beiderseitigen Ufer unterhöhlt wurden. Entwurzelte Bäume bildeten gleichsam natürliche Flöße; halb in den Schlamm versenkt, sind sie den Pirogen sehr gefährlich. Wer das Unglück hätte, in diesen unbewohnten Gegenden Schiffbruch zu erleiden, der würde wahrscheinlich verschwinden, ohne daß eine Spur von der Zeit und Art eines Untergangs übrigbliebe. Man würde einzig und sehr spät an den Seeküsten hören, es sei ein von Vasiva abgegangenes Boot hundert lieues weiter in den Missionen von Santa Bárbara und von San Fernando de Atabapo nicht wieder gesehen worden. Die Nacht vom 20. Mai, die letzte unserer Fahrt auf dem Casiquiare, brachten wir unfern von der Stelle der Gabelteilung des Orinoco zu. Wir hatten einige Hoffnung, eine astronomische Beobachtung machen zu können, indem Sternschnuppen von seltener Größe durch den Nebel, der den Himmel bedeckte, sichtbar wurden. Wir schlossen hieraus, diese Nebelschicht könne nur sehr dünn sein, weil solche Meteore fast niemals unterhalb einer Wolke gesehen worden sind. Die, welche uns zu Gesicht kamen, nahmen ihre Richtung nordwärts und folgten einander in fast gleichen Zeiträumen. Die Indianer, welche die Bilder ihrer ausschweifenden Phantasie durch die Sprache nicht leicht veredeln, nennen die Sternschnuppen den Urin und den Tau den Speichel der Sterne. Die Wolken verdichteten sich neuerlich, so daß wir nun weder Meteore noch die seit mehreren Tagen so ungeduldig erwarteten wahren Gestirne zu sehen bekamen.
Man hatte uns angekündigt, wir würden die Insekten in Esmeralda „noch grausamer und gefräßiger“ finden als auf dem Arm des Orinoco, welchen wir hinauffahren würden. Trotzdem überließen wir uns freudig der Hoffnung, endlich wieder an einem bewohnten Ort schlafen und uns durch Herborisieren einige Bewegung machen zu können. Diese vergnügte Aussicht wurde im letzten Biwak am Casiquiare durchkreuzt. Ich wage, hier eine Tatsache zu berichten, die nicht von großem Interesse für den Leser ist, jedoch in einem Tagebuch, das die Ereignisse der Fahrt durch ein so wildes Land darstellt, nicht am falschen Platz stehen dürfte. Wir schliefen am Rand eines Waldes. Mitten in der Nacht meldeten die Indianer, daß man das Gebrüll des Jaguars sehr nahe höre und daß es oben aus den Bäumen käme. Die Wälder dieser Landschaften sind so dicht, daß kaum andere Tiere darin vorkommen als die, welche auf Bäume klettern wie die Affen, die Vierhänder, die Schleichkatzen und verschiedene andere Katzenarten. Weil unsere Feuer gut brannten und man sich infolge längerer Gewöhnung endlich (ich möchte sagen, systematisch) auch über nicht bloß eingebildete Gefahren beruhigt, blieben wir ziemlich gleichgültig gegenüber diesem Jaguargebrüll. Der Geruch und die Stimme unseres Hundes hatten die Tiere angelockt. Dieser Hund (er gehört zur großen Doggenrasse) bellte anfänglich; als der Tiger näherkam, fing er an zu heulen und barg sich unter unsere Hängematten, als suche er Schutz beim Menschen. Seit unseren Biwaks am Río Apure waren wir an diesen Wechsel von Mut und Schüchternheit eines noch jungen, sanften und sehr anschmiegsamen Tiers gewöhnt. Wie groß war unser Kummer, als uns am Morgen im Augenblick des Einschiffens die Indianer meldeten, der Hund sei verschwunden! Es blieb kein Zweifel, daß die Jaguare ihn geraubt hatten. Vielleicht hatte er sich, als ihr Gebrüll aufhörte, vom Feuer gegen das Ufer hin entfernt, oder wir hatten, in tiefen Schlaf versunken, das Klagegeschrei des Hundes nicht mehr gehört. Die Anwohner des Orinoco und des Río Magdalena hatten uns öfters versichert, die ältesten Jaguare (also die, welche viele Jahre lang zur Nachtzeit gejagt haben) seien listig genug, um Tiere aus der Mitte eines Biwaks zu entführen, indem sie durch Würgen ihr Schreien ersticken. Wir warteten einen Teil des Vormittags, in der Hoffnung, der Hund könnte sich verlaufen haben. Drei Tage später kamen wir an dieselbe Stelle zurück. Das Gebrüll des Jaguars ließ sich nochmals hören, denn diese Tiere zeigen eine Vorliebe für gewisse Orte; aber all unser Suchen war umsonst. Die Dogge, die uns von Caracas aus begleitet hatte und so oft der Verfolgung der Krokodile durch Schwimmen entgangen war, ist im Wald zerrissen worden. Ich erwähne diesen Vorfall hier nur, weil er einiges Licht auf die listigen Überfälle dieser großen Katzen mit geflecktem Fell werfen kann.
Den 21. Mai [1800] gelangten wir erneut ins Strombett des Orinoco, drei lieues unterhalb der Mission von Esmeralda. Einen Monat zuvor hatten wir diesen Fluß bei der Einmündung des Guaviare verlassen. Noch stand uns eine Fahrt von 750 Meilen bis Angostura bevor, aber es ging flußabwärts und also viel leichter. Beim Hinabfahren der Ströme folgt man dem Talweg, der Mitte des Stroms, wo sich nur wenige Moskitos finden; beim Hinauffahren dagegen ist man genötigt, um die Wirbel und Gegenströmungen benutzen zu können, sich nahe am Ufer zu halten, wo die Nähe des Waldes und der ans Gestade ausgeworfene Detritus organischer Substanzen die schnakenartigen Insekten vervielfältigt. Die Stelle der berühmten Gabelteilung des Orinoco gewährt einen wahrhaft imponierenden Anblick. Hohe Granitberge erheben sich am westlichen Ufer. Von weitem her erkennt man darunter den Maraguaca und den Duida. Am linken Ufer des Orinoco, westlich und östlich der Gabelteilung bis zu der Einmündung des Tamatama gegenüber, gibt es keine Berge. Hier steht der Guaraco-Fels, welcher zur Regenzeit zuweilen, wie man behauptet, Flammen speit. Wenn der Orinoco südwärts nicht mehr von Bergen umgeben ist und bei der Öffnung eines Tals oder vielmehr bei einer an den Río Negro reichenden Senke ankommt, teilt er sich in zwei Äste. Der Hauptarm (der Río Paragua der Indianer) setzt seinen Lauf westnordwestlich fort, die Gruppe der Berge von Parima umziehend; der Arm, der die Verbindung mit dem Amazonenstrom bildet, strömt in die Ebenen, die überhaupt südliches Gefälle haben, deren partielle Flächen sich jedoch südwestlich zum Casiquiare und südöstlich zum Becken des Río Negro neigen. Ein dem Anschein nach so bizarres Phänomen, das ich an Ort und Stelle bestätigt fand, verdient ganz besondere Aufmerksamkeit. Es ist ihrer um so würdiger, als es einiges Licht auf ähnliche Verhältnisse, die man im afrikanischen Binnenland beobachtet zu haben glaubt, werfen kann.