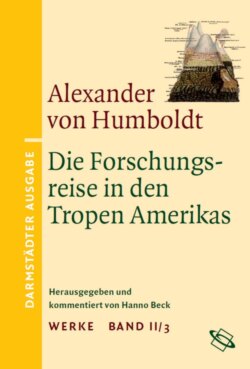Читать книгу Werke - Hanno Beck - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[Wichtige erdmagnetische Entdeckungen]
ОглавлениеIch habe die Inklination der Magnetnadel in San Carlos bei 22,60° der Centesimaleinteilung beobachtet. Die magnetische Kraft wurde durch 216 Schwingungen in 10′ Zeit ausgedrückt. Weil die magnetischen Parallelen sich westlich erhöhen und ich auf dem Rücken der Cordilleren, zwischen Santa Fé de Bogotá und Popayán, die gleichen Inklinationen angetroffen habe, welche am oberen Orinoco und am Río Negro wahrgenommen wurden, sind diese Beobachtungen für die Theorie der Linien gleicher Intensität oder die Isodynamen sehr wichtig geworden. Die Zahl der Schwingungen ist die gleiche in Javita und in Quito, und doch ist die magnetische Inklination im ersteren dieser zwei Orte 26,40°; im zweiten 14,85°. Wenn die Kraft unter dem magnetischen Äquator (in Peru) einheitlich ausgedrückt wird, ist die Intensität der Kraft in Cumaná = 1,779, in Carichana = 1,1575, in Javita = 1,0675, in San Carlos = 1,0480. So ist das abnehmende Verhältnis der Kraft von Norden nach Süden, auf 8° der Breite zwischen 60½ und 69° der Länge westlich von Paris beschaffen. Ich spreche absichtlich den Unterschied der Meridiane aus; denn es hat bei neuer Würdigung und Prüfung meiner isodynamischen Beobachtungen ein im Studium des Erdmagnetismus sehr erfahrener Geometer, Herr Hansteen, entdeckt, daß die Intensität der Kräfte auf demselben magnetischen Parallel ganz beständigen Gesetzen gemäß abweicht und daß die Kenntnis dieser Gesetze die Anomalien großenteils verschwinden läßt, welche diese Erscheinung zu bieten scheint. Im allgemeinen ist zuverlässig, wie ich aus dem ganzen Umfang meiner Beobachtungen diese Folgerung gezogen habe, daß die Intensität der Kräfte vom magnetischen Äquator gegen den Pol hin zunehmend wächst; die Schnelligkeit dieses Wachstums aber scheint unter verschiedenen Meridianen ungleich zu sein. Wenn zwei Orte die gleiche Inklination haben, findet sich die größte Stärke westlich des Meridians, welcher den Mittelpunkt des südlichen Amerika durchzieht; sie ist dagegen auf dem Parallel, östlich nach Europa hin, abnehmend. In der südlichen Hemisphäre scheint sie ihr Minimum auf den Ostküsten Afrikas zu erreichen; dann vermehrt sie sich neuerdings auf dem gleichen magnetischen Parallel bis gegen Neu-Holland [Australien] hin. Ich habe die Intensität der Kraft in Mexico fast ebensogroß gefunden wie in Paris, und doch beträgt der Unterschied der Inklinationen über 31 Centesimalgrade. Meine Nadel, die unter dem magnetischen Äquator (in Peru) 211 Schwingungen aufwies, würde unter dem gleichen Äquator, im Meridian der Philippinen, höchstens 202 oder 203 Schwingungen ergeben haben. Dieser auffallende Unterschied ergibt sich aus dem Vergleich meiner in Santa Cruz auf Teneriffa über die Intensität angestellten Beobachtungen mit den durch Herrn de Rossel vier Jahre früher dort gesammelten.
Die an den Ufern des Río Negro ausgeführten magnetischen Beobachtungen sind unter allen, die wir wiederum im Inneren eines großen Kontinents kennen, dem magnetischen Äquator am nächsten. Sie haben infolgedessen zur Bestimmung der Lage dieses Äquators gedient, welchen ich mehr im Westen, auf dem Anden-Kamm zwischen Micuipampa und Cajamarca, unter 7° südlicher Breite überquert habe. Die magnetische Parallele von San Carlos (von 22,60° der Centesimal-Skala) geht durch Popayán und in der Südsee durch einen Punkt (3° 12′ nördl. Breite und 80° 36′ westl. Länge), wo ich das Glück hatte, bei völlig windstiller Witterung beobachten zu können.
*
Den 10. Mai [1800]. Unsere Piroge war in der Nacht beladen worden, und wir schifften uns kurz vor Sonnenaufgang ein, um den Río Negro hinaufzufahren, bis zur Einmündung des Casiquiare, und um über den wahren Lauf dieses den Orinoco mit dem Amazonenstrom verbindenden Flusses Untersuchungen anzustellen. Der Morgen war schön, aber im Verhältnis der zunehmenden Wärme fing der Himmel sich zu überziehen an. Die Luft ist in diesen Wäldern dermaßen mit Wasser gesättigt, daß die bläschenartigen Dünste schon bei der geringsten Verstärkung der Ausdünstung des Erdbodens sichtbar werden. Weil der Seewind nie fühlbar wird, werden die feuchten Schichten auch nie durch trockene Luft ersetzt oder erneuert. Dieser Anblick eines bedeckten Himmels betrübte uns mit jedem Tage mehr. Herrn Bonpland gingen durch das Übermaß der Feuchtigkeit seine gesammelten Pflanzen zugrunde, ich meinerseits fürchtete, im Tal des Casiquiare die Nebel des Río Negro wieder anzutreffen. Seit einem halben Jahrhundert hatte niemand mehr in diesen Missionen an der Verbindung gezweifelt, die zwischen zwei großen Stromsystemen besteht; der wichtige Zweck unserer Flußfahrt beschränkte sich also darauf, durch astronomische Beobachtungen den Lauf des Casiquiare, hauptsächlich den Punkt seines Eintritts in den Río Negro und den der Gabelteilung des Orinoco, zu bestimmen. Bei Verdunklung der Sonne und der Sterne war unser Zweck verfehlt, und wir hatten vergeblich beschwerliche und lange Entbehrungen erduldet. Unsere Reisegefährten hätten auf dem kürzesten Weg zurückzukehren gewünscht, auf dem Pimichín nämlich und den kleinen Flüssen; Herr Bonpland hingegen zog es mit mir vor, dem früheren Reiseplan, welchen wir beim Übergang der großen Katarakte festgesetzt hatten, treu zu bleiben. Von San Fernando de Apure nach San Carlos (auf dem Río Apure, dem Orinoco, dem Atabapo, dem Temi, dem Tuamini und dem Río Negro) hatten wir bereits 180 lieues im Boot zurückgelegt. In den Orinoco durch den Casiquiare zurückkehrend, sollten wir nun von San Carlos nach Angostura abermals 320 lieues fahren. Auf diesem Weg mußten wir zehn Tage gegen die Strömung ankämpfen; der Rest ging auf dem Orinoco abwärts. Es wäre tadelnswert gewesen, wenn wir uns durch die Sorge um einen bewölkten Himmel und durch die Moskitos des Casiquiare hätten abschrecken lassen. Unser indianischer Pilot, welcher kürzlich in Mandavaca gewesen war, verhieß uns die Sonne und „die großen Sterne, welche die Wolken fressen“, sobald wir die Schwarzen Wasser des Guaviare verlassen haben würden. Wir führten demnach unseren Plan, durch den Casiquiare nach San Fernando de Atabapo zurückzukehren aus, und des Indianers Vorhersage erfüllte sich zum Glück für unsere Forschungen. Die Weißen Wasser brachten uns nach und nach hellen Himmel, Sterne, Moskitos und Krokodile.
Wir fuhren zwischen den Inseln Zaruma und Mini oder Mibita durch, die mit dichtem Pflanzenwuchs überzogen sind; und nachdem wir die rápides von Piedra de Uinumane hinaufgefahren waren, gelangten wir in acht Meilen Entfernung vom Fortín San Carlos in den Río Casiquiare. Die Piedra oder der Granitfels, der den kleinen Katarakt bildet, zog durch die vielen ihn durchziehenden Quarzgänge unsere Aufmerksamkeit auf sich. Diese Gänge waren mehrere Zoll breit, und ihre Masse erwies, daß sie nach Alter und Formation sehr verschieden seien. Ich sah deutlich, daß überall, wo sie sich kreuzten, die Gänge, die Glimmerschiefer und schwarzen Schörl enthielten, diejenigen verwarfen, die nur weißen Quarz und Feldspat enthielten. Der Theorie Werners zufolge waren demnach die schwarzen von jüngerer Bildung als die weißen Gänge. Als Schüler der Schule von Freiberg konnte ich nicht anders als mit einigem Vergnügen am Felsen von Uinumane verweilen, um in der Nähe des Äquators Erscheinungen zu beobachten, welche ich so oft in den Gebirgen meines Vaterlands gesehen hatte. Die Theorie, welche diese Gänge als mit verschiedenen Substanzen von oben her ausgefüllte Spalten betrachtet, behagt mir zwar, ich gestehe es, gegenwärtig nicht mehr so sehr wie damals; dagegen verdienen diese Zustände des Durchschneidens und der Verwerfung, die in den steinigen und metallischen Adern wahrgenommen werden, unstreitig die Aufmerksamkeit der Reisenden als eine der allgemeinsten und beständigsten Erscheinungen der Geologie. Ostwärts von Javita, auf der ganzen Länge des Casiquiare und vorzüglich in den Bergen von Duida, vermehrt sich die Zahl der Gänge im Granit. Diese Gänge sind mit Drusen angefüllt, und ihre Menge scheint anzuzeigen, daß der Granit dieser Gegenden keine sehr alte Formation ist.
Auf dem Felsen Uinumane, der Insel Chamanare gegenüber, am Rand der Wasserfälle, fanden wir einige Flechten; und weil der Casiquiare nahe an seiner Mündung sich plötzlich von Osten nach Südwesten dreht, sahen wir hier zum ersten Mal diesen majestätischen Arm des Orinoco in seiner ganzen Breite. Er hat der allgemeinen Ansicht der Landschaft zufolge viel Ähnlichkeit mit dem Río Negro. Wie in dessen Flußbett dehnen sich die Bäume auch dort bis ans Ufer aus und bilden da ein Dickicht; aber der Casiquiare hat weißes Wasser [Mischwasserfluß. Anmerkung des Hrsg.], und er wechselt öfter seine Richtung. In der Nähe der rápides von Uinumane erscheint er fast breiter als der Río Negro, und bis oberhalb von Vasiva habe ich ihn überall 250 bis 280 Toisen breit angetroffen. Ehe wir an der Insel Garigave vorbeikamen, bemerkten wir nordöstlich, fast am Horizont, einen Hügel mit halbkugelförmigem Gipfel. In allen Zonen ist diese Form den Granitbergen eigentümlich. Weil man beständig von ausgedehnten Flächen umgeben ist, erregen abgesondert stehende Felsen und Hügel die Aufmerksamkeit des Reisenden. Ein zusammenhängendes Gebirge findet sich erst weiter östlich, gegen die Quellen von Pacimoni, von Siapa und von Mavaca hin. Südlich der raudales von Caravine bemerkten wir, daß der Casiquiare mittels der Krümmungen seines Laufs sich neuerlich San Carlos nähert. Vom Fortín bis zur Mission von San Francisco Solano, wo wir übernachteten, beträgt der Landweg nur 2½ lieues, zu Wasser zählt man 7 bis 8. In der vergeblichen Hoffnung, Sterne zu sehen, brachte ich einen Teil der Nacht im Freien zu. Die Luft war neblig trotz der aguas blancas, welche uns einem allzeit sternenhellen Himmel entgegenführen sollten.
Die am linken Ufer des Casiquiare gelegene Mission von San Francisco Solano erhielt ihren Namen zu Ehren eines der Häupter der Grenzexpedition, Don José Solano, von welchem wir schon öfters in diesem Werk Anlaß hatten zu sprechen. Dieser gebildete Offizier ist niemals über das Dorf von San Fernando de Atabapo hinausgekommen; er hat weder die Fluten des Río Negro und des Casiquiare noch die des Orinoco östlich der Einmündung des Guaviare gesehen. Es ist ein aus der Unkunde der spanischen Sprache herrührender Irrtum, wenn Geographen geglaubt haben, auf der berühmten Karte von La Cruz Olmedilla die Spur eines 400 lieues langen Weges gefunden zu haben, worauf Don José Solano, wie man behauptet, die Quellen des Orinoco, den See Parima oder das weiße Meer, die Gestade des Cababuri und des Uteta erreicht haben soll. Die Mission von San Francisco ist gleich den meisten christlichen Niederlassungen südlich der großen Katarakte des Orinoco nicht von Mönchen, sondern durch Militärbehörden gegründet worden. Zur Zeit der Grenzexpedition wurden Dörfer angelegt, nach Maß, wie ein Subteniente oder ein Korporal mit seinen Leuten vorrückte. Ein Teil der Eingeborenen zog sich, um unabhängig zu bleiben und den Kampf zu vermeiden, zurück; andere, deren mächtigste Häuptlinge gewonnen waren, schlossen sich den Missionen an. Wo keine Kirche war, da begnügte man sich, ein großes Kreuz von rotem Holz aufzurichten und neben dem Kreuz eine casa fuerte zu erbauen, das heißt ein Haus, dessen Wände aus großen, waagerecht übereinanderliegenden Balken bestanden. Dieses Haus hatte zwei Stockwerke; im oberen waren zwei Steinböller oder Kanonen von kleinem Kaliber aufgestellt; im Erdgeschoß wohnten zwei von einer indianischen Familie bediente Soldaten. Die unter den Eingeborenen, mit welchen man in Frieden lebte, legten ihre Pflanzungen um die casa fuerte an. Von den Soldaten wurden sie beim Schall des Horns oder eines botuto aus gebrannter Erde zusammengerufen, wenn ein feindlicher Angriff zu fürchten war. Auf diese Art wurden die angeblichen 19 christlichen Niederlassungen durch Don Antonio Santos auf dem Weg von Esmeralda nach Erebato gegründet. Militärposten, welche keinerlei Einfluß auf die Zivilisierung der Eingeborenen hatten, figurierten auf den Karten und in den Werken der Missionare als Dörfer (pueblos) und als reducciones apostólicas. Das militärische Übergewicht erhielt sich an den Gestaden des Orinoco bis 1785, als das Regiment der Franziskaner begann. Die wenigen seither gegründeten oder vielmehr wiederhergestellten Missionen sind das Werk dieser Patres; denn heutzutage sind die in den Missionen verteilten Soldaten von den Missionaren abhängig oder werden wenigstens, den Anmaßungen kirchlicher Hierarchie entsprechend, dafür angesehen.
Die Indianer, die wir zu San Francisco Solano trafen, gehörten zwei Nationen an, den Pacimonales und den Cheruvichahenas. Weil diese von einem am Río Tomo, in der Nähe der Manivas vom oberen Guainía angesiedelten beträchtlichen Stamm herkommen, suchte ich von ihnen einige Angaben über den oberen Lauf und die Quellen des Río Negro zu erhalten; doch der Dolmetscher, dessen ich mich bediente, konnte ihnen den Sinn meiner Fragen nicht verständlich machen. Sie wiederholten immer nur bis zum Überdruß, die Quellen des Río Negro und des Inírida befänden sich nahe beisammen „wie zwei Finger der Hand". In einer dieser Hütten der Pacimonales kauften wir zwei schöne und große Vögel, einen Tucan (Piapoco), der dem Ramphastos erythrorynchos verwandt ist, und den Ana, eine Art Aras von 17 Zoll Länge, über den ganzen Körper purpurrot wie der Psittacus Macao. Wir hatten in unserer Piroge bereits sieben Papageien, zwei Felshühner (Pipra, coq de roche), einen Motmot, zwei Guans oder Pavas de monte, zwei Manaviris (Cercoleptes oder Viverra caudivolvula) und acht Affen, nämlich zwei Atelesi [Marimonda der großen Katarakte, Simia Belzebuth, Brisson] zwei Titis (Simia sciurea, Buffons Saïmiri), eine Viudita (Simia lugens), zwei Dourouculis oder Nacht-Affen [cusicusi oder Simia trivirgata] und den kurzgeschwänzten Cacajao [Simia melanocephala]. Auch beschwerte sich der Pater Zea, wenn auch nur leise, über das tägliche Wachstum unserer wandernden Menagerie. Der Tucan ist in seiner Lebensweise und Intelligenz dem Raben gleich, ein kühnes und leicht zähmbares Tier. Sein langer und starker Schnabel dient ihm, sich von weitem zu verteidigen. Er will Herr im Hause sein, stiehlt, was ihm erreichbar ist, badet sich oft und mag gern am Flußufer fischen. Der Vogel, den wir gekauft hatten, war noch sehr jung; aber die ganze Fahrt über kurzweilte es ihn, die finsteren und zornmütigen cusicusis oder Nachtaffen zu necken. Ich habe nicht gesehen, daß der Tucan, wie einige naturgeschichtliche Werke melden, wegen der Bildung seines Schnabels gezwungen sei, um seine Speise zu verschlingen, sie erst in die Höhe zu werfen. Ihr Aufheben vom Boden ist für ihn allerdings mühsam. Hat er sie aber einmal mit der Spitze seines ungeheuren Schnabels erfaßt, dann braucht er ihn nur durch Rückwerfen des Kopfs in die Höhe zu heben und ihn, so lange das Hinunterschlingen dauert, senkrecht zu halten. Wenn er trinken will, macht dieser Vogel nicht weniger seltsame Gebärden. Die Mönche sagen, er schlage über dem Wasser das Zeichen des Kreuzes, und dieser Volksglaube ist es, der die Creolen veranlaßt hat, dem Tucan den wunderlichen Namen Dióstedé (Gott vergelt dir’s) zu geben.
Die meisten unserer Tiere waren in kleine Korbkäfige eingeschlossen, andere liefen in der Piroge frei umher. Wenn es zu regnen drohte, erhoben die Aras ein abscheuliches Geschrei, der Tucan strebte zum Fischfang ans Ufer hin, die kleinen Titisaffen suchten den Pater Zea auf, um sich in den ziemlich weiten Ärmeln seiner Ordenskleider zu bergen. Diese Auftritte wiederholten sich öfter, und wir vergaßen darüber die Plagen der mosquitos. Nachts im Biwak kam in die Mitte ein Lederkasten (petaca) zu stehen, der unseren Proviant enthielt, neben ihn die Instrumente und die Käfige mit den Tieren; ringsum wurden unsere Hängematten aufgehängt und weiterhin die der Indianer. Den Außenkreis bildeten die Feuer, welche zum Schutz gegen die Jaguare des Waldes angezündet werden. So war die Einrichtung unseres Lagers an den Ufern des Casiquiare beschaffen. Die Indianer erzählten wiederholt von einem kleinen nächtlichen langnasigen Tier, das die jungen Papageien in ihrem Nest überfällt und seine Hände zum Fressen gebraucht wie die Affen und die manaviris oder kinkajous. Sie nannten es guachi; wahrscheinlich ist es ein coati, vielleicht die Viverra nasua, die ich in Mexico, nicht aber in dem von mir durchreisten Teil Südamerikas wild zu sehen Gelegenheit hatte. Die Missionare haben den Eingeborenen streng untersagt, das Fleisch des guachi zu essen, welchem einem sehr verbreiteten Vorurteil zufolge eben jene stimulierenden Eigenschaften zugeschrieben werden, die die Morgenländer im Skinkos [Lacerta scincus L. etc.] und die Amerikaner im Fleisch des Caymans zu finden glauben.
Am 11. Mai [1800] verließen wir ziemlich spät die Mission San Francisco Solano, um eine nur kleine Tagereise auszuführen. Die gleichförmige Dunstschicht fing an, sich in Wolken von bestimmten Umrissen zu teilen. In den oberen Luftregionen ließ sich ein schwacher Ostwind spüren. In diesen Zeichen erkannten wir eine nahe Wetteränderung und wollten uns nicht von der Mündung des Casiquiare entfernen, in der Hoffnung, es möchte uns gelingen, in der kommenden Nacht den Durchgang eines Gestirns im Meridian zu beobachten. Südwärts erkannten wir den Caño Daquiapo, nordwärts den Guachaparu und einige Meilen weiter die rápides von Cananivacari. Die Schnelligkeit der Strömung betrug 6,3 Fuß in der Sekunde, so daß wir gegen Wellen, welche im raudal ein ziemlich starkes Geräusch verursachten, zu kämpfen hatten. Wir landeten, und Herr Bonpland entdeckte wenige Schritte vom Ufer einen almendrón [Kolonialspanisch; span. almendro. Anmerkung des Hrsg.] [juvia] oder einen prächtigen Stamm der Bertholletia excelsa: Die Indianer versicherten, in San Francisco Solano, in Vasiva und in Esmeralda sei das Vorkommen dieses köstlichen Baumes an den Ufern des Casiquiare unbekannt. Sie glaubten nicht, daß der über 60 Fuß hohe Baum zufällig von einem Reisenden ausgesät worden wäre. Aus den in San Carlos angestellten Versuchen ist bekannt, wie selten die Bertholletia wegen der holzigen Fruchthülse und des so leicht ranzig werdenden Öls der Mandel zum Keimen gebracht werden kann. Vielleicht deutet dieser Stamm das Dasein einer Bertholletia-Waldung im Binnenland östlich oder nördlich an. Zuverlässig bekannt ist wenigstens, daß dieser schöne Baum unter dem Breitenkreis von 3° in den Cerros de Guayana wild wächst. Die gesellig wachsenden Pflanzen haben nur selten genau bezeichnete Grenzen, und bevor man einen palmar oder einen pinal erreicht, trifft man auf vereinzelte Palmoder Kiefernbäume. Sie gleichen Kolonisten, die mitten in ein von verschiedenartigen Gewächsen bevölkertes Land vorgedrungen sind.
Vier Meilen von den rápides von Cunanivacari entfernt stehen inmitten der Ebenen Felsen der bizarrsten Gestalt. Zuerst eine wenig breite Mauer, 80 Fuß hoch und senkrecht abgeschnitten; am südlichen Ende dieser Mauer erscheinen zwei Türmchen, deren Granitschichten fast waagerecht liegen. Die Gruppierung der Felsen von Guanari ist dermaßen symmetrisch, daß man Ruinen eines alten Gebäudes zu sehen glauben könnte. Sind es die Überbleibsel von Inseln mitten in einem Binnenmeer, das die ganz flachen Ebenen zwischen der Sierra Parima und den Serra dos Parecis bedeckte, oder sind diese Felsenmauern und Granittürmchen durch noch im Inneren unseres Planeten wirksame elastische Kräfte emporgehoben worden? Über die Entstehung der Berge ein wenig zu träumen, mag einem vergönnt sein, wenn man die Anordnung der mexicanischen Vulkane und der Trachyt-Gipfel auf einer verlängerten Spalte gesehen hat, wenn man in den südamerikanischen Anden in ein und derselben Kette Ur- und vulkanisches Gebirge aufgereiht sah, und wenn man sich der Insel von drei Meilen Umfang und von außerordentlicher Höhe erinnert, die in unseren Tagen nahe bei Unalaska [Alëuten-Insel] vom Meeresgrund emporgestiegen ist.
Die Ufer des Casiquiare werden durch die Chiriva-Palme mit gefiederten und am Unterteil silberfarbenen Blättern verschönert. Die übrige Waldung enthält nur Bäume mit großen, lederartigen, glänzenden und ungezähnten Blättern. Dieses eigentümliche Aussehen der Vegetation des Guainía, des Tuamini und des Casiquiare ist die Folge des Übergewichts, welches in den Äquatorialländern die Familien der Guttbäume (Guttiferen), der Busenbäume (Sapotillien) und der Laurineen [Lorbeer] erhalten. Weil der heitere Himmel uns eine schöne Nacht verhieß, beschlossen wir, schon um 5 Uhr abends unser Lager in der Nähe der Piedra de Culimacari zu errichten, eines Granitfelsen, der gleich allen vorhin beschriebenen, zwischen dem Atabapo und dem Casiquiare vorkommenden, abgesondert steht. Die Aufnahme der Krümmungen des Flusses zeigt uns, daß dieser Fels ungefähr im Parallel der Mission von San Francisco Solano liegt. In diesen öden Landschaften, in denen der Mensch nur flüchtige Spuren seines Daseins zurückließ, habe ich jedesmal versucht, in der Nähe einer Flußmündung oder am Fuß eines durch seine Form ausgezeichneten Felsens Beobachtungen anzustellen. Es gibt nur diese, ihrer Natur nach unwandelbaren Punkte, die als Grundlage geographischer Karten dienen können. In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai erhielt ich eine gute Breitenbeobachtung mit Alpha im Kreuz des Südens; die Länge wurde wohl weniger genau, mittels der zwei schönen, zu den Füßen des Centaur glänzenden Sterne chronometrisch bestimmt. Diese Beobachtung hat uns gleichzeitig und mit einer für geographische Zwecke hinlänglichen Genauigkeit die Lage der Mündung des Río Pacimoni, des Fortíns von San Carlos und der Vereinigung des Casiquiare mit dem Río Negro bekannt gemacht. Der Felsen von Culimacari liegt sehr genau unter 2° 0′ 42″ Breite und wahrscheinlich unter 69° 33′ 50″ Länge. Ich habe in zwei spanisch geschriebenen Abhandlungen, deren die eine dem Generalkapitän in Caracas, die andere dem Staatsminister, Herrn d’Urquijo, zugestellt worden ist, dargelegt, wie diese astronomischen Beobachtungen für die Kenntnis der Grenzen der portugiesischen Besitzungen benutzt werden können. Zur Zeit von Solanos Expedition wurde die Vereinigung des Casiquiare und des Río Negro zu einem halben Grad nördlich vom Äquator angenommen; und obgleich die Grenzkommission nie zu einem abschließenden Resultat gelangt ist, wurde in den Missionen jedoch stets der Äquator als eine provisorisch anerkannte Grenze betrachtet. Aus meinen Beobachtungen aber ergibt sich, daß San Carlos de Río Negro oder, wie man sich hier prunkvoll ausdrückt, die Grenzfestung, weit entfernt unter 0° 20′ Breite liegt, wie der Pater Caulin versichert, oder unter 0° 53′, wie La Cruz und Surville (die bestellten Geographen der Real Expedición de límites) behaupten, vielmehr unter 1° 53′ 42″ zu suchen ist. Der Äquator verläuft also nicht nördlich des portugiesischen Fortín von São José da Marabitanas, wie auf allen bisherigen Karten, die neue Ausgabe der Karte von Arrowsmith ausgenommen, angegeben, sondern 25 lieues südlicher, zwischen San Felipe und der Mündung des Río Guape. Aus der handschriftlichen Karte des Herrn Requena, die in meinem Besitz ist, erhellt, daß die portugiesischen Astronomen bereits 1783 diesen Tatbestand gekannt haben, demnach 35 Jahre, ehe er auf unseren europäischen Karten bemerkt worden ist.
Weil in der Capitania general von Caracas von jeher die Meinung herrschte, der geschickte Ingenieur Don Gabriel Clavero habe das Fortín von San Carlos de Río Negro auf die Äquinoktiallinie gebaut, und weil die in der Nähe dieser Linie beobachteten Breiten nach Herrn de La Condamines Versicherung zu weit südlich angegeben wurden, erwartete ich den Äquator einen Grad nördlich von San Carlos und demnach an den Ufern des Temi und des Tuamini zu finden. Die in der Mission von San Báltasar angestellten Beobachtungen (der Durchgang von drei Sternen im Meridian) hatten mir bereits die Unrichtigkeit dieser Vermutung angedeutet; die Breite von Piedra Culimacari hat mich jedoch erst mit der wahren Lage der Grenzen bekannt gemacht. Die Insel San José im Río Negro, welche bis jetzt als Grenze zwischen den spanischen und portugiesischen Besitzungen angesehen worden ist, befindet sich wenigstens unter 1° 38′ nördlicher Breite; und falls die Kommission von Ituriaga und Solano zum Ziel ihrer langen Unterhandlungen gelangt sein würde, wenn der Äquator vom Hof in Lissabon als die Grenze beider Staaten entscheidend anerkannt worden wäre, so würden sechs portugiesische Dörfer und das Fortín von San José selbst, welche nördlich des Río Guape liegen, gegenwärtig der Krone Spaniens angehören. Was damals mittels einiger astronomischer Beobachtungen erworben wurde, ist bedeutender, als das was man gegenwärtig besitzt; aber man muß hoffen, daß zwei Völker, welche die ersten Keime der Zivilisation auf einer ungeheuren Ausdehnung des südlichen Amerika ostwärts der Anden ausgestreut haben, den Grenzstreit über einen 33 lieues breiten Landstrich und über den Besitz eines Stroms, nicht erneuern werden, dessen Schiffahrt frei sein soll wie die des Orinoco und des Amazonenstroms.
Den 12. Mai [1800]. Vergnügt über unsere Beobachtungen, verließen wir den Felsen Culimacari um 1½ Uhr in der Nacht. Die Plage der mosquitos, der wir neuerdings ausgesetzt waren, vermehrte sich in dem Maße, wie wir uns vom Río Negro entfernten. Im Tal des Casiquiare finden sich keine zancudos (Culex); dagegen kommen die Simulien und alle anderen Insekten aus der Schnaken-Familie der Tipulae dort um so häufiger und giftiger vor. Weil wir in diesem feuchten und ungesunden Klima noch acht Nächte unter freiem Himmel verbringen mußten, ehe wir die Mission von Esmeralda erreichten, war der Pilot besorgt, unsere Flußfahrt so einzurichten, daß wir die gastfreundliche Aufnahme beim Missionar von Mandavaca genießen und Obdach im Dorf Vasiva finden konnten. Das Fahren gegen die Strömung war beschwerlich, die 9 Fuß und an einigen Stellen (wo ich sie genau gemessen habe) 11 Fuß 8 Zoll auf die Sekunde, demnach fast acht Meilen in der Stunde, betrug. Unser Biwak stand wahrscheinlich nicht über drei lieues in Luftlinie von der Mission Mandavaca entfernt, und obgleich wir über die Arbeit unserer Ruderer gar nicht zu klagen hatten, brauchten wir dennoch 14 Stunden für die kurze Fahrt.
Gegen Aufgang der Sonne kamen wir an der Einmündung des Río Pacimoni vorbei. Dies ist der Fluß, von welchem weiter oben anläßlich des Handels mit Sarsaparille die Rede war und der (durch den Baria) eine so außerordentliche Verzweigung mit dem Cababuri darstellt. Der Pacimoni entspringt in einem Bergland und aus der Vereinigung von drei kleinen Flüssen, die auf den Karten der Missionare nicht gefunden werden. Seine Wasser sind schwarz, doch in minderem Grad als die des Vasiva-Sees, welcher sich ebenfalls mit dem Casiquiare verbindet. Zwischen diesen zwei von Osten kommenden Zuflüssen befindet sich die Einmündung des Río Idapa, dessen Wasser weiß sind. Ich will nicht mehr auf die Schwierigkeit der Erklärung dieses Nebeneinanderseins verschieden gefärbter Flüsse auf einem kleinen Landstrich zurückkommen und nur bemerken, daß an der Mündung des Pacimoni und an den Ufern des Vasiva-Sees uns neuerlich die Reinheit und ausnehmende Klarheit dieser braunen Wasser auffallend gewesen ist. Alte arabische Reisende hatten schon bemerkt, daß der alpine Arm des Nils, welcher sich in der Nähe von Halfaya mit dem Bahar-el-Abiad verbindet, so durchsichtig ist, daß man die Fische auf dem Grund des Stroms unterscheidet.