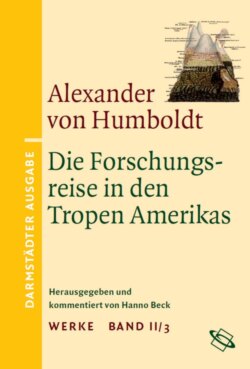Читать книгу Werke - Hanno Beck - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[Zur Kenntnisgeschichte des hydrographischen Systems der Gewässer nördlich des Amazonas]
ОглавлениеIch bin bei der Schilderung des Nationalhasses verweilt, den kluge Administratoren zu mildern gesucht haben, ohne ihn völlig dämpfen zu können. Diese Eifersucht hat nachteiligen Einfluß auf die geographischen Kenntnisse gehabt, welche wir uns bisher über die sich in den Amazonenstrom ergießenden Flüsse verschaffen konnten. Wenn die Verbindungen zwischen den Eingeborenen gehemmt sind und das eine Volk nahe an der Mündung, das andere am Oberlauf desselben Flusses angesiedelt ist, so fällt es denen, die genaue Karten aufnehmen wollen, schwer, zuverlässige Angaben zu erhalten. Die periodischen Überschwemmungen und besonders die Portagen, wodurch die Schiffe aus einem Fluß in den anderen, dessen Quellen nicht weit entfernt liegen, hinübergetragen werden, können Gabelteilungen und Zwischenarme der Flüsse vermuten lassen, die in der Tat nicht vorhanden sind. Die Indianer der portugiesischen Missionen zum Beispiel gelangen (wie ich an Ort und Stelle erfuhr) einerseits durch den Río Guaicia [so wird in San Carlos de Río Negro der im nahen portugiesischem Gebiet fließende Río Xié genannt] und den Río Tomo in den spanischen Río Negro, andererseits über die Portagen zwischen dem Cababuri, dem Pasimoni, dem Idapa und dem Mavaca in den oberen Orinoco, um hinter Esmeralda die aromatischen Beeren des Pucherylorbeers zu sammeln. Die Eingeborenen sind, ich wiederhole es, vortreffliche Geographen: Sie umgehen den Feind trotz der auf den Karten bezeichneten Grenzen, trotz der Fortíns und der Destacamentos [Militärposten]; und wenn die Missionare sie von ferne her und in verschiedenen Jahreszeiten eintreffen sehen, beginnen sie Hypothesen über angebliche Verbindungen der Flüsse aufzustellen. Jede Partei hat einige Gründe, um das geheimzuhalten, was sie zuverlässig weiß; und der Hang für alles, was geheimnisvoll ist, diese bei ungebildeten Menschen so verbreitete und starke Neigung, hilft die Ungewißheit unterhalten. Dazu kommt noch, daß die verschiedenen indianischen Völker, welche dieses Labyrinth von Flüssen besuchen, ihnen ganz abweichende Namen geben, die durch Endungen maskiert oder verlängert sind, deren Bedeutung „Wasser, großes Wasser, Strömung“ ist. Wie oft hat mich die Notwendigkeit, die Synonymie der Flüsse zu bestimmen, in Verlegenheit gesetzt, wenn ich die verständigsten Eingeborenen rufen ließ, um sie von einem Dolmetscher über die Zahl der Zuflüsse, über die Quellen und die Portagen befragen zu lassen! Weil drei und vier Sprachen in der Mission geredet werden, fällt es schwer, die Zeugen in Einklang zu bringen. Unsere Karten wimmeln von willkürlich verkürzten oder verstümmelten Namen. Um, was richtig darin sein mag, zu würdigen, muß man sich durch die geographische Lage der Zuflüsse (ich möchte fast sagen, durch einen gewissen etymologischen Takt) leiten lassen. Der Río Uaupés oder Uapes der portugiesischen ist der Guapué der spanischen Karten und der Ucayari der Eingeborenen. Der Anava der alten Geographen ist Arrowsmiths Anauahu und der Uanauhau oder Guanauhu der Indianer. Das Bestreben, keine Lücken auf den Karten zu lassen, um ihnen ein genaues Aussehen zu verschaffen, hat Flüsse erzeugt, denen Namen erteilt wurden, die nur Synonyma von anderen waren. In der neuesten Zeit erst haben die Reisenden in Amerika, in Persien und Indien die Wichtigkeit genauer Ortsbenennungen eingesehen. Nur mit Mühe kann man beim Lesen der Reise des berühmten Raleigh im See von Mrecabo den Maracaibo-See und im Marquis Paraco den Namen Pizarros, des Zerstörers des Inca-Reiches, erkennen.
Die großen Zuflüsse des Amazonenstroms führen selbst bei den Missionaren europäischer Herkunft an ihrem Ober- und Unterlauf verschiedene Namen. Die in den Missionen der Andaquies gehaltenen Nachfragen über den eigentlichen Ursprung des Río Negro sind vollends ohne Erfolg geblieben, weil man den indianischen Namen des Flusses nicht kannte. In Javita, in Maroa und in San Carlos hörte ich ihn Guainía nennen. Der gelehrte Historiker Brasiliens, Herr Southey, den ich überall sehr genau fand, wo ich seine geographischen Angaben mit den auf meinen Reisen gesammelten vergleichen konnte, sagt ausdrücklich, der Río Negro werde im Unterlauf von den Eingeborenen Guaiari oder Curana, im Oberlauf Ueneya genannt. Es ist dies das Wort Gueneya statt Guainía; denn die Indianer dieser Landschaften sagen ohne Unterschied Guaranacua oder Ouaranacua, Guarapo und Uarapo. Aus diesem letzteren Namen haben Hondius und alle alten Geographen infolge eines drolligen Mißverständnisses ihren Europa fluvius gebildet.
Hier ist der Ort, von den Quellen des Río Negro zu sprechen, welche seit längerem unter den Geographen strittig gewesen sind. Das Interesse an dieser Frage betrifft nicht nur den Ursprung aller großen Ströme; sie steht auch im Zusammenhang mit vielen anderen Fragen, über die angeblichen Bifurkationen des Caquetá, über die Verbindungen des Río Negro mit dem Orinoco und über die lokale Mythe vom Dorado, vormals Enim oder das Reich von Groß-Paytiti genannt. Das Studium der alten Karten dieser Landschaften und der Geschichte geographischer Irrtümer zeigt, wie nach und nach zugleich mit den Quellen des Orinoco die Dorado-Mythe nach Osten verpflanzt wurde. Von ihrem Ursprung am östlichen Abhang der Anden ausgehend, hatte sie sich anfangs, wie ich an anderer Stelle dartun werde, südwestwärts des Río Negro angesiedelt. Der tapfere Felipe de Urre [Philipp v. Hutten] suchte die große Stadt Manoa jenseits des Guaviare. Heutzutage noch erzählen die Indianer von São José de Marabitanas, mit nordwestlicher Schiffahrt auf dem Guapué oder Uaupés gelange man zu einer berühmten Laguna de oro, die von Bergen eingefaßt und so groß sei, daß man das jenseitige Ufer nicht sehen könne. Ein wildes Volk, die Guanes, gestattet nicht, das Gold im Sandufer des Sees zu sammeln. Der Pater Acuña verlegt den Manoa- oder Yenefiti-See zwischen den Japurá und den Río Negro. Von Manaos-Indianern (aus dem Wort Manoa, durch Verschiebung der Selbstlaute, die bei sehr vielen amerikanischen Nationen gewöhnlich ist) erhielt der Pater Fritz im Jahre 1687 zahlreiche Platten von geschlagenem Gold. Diese Nation, deren Namen noch gegenwärtig an den Gestaden des Urarira, zwischen Lamalonga und Moreira, bekannt ist, wohnte am Jurubesh (Yurnbech, Yurubets). Herr de La Condamine sagt vollkommen richtig, dieses Mesopotamien sei zwischen dem Caquetá, dem Río Negro, dem Jurubesh und dem Iquiare erster Schauplatz des Dorado. Wo soll man aber die Namen Jurubesh und Iquiare des Pater Acuña und des Pater Fritz suchen? Ich glaube, sie in den Flüssen Urubaxi und Iguari der portugiesischen Manuskriptkarten wiedererkannt zu haben, die ich besitze und die im Hydrographischen Depot von Rio de Janeiro entworfen worden sind. Ich habe seit einer langen Reihe von Jahren die Geographie des südlichen Amerika nördlich des Amazonenstroms, nach den ältesten Karten und mit Hilfe vieler ungedruckter Materialien, sorgfältig erforscht. Weil diese Reisebeschreibung den Charakter eines wissenschaftlichen Werks behalten soll, darf ich keinen Anstand nehmen, Gegenstände darin zu behandeln, über die ich einige Aufschlüsse liefern zu können hoffe [Hervorhebung vom Hrsg.]: die Quellen des Río Negro und des Orinoco nämlich, die Verbindung der zwei letzteren Flüsse mit dem Amazonenstrom und das Problem des Goldlandes, das die Bewohner der Neuen Welt so viel Blut und Tränen gekostet hat. Ich werde diese verschiedenen Aufgaben behandeln, sobald meine Reisetagebücher mich an die Orte führen, deren Einwohner sie selbst am lebhaftesten erörtern. Um jedoch kleinliche Einzelheiten, die als Belege meiner Angaben dienen, zu vermeiden, werde ich mich hier auf Darstellung der Hauptergebnisse beschränken und die ausführlicheren Darlegungen der Analyse der Karten dem ›Essai sur la géographie astronomique du Nouveau Continent‹ [›Examen critique‹, der die Analyse des ›Atlas géographique et physique du Nouveau Continent‹ ist] vorbehalten.
Diese Untersuchungen führen zu dem allgemeinen Schluß, daß die Natur in der Verteilung der auf der Oberfläche der Erde zirkulierenden Gewässer ebenso wie in der Bildung der organischen Körper einen ungleich weniger verwickelten Plan verfolgt hat, als man zu glauben versucht ist, wenn man sich nur durch schwankende Ansichten und die Neigung zum Wunderbaren leiten läßt. Man gelangt auch zu der Überzeugung, daß all diese Anomalien, all diese Ausnahmen von hydrographischen Gesetzen, die das Binnenland von Amerika aufweist, in der Tat nur scheinbar sind; daß der Lauf der fließenden Wasser in der Alten Welt gleich merkwürdige Erscheinungen darbietet, daß diese aber ihrer Kleinheit wegen die Aufmerksamkeit der Reisenden weniger anregen. Wenn unermeßliche Ströme als zusammengesetzt aus verschiedenen, einander parallellaufenden, aber ungleich tiefen Furchen angesehen werden können; wenn diese Ströme nicht in Tälern eingefaßt sind; und wenn das Innere eines großen Kontinents ebenso flach ist wie bei uns der Meeresstrand: dann müssen sich wohl die Verästelungen, die Gabelteilungen und die netzförmigen Verzweigungen ins Unendliche vervielfältigen. Demzufolge, was wir vom Gleichgewicht der Meere wissen, kann ich nicht glauben, daß die Neue Welt später als die Alte aus dem Meeresgrund erstanden und daß das organische Leben darin jünger oder neueren Ursprungs sein sollte; demnach läßt sich, ohne Gegensätze zwischen beiden Halbkugeln ein und desselben Planeten zuzugeben, begreifen, daß in der, welche eine größere Wassermenge besitzt, die verschiedenen Flußsysteme, um sich voneinander zu sondern und ihre gegenseitige Unabhängigkeit festzusetzen, mehr Zeit gebraucht haben. Die Anspülungen, welche sich überall bilden, wo die Schnelligkeit des laufenden Wassers sich mindert, tragen unstreitig dazu bei, die großen Strombetten zu erhöhen und die Überschwemmungen zu vermehren; auf die Dauer aber werden durch diese Überschwemmungen die Flußarme und die schmalen Kanäle, welche benachbarte Flüsse vereinigen, gänzlich angefüllt und verstopft. Die vom Regenwasser herbeigeschwemmten Materien bilden durch ihre Anhäufungen neue Schwellen, Isthmen angeschwemmten Landes, Wasserscheiden, die zuvor nicht vorhanden waren. Daraus ergibt sich, daß die natürlichen Verbindungskanäle sich nach und nach in zwei Zuflüsse teilen und daß diese infolge einer querlaufenden Erhöhung zwei entgegengesetzte Abhänge erhalten. Ein Teil ihrer Gewässer wird gegen den Hauptwasserbehälter zurückgetrieben, und zwischen zwei parallelen Betten erhebt sich eine Böschung, durch die zuletzt jede Spur der früheren Verbindung verschwindet. In Gabelteilungen findet nun die Vereinigung verschiedener Flußsysteme weiter nicht statt; da, wo Bifurkationen in der Zeit der großen Überschwemmungen fortdauern, sieht man, wie die Gewässer sich vom Hauptwasserbehälter nur entfernen, um nach kürzeren oder längeren Umwegen wieder in ihn zurückzukehren. Grenzen, welche anfangs schwankend und unsicher erschienen, fangen an, bestimmter zu werden; und im Lauf der Jahrhunderte, durch die Wirkung alles dessen, was auf der Oberfläche des Erdballs beweglich ist, durch die der Gewässer, der Anschwemmungen und Versandungen, trennen sich die Flußbetten, wie sich die großen Seen abteilen und wie die Binnenmeere ihre vormaligen Verbindungen verlieren.
Die Gewißheit, welche die Geographen schon im 16. Jahrhundert über das Dasein mehrerer Gabelteilungen und über die gegenseitige Abhängigkeit verschiedener Flußsysteme im südlichen Amerika erhalten hatten, verleitete sie, eine genaue Verbindung zwischen den fünf großen Zuflüssen des Orinoco und des Amazonenstroms – dem Guaviare, dem Inírida, dem Río Negro, dem Caquetá oder Hyapurá [Japurá] und dem Putumayo oder Iça – anzunehmen. Diese Hypothesen, die sich auf unseren Landkarten verschiedenartig dargestellt finden, sind teils von den Missionen der Ebenen, teils vom Rücken der Anden ausgegangen. Wer die Reise von Santa Fé de Bogotá durch Fusagasuga nach Popayán und Pasto macht, hört von den Bergbewohnern, daß aus dem Páramo de la Suma Paz (Páramo des ewigen Friedens), von Iscancé und von Aponte, auf ihrem östlichen Abhang, alle Flüsse entspringen, welche zwischen dem Meta und dem Putumayo durch die Wälder von Guayana ihren Lauf nehmen. Weil man die Zuflüsse für den Hauptstamm nimmt und den Lauf aller Flüsse bis an die Bergkette verlängert, verwechselt man dort die Quellen des Orinoco, des Río Negro und des Guaviare. Der äußerst schwierige Abstieg am steilen Abhang der Ostseite der Anden, die von engherziger Politik herrührenden Hemmungen des Verkehrs mit den Llanos des Meta, von San Juan und von Caguán, das geringe Interesse, welches die Bereisung der Flüsse zur Erforschung ihrer Verästlungen findet, sind alles Umstände, welche die geographischen Ungewißheiten vermehren helfen. Zur Zeit meines Aufenthalts in Santa Fé de Bogotá war kaum noch der Weg bekannt, welcher durch die Dörfer Usme, Ubaque oder Caqueza nach Apiay und zum Landeplatz des Río Meta führt. Erst kürzlich bin ich imstand gewesen, die Karte dieses Flusses mittels des Reisetagebuchs des Kanonikus Cortés Madariaga und mittels der während des Unabhängigkeitskrieges von Venezuela erhaltenen Angaben zu berichtigen.
Nachstehendes ist, was wir zuverlässig über die Lage der Quellen am Fuß der Cordilleren zwischen 4° 20′ und 1° 10′ nördlicher Breite wissen. Hinter dem Páramo de la Suma Paz, den ich von Pandi her aufnehmen konnte, entspringt der Río de Aguas Blancas, welcher mit dem Pachaquiaro oder Río Negro von Apiay den Meta bildet; mehr südwärts kommt der Río Ariari, welcher einer der Zuflüsse des Guaviare ist, dessen Mündung ich bei San Fernando del Atabapo gesehen habe. Verfolgt man den Rücken der Cordillere gegen Ceja und den Páramo de Aponte, findet man den Río Guayavero, der nahe beim Dorf Aramo vorbeifließt und sich mit dem Ariari vereinigt; unterhalb dieses Zusammenflusses nehmen die zwei Ströme den Namen Guaviare an. Südwestlich vom Páramo von Aponte entspringt am Fuß des Gebirges, in der Nähe von Santa Rosa, der Río Caquetá, auf der Cordillere selbst aber der in der Geschichte der conquista berühmte Río de Mocoa. Diese zwei Ströme, die sich etwas oberhalb der Mission San Agustín von Nieta vereinigen, bilden den Jupurá oder Caquetá. Die Quellen des Río de Mocoa werden durch den Cerro del Portachuelo, einen Berg, der sich auf dem Plateau der Cordilleren erhebt, von dem See (Ciénega) von Sebendoy getrennt, welcher der Ursprung des Río Putumayo oder Iça ist. Der Meta, der Guaviare, der Caquetá und der Putumayo sind demnach die einzigen großen Ströme, welche unmittelbar am östlichen Abhang der Anden von Santa Fé, von Popayán und von Pasto entspringen. Der Vichada, der Zama, der Inírida, der Río Negro, der Uaupés und der Apoporis, die auf unseren Karten gleichfalls westwärts bis zu den Bergen führen, haben ihren Ursprung entfernt von diesen teils in den Savannen zwischen dem Meta und dem Guaviare, teils in dem Gebirgsland, das nach den Angaben, die wir von den Eingeborenen erhielten, in der Entfernung von vier bis fünf Tagesreisen westwärts der Missionen von Javita und von Maroa seinen Anfang nimmt und sich durch die Sierra Tunuhy über den Xié hin gegen die Gestade des Issana dehnt.
Es ist allerdings bemerkenswert genug, daß dieser Cordillerenkamm, welcher die Quellen so vieler majestätischer Flüsse – des Meta, des Guaviare, des Caquetá und des Putumayo – birgt, ebensowenig mit Schnee bedeckt ist wie die Berge Abessiniens, von denen herab der Blaue Nil kommt; hingegen gelangt man, wenn man die Flüsse, welche die Ebenen durchschneiden, hinaufgeht, ehe man die Cordilleren der Anden berührt, zu einem noch wirklich tätigen Vulkan. Diese Erscheinung ist vor kurzem erst durch die Franziskanerordensmänner, welche von Ceja auf dem Río Fragua zum Caquetá hinabfahren, gemacht worden. Ein einzeln stehender Hügel, der Tag und Nacht raucht, steht nordöstlich von der Mission Santa Rosa, westlich vom Puerto del Pescado. Es ist das Ergebnis einer Seitenwirkung der Vulkane von Popayán und von Pasto, wie der Guacamayo und der Sangay, welche gleichfalls am Fuß des östlichen Abhangs der Anden liegen, das Ergebnis einer Seitenwirkung des Systems der Vulkane von Quito sind. Wenn man die Gestade des Orinoco und des Río Negro, wo der Granitfels überall zutage tritt, aus der Nähe gesehen hat, wenn man das gänzliche Nichtvorhandensein vulkanischer Öffnungen in Brasilien, in Guayana, auf dem Küstenland von Venezuela und vielleicht auf der ganzen Abteilung des Festlandes ostwärts der Anden bedenkt, gewinnt die Ansicht der drei tätigen Vulkane in der Nähe der Quellen des Caquetá, des Napo und des Río de Macas oder Morona dadurch ein eigentümliches Interesse.
Obgleich die imposante Größe des Río Negro schon Orellana beeindruckte, der ihn 1539 bei seiner Vereinigung mit dem Amazonenstrom gesehen hat, undas nigras spargens, so wurde doch erst ein Jahrhundert später sein Ursprung von den Geographen am Abhang der Cordilleren gesucht. Die Reise Acuñas ist die Veranlassung von Hypothesen geworden, die sich bis auf unsere Zeit fortgepflanzt haben und durch die Herren de La Condamine und d’Anville über die Maßen verbreitet worden sind. Acuña hatte 1638 an der Mündung des Río Negro vernommen, daß dessen Arm mit einem anderen großen Strom, an welchem die Holländer angesiedelt waren, zusammenhinge. Herr Southey bemerkt hierzu scharfsinnig, diese in so ungemein großer Entfernung von den Küsten empfangene Nachricht beweise, wie mannigfach und emsig zu jener Zeit der Verkehr der wilden Völker dieser Gegenden (vorzüglich unter denen vom Cariben-Stamm) gewesen sein müsse. Es bleibt zweifelhaft, ob die von Acuña befragten Indianer die Verbindung des Orinoco mit dem Río Negro durch den Casiquiare, einen natürlichen Kanal, welchen ich von San Carlos bis Esmeralda hinaufgefahren bin, gemeint haben oder ob sie nur unbestimmt von den Portagen sprechen wollten, die zwischen den Quellen des Río Branco und des Río Essequibo bestehen. Acuña selbst war nicht der Meinung, daß der große Strom, dessen Mündung die Holländer im Besitz hatten, der Orinoco sei; er ahnte eine Verbindung mit dem Río San Felipe, welcher westlich vom Kap Nord mündet und auf dem seiner Meinung nach der Tyrann Lope de Aguirre seine lange Flußfahrt beendigt hatte. Diese letztere Vermutung scheint mir sehr gewagt, obgleich, wie schon oben bemerkt wurde, der Tyrann in seinem ungereimten Brief an König Philipp II. selbst gesteht, er begreife nicht, wie er und die Seinen aus einer solchen Wassermasse sich retten konnten.
Bis zur Reise Acuñas und bis zu den schwankenden Angaben, welche er sich über Verbindungen mit einem anderen großen Fluß nordwärts des Amazonenstroms verschafft hatte, wurde der Orinoco von den unterrichtetsten Missionaren für eine Fortsetzung des Caquetá (Kaqueta, Caketa) gehalten. „Dieser Fluß“, sagt Fray Pedro Simón im Jahre 1625, „entspringt am östlichen Abhang des Páramo von Iscancé. Er nimmt den Papamene auf, welcher von den Anden von Neiva herkommt, und heißt nacheinander Río Iscancé, Tama (wegen der angrenzenden Landschaft der Tama-Indianer), Guayare, Baraguán und Orinoco. “ Die Lage des Páramo von Iscancé, einem hohen pyramidalischen Gipfel, den ich vom Plateau von Mamendoy und von den schönen Ufern des Mayo aus gesehen habe, bezeichnet in dieser Beschreibung den Caquetá. Der Río Papamene ist der Río de la Fragua, welcher mit dem Río de Mocoa einen der Hauptarme des Caquetá bildet. Wir kennen ihn aus den ritterlichen Reisen Georgs von Speier und Philipps von Hutten. Diese zwei Kriegsmänner mußten über den Ariari und den Guayavero setzen, um die Gestade des Papamene zu erreichen. Die Tama-Indianer sind noch heutzutage am nördlichen Gestade des Caquetá eine der verbreitetsten Völkerschaften. Darum darf man sich nicht wundern, daß dieser Strom nach Fray Pedro Simóns Angabe den Namen des Río Tama erhalten hat. Weil die Quellen der Zuflüsse des Caquetá den Zuflüssen des Guaviare sehr nahe liegen und dieser einer der großen, sich in den Orinoco ergießenden Ströme ist, so verfiel man schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts in den Irrtum, den Caquetá (Río de Iscancé und Papamene), den Guaviare (Guayare) und den Orinoco für denselben Fluß zu halten. Niemand war den Caquetá zum Amazonenstrom hinabgefahren, um sich zu überzeugen, daß der Fluß, welcher weiter unten Japurá heißt, mit dem Caquetá identisch ist. Eine noch heutzutage unter den Bewohnern dieser Landschaften fortlebende Überlieferung, nach welcher ein Arm des Caquetá unterhalb des Zusammenflusses des Caguán und des Payoya zum Inírida und zum Río Negro geht, hat ohne Zweifel beigetragen, die Meinung zu beglaubigen, derzufolge der Orinoco an der Rückseite der Berge von Pasto entspringt.
Wir haben gesehen, daß in Neu-Granada die Meinung herrschte, die Wasser des Caquetá wie die des Ariari, des Meta und des Apure flössen dem großen Becken des Orinoco zu. Wenn man der Richtung dieser Zuflüsse mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte, würde man gemerkt haben, daß es trotz der allgemeinen östlichen Abdachung des Terrains in den Polyedern des Bodens, aus dem die Ebenen bestehen, nordöstliche und südöstliche Hänge zweiter Ordnung gibt. Ein fast unmerklicher Kamm oder eine Wasserscheide dehnt sich auf der Parallele von 2° von den Timana-Anden gegen die Landenge, welche Javita vom Caño Pimichín trennt, über die wir unsere Piroge bringen ließen. Nordwärts dieses Parallels von Timana ist der Lauf der Gewässer nordöstlich oder östlich gerichtet, und sie bilden die Nebenflüsse oder die Nebenflüsse der Nebenflüsse des Orinoco. Aber südlich des Parallels von Timana, in den Ebenen, welche denen von San Juan völlig zu gleichen scheinen, fließen der Caquetá oder Japurá, der Putumayo oder Iça, der Napo, der Pastaça und der Morona in südöstlicher und in südsüdöstlicher Richtung dem Bett des Amazonenstroms zu. Dabei ist auch bemerkenswert, daß diese Wasserscheide selbst nur eine Verlängerung derer ist, welche ich in den Cordilleren auf dem Weg von Popayán nach Pasto fand. Zieht man eine Wasserscheide durch Ceja (ein wenig südwärts von Timana), durch den Páramo de las Papas gegen den Alto del Roble, zwischen 1° 45′ und 2° 20′ der Breite, bei 970 Toisen Erhöhung, so findet man die divortia aquarum [Wasserscheide] zwischen dem Antillen [Caribischen]-Meer und dem Stillen Ozean.
Vor Acuñas Reise war es herrschende Meinung unter den Missionaren, der Caquetá, der Guaviare und der Orinoco seien nur verschiedene Namen desselben Flusses; der Geograph Sanson aber verfiel auf den Gedanken, in den von ihm nach Acuñas Beobachtungen gefertigten Karten den Caquetá in zwei Arme zu teilen, deren einer der Orinoco, der andere der Río Negro oder Curiguacuru sein sollte. Diese rechtwinklige Gabelteilung erscheint auf allen Karten von Sanson, von Coronelli, von Duval und von Delisle, seit 1656 bis 1730. Hierdurch glaubte man die Verbindung der großen Ströme zu erklären, deren erste Kunde durch Acuña von der Mündung des Río Negro hergeleitet worden war, und niemand ahnte, daß der Japurá die eigentliche Fortsetzung des Caquetá sei. Zuweilen wurde auch der Name des Caquetá völlig weggelassen, und der gabelförmig sich teilende Strom mit den Namen Río Paria oder Yuyapari belegt, welches die alten Benennungen des Orinoco sind. Delisle hat in seinen späteren Jahren die Gabelteilung des Caquetá wieder gelöscht, zum großen Bedauern von La Condamine; er zeichnete den Putumayo, den Japurá und den Río Negro als voneinander völlig unabhängige Flüsse, und um gleichsam jede Hoffnung einer Verbindung zwischen dem Orinoco und dem Río Negro zu vertilgen, zeichnete er zwischen beiden Strömen eine hohe Bergkette. Pater Fritz hatte auch [1722] schon dieser Meinung gehuldigt, welche zur Zeit des Hondius für die wahrscheinlichste gehalten wurde.
Die Reise des Herrn de La Condamine, die so viel Licht über manche Teile Amerikas verbreitet hat, brachte hingegen nur Verwirrung in alles, was den Lauf des Caquetá, des Orinoco und des Río Negro betrifft. Zwar hat dieser berühmte Gelehrte ganz richtig eingesehen, daß der Caquetá (von Mocoa) der Fluß sei, welcher im Amazonenstrom den Namen Japurá führt; er hat hingegen nicht nur Sansons Hypothese angenommen, sondern die Zahl der Gabelteilungen des Caquetá vollends verdreifacht. Durch eine erste sendet der Caquetá einen Arm (den Jaoya) dem Putumayo zu; eine zweite bildet den Japurá und den Río Paragua; durch eine dritte teilt sich der Río Paragua in zwei Ströme, den Orinoco und den Río Negro. Dieses imaginäre System findet sich in der ersten Ausgabe von d’Anvilles schöner Karte von Amerika dargestellt. Es erhellt daraus, daß der Río Negro sich vom Orinoco unterhalb der großen Katarakte trennt und daß man, um zur Mündung des Guaviare zu gelangen, den Caquetá oberhalb der Gabelteilung, die dem Río Japurá seinen Ursprung gibt, hinauffahren muß. Als Herr de La Condamine erkannte, daß die Quellen des Orinoco sich keineswegs am Fuß der Anden von Pasto befinden, sondern daß der Strom von der Rückseite der Berge von Cayenne herkomme, änderte er seine Meinung auf eine sehr sinnvolle Weise. Der Río Negro entspringt nun nicht mehr aus dem Orinoco; der Guaviare, der Atabapo, der Casiquiare und die Mündung des Inírida (unter dem Namen Iniricha) erhalten auf d’Anvilles zweiter Karte ungefähr ihre richtigen Stellungen; aus der dritten Gabelteilung des Caquetá aber entspringen der Inírida und der Río Negro. Dieses System wurde von Pater Caulin verteidigt, auf der Karte von La Cruz abgebildet und auf allen bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts erschienenen Karten wiederholt. Die Namen Caquetá, Orinoco und Inírida können freilich die Teilnahme und die geschichtlichen Erinnerungen nicht wecken, welche mit den Strömen des Inneren von Nigritien verknüpft sind; aber die verschiedenen Mutmaßungen der Geographen des Neuen Kontinents erinnern an die seltsamen Darstellungen des Niger, des Weißen Nil, des Gambaro, des Joliba und des Zaire. Von Jahr zu Jahr wird das Gebiet der Hypothesen enger beschränkt; die Aufgaben sind genauer bestimmt, und dieser ältere Teil der Geographie, welcher der spekulative, um nicht zu sagen divinatorische heißen könnte, findet sich in engerem Raum eingegrenzt.
Also nicht an den Ufern des Caquetá, sondern an denen des Guainía oder des Río Negro mag man richtige Angaben über die Quellen des letzteren Stromes erhalten. Die in den Missionen von Maroa, Tomo und San Carlos wohnenden Indianer wissen nichts von einer höher gelegenen Vereinigung des Guainía mit dem Japurá. Ich habe seine Breite dem Fortín von San Agustín gegenüber gemessen, und sie betrug 292 Toisen; die mittlere Breite nahe bei Maroa beträgt 200 bis 250 Toisen. Herr de La Condamine schätzt sie nahe an der Mündung in den Amazonenstrom, an der schmalsten Stelle, auf 1200 Toisen, ein Zuwachs von 1000 Toisen auf 10° Länge des Flusses in gerader Entwicklung. Trotz der noch ziemlich beträchtlichen Wassermasse, die wir zwischen Maroa und San Carlos gefunden haben, versichern die Indianer, der Guainía nehme seinen Ursprung fünf Flußfahrttagereisen ostnordwestlich von der Mündung des Pimichín, in einem Gebirgsland, worin sich die Quellen des Inírida befänden. Da man in 10 bis 11 Tagen den Casiquiare von San Carlos bis zur Stelle der Gabelteilung hinauffährt, lassen sich fünf Tagereisen annehmen für die Auffahrt einer viel weniger schnellen Strömung auf etwas mehr als 1° 20′ direkter Entfernung; demnach würden die Quellen des Guainía zufolge den Längenbeobachtungen, die ich in Javita und San Carlos gemacht habe, 71° 35′ westlich vom Meridian der Pariser Sternwarte zu liegen kommen. Trotz der völlig übereinstimmenden Zeugnisse der Eingeborenen meine ich, diese Quellen müßten noch westlicher liegen, da die Kanus nicht weiter hinauffahren können, als das Flußbett gestattet. Man muß sich vor allzu bestimmten, durch die Analogie der europäischen Flüsse geleiteten Aussagen über die Verhältnisse zwischen Breite und Länge des Oberteils der Ströme in acht nehmen. In Amerika erhalten die Flüsse nicht selten bei nur geringer Erweiterung einen außerordentlich großen Zuwachs des Volumens ihrer Wassermasse.
Was den Guainía im Oberlauf besonders auszeichnet, ist der Mangel an Krümmungen: Er stellt sich als ein breiter, in gerader Linie durch eine dichte Waldung ziehender Strom dar; sooft er seine Richtung ändert, bietet er dem Auge Aussichten von gleicher Länge. Die Ufer sind hoch, aber eben und selten felsig. Der von ungemein starken weißen Quarzadern durchzogene Granit tritt meist nur in der Mitte des Flußbetts zutage. Bei der nordwestlichen Auffahrt des Guainía wird die Strömung mit jedem Tag schneller. Die Flußgestade sind öde, und erst gegen die Quellen (las cavezeras) hin wird das Bergland von Manivas- und Poignaves-Indianern bewohnt. Die Quellen des Inírida (Iniricha) sind, wie mir die Eingeborenen sagten, nur 2 bis 3 lieues von denen des Guainía entfernt. Man könnte dort eine Portage einrichten. Pater Caulin hat in Cabruta aus dem Munde eines Indianerhäuptlings, welcher Tapo hieß, vernommen, daß der Inírida sich dem Patavita (Paddavida, der Karte von La Cruz), welcher ein Zufluß des Río Negro ist, stark nähert. Die Einwohner der Ufer des oberen Guainía kennen weder diesen Namen noch den eines Sees (Laguna del Río Negro), welcher auf alten portugiesischen Karten vorkommt. Dieser angebliche Río Patavita ist wahrscheinlich nichts anderes als der Guainía der Indianer von Maroa; denn solange die Geographen an die Gabelteilung des Caquetá glaubten, ließen sie den Río Negro aus diesem Arm und aus einem Fluß entspringen, welchen sie Patavita nannten. Den Angaben der Einwohner zufolge sind die Berge an den Quellen des Inírida und des Guainía nicht höher als der Baraguán, dessen Höhe meiner Messung nach 120 Toisen beträgt.
Handschriftliche portugiesische Karten, die neuerlich vom Hydrographischen Depot von Río de Janeiro verfertigt worden sind, bestätigen die Vorstellungen, welche ich mir an Ort und Stelle gebildet habe. Sie bezeichnen keine der vier Verbindungen des Caquetá oder Japurá mit dem Guainía (Río Negro), Inírida, Uaupés (Guapue) und Putuamayo; sie stellen jeden dieser Zuflüsse als einen unabhängigen Strom dar, und die Quellen des Guainía sind nur zu 2° 15′ westlich vom Meridian von Javita angegeben. Der Río Uaupés, einer der Zuflüsse des Guainía, scheint seinen Lauf viel weiter westlich auszudehnen als der Guainía selbst, und seine Richtung ist so beschaffen, daß kein Arm des Caquetá, ohne ihn zu durchschneiden, den oberen Guainía erreichen könnte. Ich will am Schluß dieser Erörterung noch einen unmittelbaren Beweis aufführen, welcher die Behauptung derer widerlegt, die den Guainía wie den Guaviare und den Caquetá am östlichen Abhang der Anden entspringen lassen. Während meines Aufenthalts in Popayán erhielt ich vom guardián des Franziskanerklosters, Fray Francisco Pugnet, einem liebenswürdigen und verständigen Mann, sehr zuverlässige Nachrichten über die Missionen der Andaquies, worin er sich lange aufgehalten hatte. Dieser Pater hat eine beschwerliche Reise von den Gestaden des Caquetá an die des Guaviare unternommen. Seit Philipp von Hutten (Urre) und den ersten Zeiten der Eroberung hatte kein Europäer diese unbekannte Landschaft besucht. Aus der Mission von Caguán, die am Río Caguán, einem der Zuflüsse des Caquetá, liegt, nahm der Pater Pugnet seinen Weg durch eine unermeßliche, völlig baumlose Savanne, deren östlicher Teil von Tama- und Coreguaje-Indianern bewohnt wird. Nach sechs Tagereisen in nördlicher Richtung gelangte er an einen kleinen Ort, welcher Aramo heißt, an den Ufern des Guayavero, etwa 15 lieues westlich von der Stelle, wo der Guayaveo und der Ariari den großen Río Guaviare bilden. Aramo ist das westlichste Dorf der Missionen von San Juan de los Llanos. Der Pater Pugnet hörte dort von den großen Katarakten des Río Guaviare sprechen (von denjenigen ohne Zweifel, welche der Vorsteher der Missionen des Orinoco, als er von San Fernando de Atabapo den Guaviare hinauffuhr, besucht hatte); aber er mußte, um von Gaguán nach Aramo zu kommen, über keinen Fluß setzen. Zweifellos sind unter 75° Länge auf 40 lieues Entfernung vom Cordilleren-Abhang mitten in den Llanos weder der Río Negro (Patavita, Guainía) noch der Guapue (Uaupé), noch der Inírida zu finden; die drei Ströme entspringen ostwärts von diesem Meridian. Diese Angaben sind äußerst wichtig; die Geographie des inneren Afrika ist nicht verworrener als die der Landschaft zwischen dem Atabapo und den Quellen des Meta, des Guaviare und des Caquetá. „Man begreift kaum, wie es möglich ist“, sagt Herr Caldas in einer in Santa Fé de Bogotá erscheinenden wissenschaftlichen Zeitschrift, „daß wir keine Karte von den Ebenen besitzen, die am östlichen Abhang der Berge anfangen, welche uns täglich vor Augen liegen und auf denen die Kapellen von Guadalupe und Montserrat erbaut sind. Niemand kennt weder die Breite der Cordilleren noch den Lauf der sich in den Orinoco und in den Amazonenstrom ergießenden Gewässer, und doch werden in glücklicheren Zeiten einst über eben diese Ströme, den Meta, den Guaviare, den Río Negro und den Caquetá, die Bewohner von Cundinamarca mit denen von Brasilien und Paraguay verkehren.“
Ich weiß wohl, daß in den Missionen der Andaquies ziemlich allgemein verbreiteter Glaube ist, der Caquetá gebe zwischen den Mündungen des Río de la Fragua und des Caguán dem Putumayo einen Arm ab, und weiter hinab, unterhalb der Mündung des Río Payoya, gehe ein zweiter Arm von ihm aus zum Orinoco; doch diese Meinung beruht nur auf einer schwankenden Überlieferung der Indianer, welche nicht selten die Portagen mit den Gabelteilungen verwechseln. Die Katarakte an der Mündung des Payoya und die Grausamkeit der Huaques-Indianer, die auch „Murciélagos“ (Fledermäuse) heißen, weil sie den Gefangenen das Blut aussaugen, halten die spanischen Missionare ab, den Caquetá hinunterzufahren. Kein Weißer hat je den Weg von San Miguel de Mocoa an den Zusammenfluß des Caquetá mit dem Amazonenstrom unternommen. Die portugiesischen Astronomen sind zur Zeit der ersten Grenzkommission anfänglich den Caquetá hinaufgefahren bis 0° 36′ südlicher Breite, nachher den Río de los Engaños (den „trügerischen Strom“) und den Río Cunare, welche Zuflüsse des Caquetá sind, bis zu 0° 28′ nördlicher Breite. Auf dieser Flußfahrt haben sie keinen Arm des Caquetá nordwärts austreten sehen. Der Amu und der Yabilla, deren Quellen sie genau untersucht haben, sind kleine Flüsse, die sich in den Río de los Engaños und, mit ihm vereint, in den Caquetá ergießen. Die Gabelteilung, sofern es eine solche gibt, könnte demnach nur in dem sehr kurzen Raum zwischen dem Zufluß des Payoya und dem zweiten Katarakt, oberhalb der Mündung des „trügerischen Stromes“ gesucht werden; ich wiederhole aber, daß der Lauf dieses Flusses sowie der des Cunare, des Apoporis und des Uaupés verhindern würden, diesen angeblichen Arm des Caquetá in den oberen Guainia zu erreichen. Alles scheint das Dasein einer Schwelle, einer Erhöhung von Gegenhängen [das heißt einer Wasserscheide] zwischen den Zuflüssen des Caquetá und denen des Uaupés und des Río Negro anzudeuten. Mehr noch: Wir haben mittels der Höhe des Quecksilbers im Barometer die absolute Erhöhung des Bodens über den Gestaden des Pimichin zu 130 Toisen gefunden. Vorausgesetzt, daß das Bergland in der Nähe der Quellen des Guainia 50 Toisen höher ist als der Boden von Javita, so folgt daraus, daß das Flußbett in seinem oberen Teil wenigstens 200 Toisen über der Meeresfläche liegt; eine Höhe, die das Barometer uns nicht beträchtlicher angegeben hat für die Ufer des Amazonenstroms nahe Tomependa in der Provinz Jaén de Bracamoros. Bedenkt man nun den schnellen Fall dieses unermeßlichen Flusses von Tomependa bis zum Meridian von 75°, erinnert man sich der Entfernung der Missionen am Río Caguán von der Cordillere, so steht es außer Zweifel, daß das Bett des Caquetá unterhalb der Mündungen des Caguán und des Payoya nicht viel niedriger sein könne als das des oberen Guainia, dem es einen Teil seiner Gewässer abgeben muß. Dazu kommt, daß das Wasser des Caquetá völlig weiß, das des Guainia hingegen schwarz oder kaffeebraun ist. Das Schwarzwerden eines zuvor weißen Stroms ist aber ohne Beispiel. Der obere Guainia kann also kein Arm des Caquetá sein. Ich zweifle selbst, ob mit Grund angenommen werden könne, daß der Guainia als unabhängiger Hauptsammler südwärts auch nur einiges Wasser durch eine Seitenverästelung empfange.
Die kleine Berggruppe, die wir bei den Quellen des Guainia kennenzulernen Gelegenheit hatten, ist um so merkwürdiger, als sie in der südwestlich vom Orinoco sich ausdehnenden Ebene vereinzelt steht. Ihre Lage, der Länge zufolge, könnte glauben lassen, sie dehne sich in einem Kamm aus, welcher anfangs den Engpaß (angostura) des Guaviare und danach die großen Katarakte (saltos, cachoeiras) des Uaupés und des Japurá bilde. Sollte dieser Boden, der wahrscheinlich gleich dem mehr östlich von mir untersuchten aus Urgestein besteht, zerstreutes Gold enthalten? Sollten sich weiter südlich, gegen den Uaupés hin, am Iquiare (Iguiari, Iguari) und am Yurubesh (Yurubach, Urubaxi) Goldwäschen befinden? Hier hatte Philipp von Hutten zuerst das Dorado gesucht und mit einer Handvoll Menschen das im 16. Jahrhundert so berühmte Treffen mit den Omagua geliefert. Wenn von den Erzählungen der conquistadores die fabelhafte Ausschmückung getrennt wird, mag allerdings in den unverändert erhaltenen Ortsnamen eine Grundlage historischer Wahrheit erkannt werden. Man folgt dem Zug Huttens über den Guaviare und den Caquetá; in den durch den Kaziken von Macatoa beherrschten Guaypés finden sich die Anwohner des Uaupés, der auch die Namen Guape oder Guapue führt; man erinnert sich, daß der Pater Acuña den Iquiari (Quiguiare) einen Goldstrom nennt und daß fünfzig Jahre später der Pater Fritz, ein sehr glaubwürdiger Missionar, in seiner Mission von Yurimaguas den Besuch der mit Blechen aus geschlagenem Gold geschmückten Manaos (Manoas) empfing, welche von der zwischen dem Uaupés und dem Caquetá oder Japurá gelegenen Landschaft herkamen. Die auf dem östlichen Abhang der Anden entspringenden Flüsse (der Napo zum Beispiel) führen viel Gold, wenn auch ihre Quellen im Trachyt-Boden liegen. Warum sollte auf der Ostseite der Cordilleren kein goldhaltiger Anschwemmungsboden vorhanden sein wie westwärts in Sonora, in Choco und in Barbacoas? Weit entfernt, die Reichtümer dieser Landschaft übertreiben zu wollen, kann ich mich jedoch auch nicht für befugt halten, das Vorkommen edler Metalle in den Vorgebirgen von Guayana nur zu leugnen, weil wir auf unserer Reise durch dieses Land keinen Erzgang gesehen haben. Es ist allerdings bemerkenswert, daß die Eingeborenen am Orinoco in ihren Sprachen einen Namen zur Bezeichnung des Goldes haben (carucuru in der Cariben-, caricuri in der Tamanaken- und cavitta in der Maipures-Sprache), wogegen das Wort, dessen sie sich für die Bezeichnung des Silbers bedienen, prata, offenbar aus dem Spanischen entlehnt ist. Die von Acuña, dem Pater Fritz und La Condamine gesammelten Nachrichten über die süd- und nördlich vom Río Uaupés befindlichen Goldwäschen treffen zusammen mit dem, was auch mir über das goldhaltige Terrain dieser Landschaft zu Ohren gekommen ist. Wie bedeutend immerhin die Verbindungen der Völker am Orinoco vor der Ankunft der Europäer gewesen sein mögen, so haben sie doch zuverlässig ihr Gold nicht vom östlichen Abhang der Cordilleren erhalten. Dieser Abhang besitzt nur wenige, besonders in früherer Zeit bearbeitete Erzgruben; er besteht in den Provinzen von Popayán, Pasto und Quito fast nur aus vulkanischen Gebirgsarten. Wahrscheinlich ist das Gold von Guayana aus dem Land ostwärts der Anden gekommen. Noch zu unserer Zeit wurde ein Goldgeschiebe in einer Schlucht unfern von der Mission Encaramada gefunden, und man darf sich nicht wundern, daß von der Zeit der Ansiedlung der Europäer in diesen wilden Gegenden an weniger von Goldblechen, Goldstaub und Jadeamuletten die Rede gewesen ist, welche vormals von den Cariben und einigen anderen umherziehenden Völkern eingetauscht werden konnten. Die edlen Metalle sind an den Ufern des Orinoco, des Río Negro und des Amazonenstroms nie in großer Menge vorhanden gewesen. Sie verschwanden fast gänzlich, sobald das Regiment der Missionen den entfernteren Verbindungen zwischen den Eingeborenen ein Ende setzte.