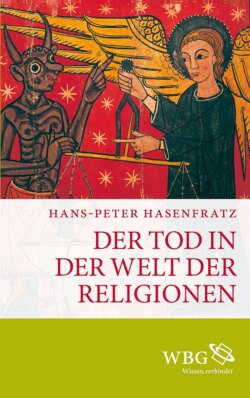Читать книгу Der Tod in der Welt der Religionen - Hans-Peter Hasenfratz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A. Der selige Tod
ОглавлениеWer in Frieden mit der Gemeinschaft, der er angehört, stirbt und von ihr rite bestattet wird, ist ein ‘seliger Toter’. Er ‘lebt’ als solcher im Schoße der Gemeinschaft (aus Lebenden und Toten) weiter, wird von ihr erinnert (‘Totengedenken’), mit Nötigem versorgt (‘Totenspeisung’), besucht sie gelegentlich, besonders im dunklen Winterhalbjahr (‘Totenbesuchsfeste’), wirkt in seinem ‘anderweltlichen’ Zustand für ihr Gedeihen. ‘Im Frieden mit der Gemeinschaft’ bedeutet: in Übereinstimmung mit der in ihr geltenden Norm, was gelegentlich durch eine ritualisierte Totenbefragung vor dem Begräbnis zu vergewissern gesucht wird (siehe I. 2.). Am sichersten sind die im Zusammenhang mit einem Tod gültigen Normen an ihrem Gegenteil zu ermitteln: beim normenwidrigen, ‘unseligen Tod’ (siehe B., auch C.). Hierbei ist jederzeit das Reziprozitätsverhältnis zu beachten. Ein seliger Toter wird ein unseliger, fällt aus der Norm und wendet sich feindlich gegen seine Gemeinschaft, wenn sie das Totenritual nicht korrekt einhält (z. B. nicht ordentlich bestattet) oder die Totenpflege vernachlässigt (z. B. mit Totenopfern knausert, die Gastfreundschaft bei Totenbesuchsfesten verletzt). Da ist dann rasche Wiedergutmachung angesagt, wenn der Gemeinschaft nicht irreversibler Schaden durch den nun a-kosmischen (dem kosmischen Normenbereich der Gemeinschaft ‘entfremdeten’ und schädigenden) Toten entstehen soll. Der in Frieden mit der Gemeinschaft Verstorbene sucht die Gemeinschaft: die ‘Schicksalsgemeinschaft’ mit denjenigen, die er liebt und in sein Totendasein nachziehen möchte. Das kann und muss man verhindern, indem man etwa der Leiche die Augen zudrückt oder mit einer Binde bedeckt oder überhaupt vermeidet, ihr ins Gesichtsfeld zu kommen: Sie könnte sich das Erblickte ‘ausersehen’ und ‘nachholen’ (die Ehefrau, das Kind). War der Verstorbene unverheiratet, starb also ‘unzeitig’ und war deshalb im Begriff, ein ‘Unseliger’ zu werden, veranstaltete man eine ‘Totenhochzeit’: Man verheiratete den Toten pro forma mit einem lebenden Mitglied der Gemeinschaft, die weibliche Leiche kleidete man bräutlich ein oder legte ihr eine Puppe mit ins Grab. Der Tote als Mitglied der Gemeinschaft wollte von ihr auch ordentlich verabschiedet werden, entweder im Beisein der Leiche oder nach deren Bestattung. Die Feier konnte oder sollte orgiastische Züge annehmen (was sonst verboten war, ist jetzt erlaubt); Besäufnisse bis zur Bewusstlosigkeit und entfesselte Tänze gehörten dazu. Orgie und ‘Komasaufen’ können als Solidaritätsrituale verstanden werden: Auf bestimmte Zeit und rituell kontrolliert wird die ‘Anderwelt’ (als ‘verkehrte Welt’: III. B. 2.) und der Totenzustand (Totalrausch!) inszeniert. Der Tanz als extreme Vitalitätsentfaltung führt dem Devitalisierten (Toten) als Rekreativritual Lebensimpulse zu, die er für sein nachtodliches Leben benötigt. In dieselbe Kategorie gehören Leichenspiele, die sich in Rom als Zirkusspiele von ihrem ursprünglichen ‘Sitz im Leben’, dem Totenkult, gelöst haben und zur blutigen Volksbelustigung pervertierten.5 In unseren ‘Leidmahlen’, bei denen es oft noch sehr ‘lebhaft’ zuzugehen pflegt, erleben wir die domestizierte Form dieser Abschiedsfeierlichkeiten. Gottfried Keller schildert in seinem Grünen Heinrich ein Leichenmahl im vorletzten Jahrhundert, in dem noch Elemente der zeremoniellen Abschiedsfeier zu erkennen sind: reichlich Wein, Musik, ausgelassene Tanzerei der Jugend. Das Totengeleit zur Begräbnisstätte ist ehrenvolle Prozession und Veranstaltung, dem geleiteten Toten eine von der Gemeinschaft unkontrollierte Rückkehr zur Stätte der Lebenden zu ‘verbauen’. Wie das? Man schlägt eine Bresche in die Wand des Trauerhauses, die man gleich wieder vermauert, nachdem der Leichnam durch sie hinausgeschafft worden ist. Denn es ist „ein Gesetz der Teufel und Gespenster“ (wie Goethe in Faust I weiß), somit auch der Toten, an den einmal benützen Weg gebunden zu sein. Ob die Leiche mit den Füßen oder mit dem Kopf voraus weggetragen werden soll, wenn man die normale Tür benutzt, wird rituell kontrovers gehandhabt. Beide Varianten ‘machen Sinn’. Nach der einen kann der Tote nicht mehr zu seinem Haus zurückblicken und deshalb nicht mehr ungerufen zurückkehren, nach der anderen (‘ärschlichen’) blickt er gerade nochmals zurück und wird deshalb nicht mehr vom Heimweh zurückgetrieben. Die Grabstatt beschwert man mit Steinen (Grabstein!), umhegt sie mit Dornen und Giftpflanzen (Rosen, Taxus), ummauert sie (Friedhof!), erschwert ihr Verlassen durch die Friedhofstür mit der ‘Gätteri’, einem Beinbrecher, der dem Bergwanderer auch zur Sicherung von Viehweiden bekannt sein dürfte. Im einen Fall verhindert die mit einem weitmaschigen Gitter bedeckte Grube Streunen von Toten, im anderen von Kühen. Die Besuche der seligen Toten bei den Lebenden sind rituell limitiert: Das Leben soll durch ihren Besuch befördert, nicht gestört werden. Die dunkle Jahreshälfte, das Winterhalbjahr, ist die adäquate Zeit der Totenbesuchsfeste. Die Toten werden zeremoniell zu einer bestimmten und für eine bestimmte Zeit (heute Allerseelen, Weihnachten, Fastnacht) eingeladen, besuchen ihre Familien zu Hause und werden an ihren Gräbern aufgesucht, werden bewirtet und beschenken dafür die Lebenden mit Fruchtbarkeit von Mensch, Vieh, Acker (die Kinder mit Naschereien und Spielzeug); zum Schluss lädt man sie förmlich wieder aus („manes exite paterni!“, neunmal zu sprechen6). „Wessen Name ausgesprochen wird, der lebt“, lautet ein altägyptisches Sprichwort (seit dem Neuen Reich wörtlich belegt, der Gedanke ist jedoch viel älter). Da der Name eine ‘Außenseele’ des Menschen ist (III. A. 2., Abs. 4), bedeutet sein Erinnern Leben des ganzen Menschen, sein Kennen die Möglichkeit, den ganzen Menschen zauberisch zu manipulieren (‘Rumpelstilzchen-Effekt’): Fällt bei der gemeinsamen Mahlzeit (oder jeder anderen Gelegenheit) der Name des verstorbenen Familienangehörigen, so hat man ihn mit dabei. Umgekehrt bewirkt die römische damnatio memoriae, die ‘Vernichtung des Gedächtnisses’ (eines Toten), die strafweise Austilgung des Unerwünschten selbst aus der Gemeinschaft für immer. Die katholischen ‘Seelämter’ am 7., 30. des Monats sowie am Jahrestag gelten dem Gedächtnis des Verstorbenen, damit seinem Seelenheil, dem Heil der ganzen Persönlichkeit. Auf der Rückseite eines Abreißkalenderblattes zum 1. Juni 2008 lese ich: „La mort n’est pas la dernière fin, il nous reste encore à mourir chez les autres.“ Wie wahr: Der Tod ist nicht das letzte Ende, wir müssen auch im Gedächtnis der Nachwelt sterben! Das Gesetz der Reziprozität (s. o.) läuft auch in umgekehrter Richtung: Wird ein Ahn regelgemäß beopfert und hilft er seinen Hinterbliebenen trotzdem nicht, so stellt man die Opfer ein, erinnert sich seiner nicht mehr, lässt ihn dadurch aus der Ordnungswelt ans akosmische, unselige Nichtsein verfallen. Ungeachtet seines seligen Todes wird er durch sein gemeinschaftswidriges nachtodliches Verhalten ein unseliger Toter. Bevor man ihn vergisst, beschimpft man ihn: „Du bist kein Ahn, du bist nur ein Totengespenst!“7
Wie fein austariert die Ökonomie der Emotionen im Verkehr zwischen Lebenden und Toten ist, zeigt andererseits, dass ein Zuviel an Erinnern beide Teile beschwert: Unkontrollierte Trauer (‘Nachweinen’) bindet das Leben emotional allzu sehr an die Toten und wirkt lebenshemmend; die Toten lässt sie im Grab keine Ruhe finden, nicht ins Jenseits gelangen oder treibt sie von dort zurück ins Dasein (zum tödlichen Schaden der nachweinenden Lebenden). Märchen, Folklore, religiöse Überlieferung und Dichter verschiedenster Kulturen wissen darum, so z. B. Das Totenhemdchen der Brüder Grimm oder die zoroastrische Jenseitsvision eines Arda Viraz (erhalten in einer Pahlavi-Version): Er erblickt im Jenseits einen Strom, den die Seelen der Verstorbenen überqueren müssen, aber nicht können, wenn um sie im Diesseits „viel Jammern und Klagen und Weinen gemacht“ wurde.