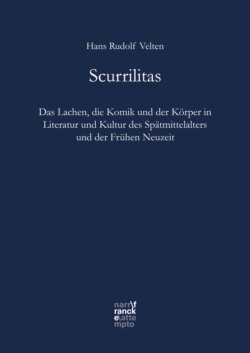Читать книгу Scurrilitas - Hans Rudolf Velten - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3. Die Gefahr des Lachens und die Macht des Diskurses im Mittelalter
ОглавлениеThomas steht mit seiner Rehabilitation des Berufsstands der Schauspieler und Fahrenden in der Summa Theologica am Ende einer langen Periode der Diffamation und am Beginn eines allmählichen Diskurswandels zum Lachen und seiner gesellschaftlichen Funktion. Davon sind auch die mimi, histriones und scurrae betroffen, deren Aufführungen, wie wir gesehen haben, sich in den Verurteilungen der Kleriker nicht vom Lachen trennen lassen. Allerdings ist die Frage noch offen, auf welche Weise diese Körperkünstler Lachen ausgelöst haben, und was sich darüber in den klerikalen Quellen finden lässt. Über den Berufsstand, die Tätigkeiten und die Wirkungen von professionellen Unterhaltern im Mittelalter besitzen wir nicht sehr viele Informationen. Der Großteil davon stammt aus klerikalen Schriften, deren Urteile jedoch durchgängig stark moralisch gefärbt und abwertend sind; doch auch innerhalb des lateinischen Überlieferungsbereichs nehmen die professionellen Unterhalter eine marginale Position ein, vergleichbar ihrer Stellung in der mittelalterlichen Gesellschaft. Für die Kirche existierten sie nicht als Menschen oder als Berufsgruppe (etwa bei seelsorgerischen Themen), sondern fast ausschließlich als negatives Zerrbild christlichen Verhaltens.
Daher ist es geboten, die Quellen mit äußerster Vorsicht auszuwerten. Auf keinen Fall sollte der Fehler der älteren Forschung gemacht werden, die negativen Werturteile über die Unterhalter in den Quellen zu übernehmen.1 Sie sind vielmehr Teil eines klerikalen Diskurses, der in sich durchaus differenzierbar und trotz seiner Dominanz in der mittelalterlichen Kultur nicht allein bestimmend war. Der höfisch-literarische Diskurs über performer etwa folgt anderen Regeln und grenzt die Gültigkeit der christlich-klerikalen Sichtweise ein. Er ist in literarischen Quellen recht gut fassbar: in zahlreichen Texten erkannte die höfische Welt, die sich zumindest seit dem 12. Jahrhundert selbst im Fest und als Festgesellschaft präsentierte, die Spielleute als wichtigen Teil der Erzeugung höfischer Freude an. Ihre Vorführungen erregten Staunen, Bewunderung und Freude, häufig wird die Kunst von Musikern, Sängern, Akrobaten und Spaßmachern gelobt.2
Hinter die Diskurse auf den „Sitz des Lebens“ der Spielleute zu blicken, ist nicht Gegenstand dieser Überlegungen. Vielmehr interessieren die Aus- und Einschließungen, die Differenzierungen und die emotionale Appellstruktur dieser Diskurse. Was die Diskursgeschichte leistet, ist die Möglichkeit der Freilegung der kommunikativen Selbstverständigung einer Gesellschaft und Kultur in einer bestimmten historischen Epoche. Daher ist es auch unwichtig für eine Begriffsgeschichte körperlicher Lachanlässe, ob diese tatsächlich obszön waren oder nicht. Bedeutsamer ist vielmehr die Frage: woher kommt die Negativität der Beschreibungen, welche Begriffe werden dafür verwendet und wozu dienen sie? Noch heute, im 21. Jahrhundert wissen wir, dass nach außen hin geschlossene religiöse Systeme wie etwa der Islam dazu tendieren, moralische Ansprüche auf Bild- und Wortikonen zu projizieren, und zwar gerade in Fragen der Satire und des Lachens. Wie der islamische Fundamentalismus war auch das christliche Mittelalter kaum zu Selbstreflexion fähig. Gerade deshalb sind die wütenden Diskurse über Handlungen und Reden der Unterhalter so interessant: nicht weil sie eine Wahrheit sagen, sondern weil sie die Verletzung und die Wut ihrer Urheber deutlich machen, und somit auf die Wucht von Provokationen verweisen. Ich möchte im Folgenden den Diskurs über performer aus theologisch-klerikaler Perspektive zusammenfassen, „hinter seine Kulissen“ blicken und daran meine begriffsgeschichtlichen Thesen zum Lachen überprüfen.
Die Beschreibungen der performer in den christlich-klerikalen Quellen sind eher flüchtig, skizzenhaft und repetitiv.3 Die Kommentare sind meist diffamierend; sie unterstreichen und wiederholen die Unbestimmtheit und die Unordnung der Rollen der Fahrenden. Für die Beschreibung der performer bevorzugen sie polyseme und generalisierende Begriffe wie ioculator und histrio. Die Kleriker geben sich keine Mühe, die Fähigkeiten und professionellen Handlungen der performer zu beschreiben, auch ihr Seelenheil interessiert sie nicht.4 Sie werden generalisierend als Schausteller präsentiert, als vagantes, die ihren nackten bzw. deformierten Körper auf irgendeine Weise in Szene setzen. Am deutlichsten ist das bei Akrobaten, Seiltänzern, Tänzern und Possenreißern, aber auch bei Musikern und Erzählern der Fall, sowie bei solchen, die mit Tieren arbeiten.
Für die Kleriker ging es niemals darum, die performer vom Glauben zu überzeugen. Dies war nicht nötig, denn sie gehörten nicht zur Gemeinschaft der Gläubigen. Der Vorwurf der sozialen Nutzlosigkeit genügte, um ihren Ausschluss aus den menschlichen Gemeinschaften zu rechtfertigen.5 In der Gesellschaft der Bauern, Krieger und Kleriker, in welcher jedes Mitglied einen bestimmten Nutzen hatte, galten die performer als nutzlos, da sie nur zur Befriedigung verbotener, sündhafter Bedürfnisse beitrugen (gula, luxuria, gesticulatio). Es gibt zum Beispiel in den Predigthandbüchern des 12. und 13. Jahrhunderts keine Predigten, die sich an Jongleure oder Fahrende wenden würden, um deren Seelenheil zu retten; immerhin wurde dies anderen Randgruppen nicht verwehrt, wie den Armen, den Kranken, den Pilgern, den armen Handwerkern und selbst den Prostituierten.
Die Adressaten der klerikalen Warnungen und Drohungen sind daher keineswegs die Fahrenden, sondern die Kleriker selbst, und unter ihnen vor allem die Mönche. Sie verkörpern das Idealbild des Christen und dieses Bild muss geschützt werden.6 Daher sind die meisten Hinweise auf sie als didaktische Handlungsanweisungen, Verhaltensregeln und Vorschriften für Kleriker zu lesen. Der histrio diente als Negativfolie für das richtige Verhalten des Mönches oder Priesters, als sein Gegen- und Zerrbild. Der kontinuierliche, implizite Vergleich zum Spielmann erlaubt eine minutiöse Elaboration der Regeln, die das Leben der Kleriker bestimmen. Je stärker der Gaukler – häufig dem Teuflischen zugesellt – mit Epitheta wie turpis, obscoenus usw. bedacht wird, desto leichter kann sein Gegenbild würdig, ehrlich und heilig sein. Der Gaukler selbst aber bleibt abwesend, er wird in den klerikalen Diskurs nur aufgenommen, um den Wert des Sakralen zu bestätigen.7
Allerdings dürfen diese Überlagerungen spätantiker Begriffe und mittelalterlicher Phänomene nicht zu dem Schluss führen, es habe die Verletzung von Schamschwellen durch die Aufführung obszöner Gesten und Handlungen, durch Nachahmung und Parodie, sowie durch transgressive und verhöhnende Reden nicht gegeben. Von einem relativ normkonformen Verhalten der Spielleute spricht indirekt Bumke, wenn er einen Passus des Albertus Magnus über die „nackten Schauspieler“ als Topos der Theaterkritik auffasst und nicht als Beobachtung der phänomenalen Gegenwart.8 Nacktheit und das Zeigen von Geschlechtsteilen gehörten nicht nur zu rituellen und fastnächtlichen Praktiken, sondern auch zum Repertoire bestimmter Körperkünstler unter den Spielleuten.
Zurück zur Begriffsgeschichte: Die lateinischen Begriffe histrio, mimus, scurra usw., die aus der Spätantike stammen und über die Schriften der Kirchenväter ins Mittelalter gekommen sind, werden auf Tätigkeiten und Berufe übertragen, die mit ihrer ursprünglichen Bedeutung nur noch wenig zu tun hatten. Es gab keinen römischen Mimus im Mittelalter, und auch keinen römischen histrio: es gab Unterhalter und Schauspieler, die vielleicht von diesen Berufen abstammten, aber andere Aufführungsformen, andere Repertoires, andere Kombinationen mit anderen Künstlern und andere Tätigkeitsfelder hatten. Doch welches war dann die Funktion der Übertragung spätantiker Begriffe auf zeitgenössische Unterhalter?