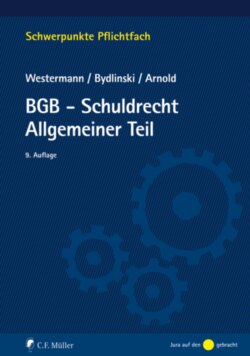Читать книгу BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil - Harm Peter Westermann - Страница 243
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Durchsetzbarkeit und Fälligkeit des Gegenanspruchs
Оглавление352
Das Zurückbehaltungsrecht erfüllt bei nicht gleichartigen Ansprüchen eine ähnliche Funktion wie die Aufrechnung. Das Zurückbehaltungsrecht bietet bei ihnen einen einfachen und kostengünstigen Weg, die eigene Forderung durchzusetzen. Dementsprechend muss der Gegenanspruch, auf den das Zurückbehaltungsrecht gestützt wird, auch fällig sein. Noch nicht fällige Gegenansprüche begründen grundsätzlich kein Zurückbehaltungsrecht.[20] Wenn in dem Beispiel von oben[21] die Gewährleistungsansprüche der Deutschen Bahn AG fällig sind, nicht aber die Zahlungsansprüche der Siemens AG (weil beispielsweise vertraglich ein späterer Fälligkeitszeitpunkt vereinbart ist), kann die Siemens AG aus diesen (verhaltenen) Zahlungsansprüchen auch kein Zurückbehaltungsrecht herleiten. Eine kurze Kontrollüberlegung erhellt den Sinn dieser Voraussetzung: Die Siemens AG würde ja auch mit dem Versuch scheitern, die verhaltenen Ansprüche schon jetzt, bevor sie fällig sind, eigenständig gerichtlich durchzusetzen.
353
Es genügt allerdings, dass der Gegenanspruch mit der Erfüllung der eigenen Leistung fällig wird.[22] So liegt es beispielsweise bei § 1223 Abs. 1: Der Pfandgläubiger muss dem Verpfänder das Pfand erst nach dem Erlöschen des Pfandrechts zurückgeben. Der Anspruch des Verpfänders auf Rückgabe des Pfandes wird also beispielsweise fällig, wenn der Verpfänder die Forderung erfüllt, zu deren Sicherung das Pfand diente. Denn dann erlischt das Pfandrecht gem. § 1252. Wenn der Pfandgläubiger den Verpfänder nun wegen dieser Forderung in Anspruch nimmt, kann der Verpfänder gem. § 273 Abs. 1 die Leistung wegen seines Rückgabeanspruchs verweigern, obwohl der Rückgabeanspruch erst mit Befriedigung der Forderung fällig wird.[23]
354
Auch sonstige Einreden stehen – so wie § 390 für die Aufrechnung anordnet – der Ausübung des Zurückbehaltungsrechts entgegen. Der Anspruch muss also, wie man auch sagt, „vollwirksam“, also durchsetzbar sein. Eine wichtige Ausnahme vom Grundsatz der Durchsetzbarkeit bildet § 215: Wenn der Gegenanspruch noch nicht verjährt war, bevor der Anspruch des Gläubigers entstanden war, kann der Schuldner ein Zurückbehaltungsrecht auch auf den mittlerweile verjährten Anspruch stützen. Dabei ist nicht erforderlich, dass der Schuldner sich auch schon vor Verjährungseintritt auf § 273 berufen hat. § 215 bewirkt also, dass bei Ansprüchen, die sich zu irgendeinem Zeitpunkt wirksam gegenüberstanden, die Verjährung das Zurückbehaltungsrecht nicht hindert. Dies erklärt sich aus dem Zweck der Verjährung: Die Verjährung soll vor allem der Rechtssicherheit der Parteien dienen, nach einer gewissen Zeit nicht mehr in Anspruch genommen zu werden. Standen sich Ansprüche aber einmal wirksam gegenüber – bestand also zu diesem Zeitpunkt jeweils die Möglichkeit der Parteien aufzurechnen – so werden diese Ansprüche in ihrem Schicksal verknüpft und die Verjährung soll nicht einer Partei zu Hilfe kommen; diese Verknüpfung der Ansprüche überwiegt das Interesse des Schuldners an der Sicherheit, nicht mehr in Anspruch genommen zu werden. Dem Gläubiger wird hierdurch die Aufrechnungsmöglichkeit erhalten, sodass ihn eine drohende Verjährung nicht unter Druck setzt.[24]
In Fall 31 ist zwar der Gegenanspruch des V gem. § 195 verjährt und somit eigentlich gem. § 214 Abs. 1 nicht mehr durchsetzbar. Doch greift hier § 215, sodass V dem K den verjährten Anspruch im Rahmen des § 273 Abs. 1 entgegenhalten kann.