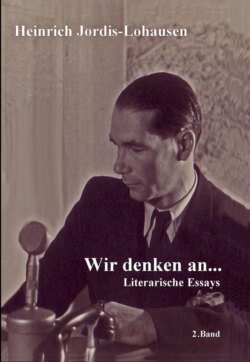Читать книгу Wir denken an ....... - Heinrich Jordis-Lohausen - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Joseph Conrad
ОглавлениеEin polnischer Edelmann, ein auf allen Meeren erfahrener Kapitän und ein englischer Schriftsteller – das ist in drei aufeinanderfolgenden Stufen die Entwicklung Joseph Conrads.
Er hieß eigentlich Joseph Conrad Korzeniowski und kam am 3. Dezember 1857 als Sohn des Apollo Nalecz Korzeniowski und der Evelina Korzeniowski, geborene Bobrowska, zu Welt.
Beide Geschlechter waren im ukrainischen Podolien ansässig. Beiden war der Kampf um die Freiheit Polens Familienüberlieferung. Conrad war erst drei Jahre alt, als seine Eltern ihn nach Wolodga in die Verbannung mitnahmen.
Im ungewohnten Sumpfklima Nordrusslands erkrankte die Mutter. Als der Vater nach langen Monaten die erbetene Versetzung nach dem Süden erhielt, war es zu spät. Todkrank schleppte sich Evelina aus ihrer Heimat noch einmal zurück zu ihrem Mann und starb. Conrad zählte damals 6 Jahre.
Aus der Verbannung entlassen, lebte Apollo Korzeniowski in mönchischer Einsamkeit allein der Abfassung von Memoiren und Übersetzungen. Später zog er krank und der Politik müde in das mildere Österreich, und starb in Krakau sechs Jahre nach seiner Frau im Jahre 1869.
Das war die Kindheit Conrads: Verbannung, Not, früher Tod der Eltern, keine Geschwister, nur die wohlmeinende Fürsorge eines Onkels; als Erholung Bücher, viel zu viel Bücher, als Hintergrund die Weite der sarmatischen Erde: die Grausamkeit Russlands, die Hoffnungslosigkeit Polens. Aber nichts, was erwarten ließ, dass ein Kind, das nie einen Tropfen Salzwasser geschmeckt hatte, mit 15 Jahren den unwiderruflichen Entschluss fassen würde, zur See zu gehen.
Zauber der Landkarte? Flucht aus der dreifach zerteilten Heimat in die unbegrenzbare Freiheit der Meere? Wir kennen den Anlass nicht, doch war er so mächtig, dass er den Widerstand aller Verwandten und alle festländischen Überlieferungen überwand. Polen war Traum. E r wollte Wirklichkeit, den Weg dazu haben nur freie Völker an freier Küste.
So verließ Conrad Krakau sechzehnjährig im Oktober 1874 mit nichts als ein paar Briefen und einer ziemlich ausreichenden Kenntnis der französischen Sprache. Er wurde in Marseille von einem Herrn empfangen, der den Jungen Edelmann verabredungsgemäß, doch nicht ohne eine gewisse Skepsis in die Welt der Hafenleute, Fischer, Lotsen und Schiffsmakler einführte. Die Abschreckung misslang. Conrad blieb.
Die ersten Reisen führten nach Westindien und Südamerika. Sie brachten, was er nur wünschen konnte: Stürme, Waffenschmuggel, die eigene Bewährung und den Geruch exotischer Länder.
Die nächsten Reisen – im Mittelmeer – abermals Waffenschmuggel. Diesmal nach dem carlistischen Spanien und damit die Gesellschaft von Menschen, die nach Conrads eigenen Worten „von nichts als ihrem Degen lebten“. Unter ihnen Dominique, ein Korse, der in manchen von Conrads Büchern wiederkehrt wie eine Gestalt aus vorgeschichtlicher Zeit; unter ihnen eine Baskin, so jung wie Conrad, so abenteuerlich wie Dominique und wahrscheinlich so sehr Frau, wie jener Mann war.
Conrad fährt im Dienst von beiden. Und eine Weile durchläuft die „Tremolino“, seine Barke, mit Erfolg alle Sperren. Dann muss sie eines Nachts nach harter Verfolgung unter Conrads eigenen Händen auf Strand gesetzt werden.
Das Schiff sinkt. Die Mannschaft rettet sich mit knapper Not. Dominique verschwindet. Ohne Mittel und überworfen mit seinen Freunden kommt Conrad zurück nach Marseille. Dort beendet ein Stich durch die Brust sein erstes Duell und das Spiel um Dominiques immer noch ungenannte Gefährtin.
Kaum geheilt und ohne Englisch zu können, lässt sich Conrad auf einem britischen Kohlendampfer anheuern, - ein halbes Jahr später auf einen Nordseesegler.
Diese Schule ist härter als die bisherige. In Marseille war er der verhätschelte Gast – „le petit ami“ – der Lotsen und Fischer, der „signorino“ des Piraten Dominique gewesen. Hier ist er nichts – ein Matrose auf Vorderdeck. Und auf seinem nächsten Schiff – einem australischen Wollklipper, ist er nicht mehr. Aber nach drei Jahren besteht Conrad vor dem Londoner Seeamt die Prüfung, die ihn berechtigt, als Offizier zu fahren.
Die nun folgenden Jahre zwischen 1880 und 1890, als Offizier zuerst, dann als Kapitän auf einem Dutzend verschiedener Segelschiffe und einigen unwillig hingenommenen Dampfern in der Südsee und im indischen Ozean, sind die Erfüllung dessen, was für ihn „Leben“ bedeutet.
Ein Punkt sein im Weltmeer, den Kampf mit allen aufnehmen – mit der See, ihren Küsten und den auf Gedeih und Verderb zusammengespannten Männern auf Deck. Dazu die Kunst, einen Segler zu führen!
Wenn irgendein Gebilde von Menschenhand den Eindruck beseelter Lebendigkeit hervorrufen kann, dann jene windbewegten Geschöpfe zwischen Wolken und Wasser. Gleich ihren Schöpfern scheinen auch sie in e i n e r Gestalt z w e i Welten anzugehören: mit ihren Kielen den Tiefen der See – den Geistern der Höhe mit dem hellen Spiel ihre Segel.
Auf monate- und jahrelangen Fahrten durch die Einsamkeiten der Ozeane werden sie ihren Matrosen Kind, Mutter, Geliebte. Und bieten, was diese zu bieten haben: Geborgenheit, Schönheit, Sorge. Ihre Bewegungen scheinen ein zärtliches Nachgeben an die Launen der Winde und doch sind sie eigenwillig und wechseln Miene und Haltung wie die Wetter, die sie berühren.
Die nüchternste Sprache der Welt, der alles Ding – Ding ist, selbst Blume und Baum, spricht von Schiffen wie von Frauen und nennt sie nicht „it“, sondern „she“ und mancher Mann ging lieber mit ihnen zugrunde, als ohne sie wiederzukehren.
Man hat einem französischen Schriftsteller (einem Zeitgenossen Conrads) nachgesagt, er könne kein Ding in der Welt, nicht einmal eine Kirche mit Liebe beschreiben, es sei denn in Gestalt einer Frau. Conrad hingegen – noch wo er ein Mädchen beschriebe – dächte dabei insgeheim an ein Schiff. Und einer, der seine Lebensgeschichte schrieb, hat Conrad einen „Tatträumer“ genannt: - „Tatträumer“ aber sind Einzelgänger.
Er hatte in Polen eine Jugendliebe gehabt, aber die war, von Anfang an zu Traum gesteigert, Traum geblieben. Als er viel später d i e traf, die mit ihm gefahren wäre, war die Zeit seines Fahrens vorbei.
Wie vielen, die über die Masse ragen, war es auch Conrad bestimmt, die großen Stunden seines Daseins stumm und für sich zu erleben. „Über sich ein Segel, um sich das Meer“.
Trotz alledem hat sich Conrad mit Macht gegen die Bezeichnung eines „dichtenden Seemanns“ verwahrt. Nackt und unsentimental fügen seine Berichte Tatsache an Tatsache. Und nur ein Bruchteil von ihnen spielt wirklich auf See.
Wollte man sie irgendwie einreihen, so noch am ehesten in das weitgespannte Gebiet des psychologischen Romans.
Was die Jahre der Seefahrt dem Schriftsteller vererbten, war weniger der Schauplatz seiner Erzählungen, als die darin entwickelte Kunst der Menschenbehandlung – und ein unnachahmliches Geschick, seine „Opfer“ an den Rand unwiderruflicher Entscheidungen zu steuern.
Denn das ist ihm S i n n unseres irdischen Daseins: vor Entscheidungen stehen. Und erst da beginnt das große Spiel um uns selbst. Erst da wird Leben wirklich Leben, wo das, was man tut oder versäumt, zu tun, ein Zurück nicht mehr zulässt.
Wir erfahren dies in manchen seiner Erzählungen, in der „Rettung“, im „Sieger“, im „Verdammten der Inseln“ – am eindrucksvollsten vielleicht in „Lord Jim“.
Doch lernen wir Jim selber nicht kennen. Wir hören nur von ihm erzählen. So wird seine Gestalt trotz eines Mosaiks von Einzelheiten zur legendären Figur, (und sprengt den Rahmen des Zufallhaften, wie er dem nur-Individuellen eigentlich zukommt.).
Er wird uns geschildert als ein blonder, schlankgewachsener, etwas hochmütiger Engländer. Weil sich gerade Besseres nicht bot, nur für diese eine Fahrt 1. Offizier auf der „Patna“, einem morschen überalteten Kasten mit einer Ladung von 800 Mekkapilgern an Bord.
Eines Nachts fährt die „Patna“ bei spiegelglatter See auf ein unsichtbares Hindernis unter Wasser, reißt sich ein Leck und ist (mangels hinreichender Schotts) binnen Minuten reif zu sinken. 800 Menschen an Bord, aber Boote kaum für ein Zehntel! Brach da eine Panik erst aus, war auch dies Zehntel unrettbar verloren. Aber nur fünf weiße Männer – die einzigen Weißen an Bord – wussten um die Gefahr: der Kapitän, die drei Maschinisten – die vier waren sich einig zu kneifen – und J i m!
Entgegen aller Erwartung – und er hatte sich dergleichen oft vorgestellt – sah er sich jäh vor die Wahl gestellt, nur entweder ruhmlos unterzugehen oder ehrlos zu fliehen – bösartig gefangen in einer Lage ohne jeden Ausweg zu befreiender Tat, führte die zu welchem Ende auch immer!
Noch 800 Andere auf diesem schlafenden Schiff würden in Kürze mit untergehen. Aber nur e r sehenden Auges. Voll Verachtung sieht er die Versuche der vier Deserteure ein Boot zur Flucht klar zu bekommen. 3
Es war ein Sturz in die Hölle und wie jeder solche – ein unwiderruflicher Sturz. Denn das und nichts anderes ist Hölle: von dem eigenen Versagen nicht loskommen, fest gekettet bleiben an die eigene Schmach.
Zuerst dachte er noch, sich zu töten – sah er doch, dass er nur ein Leben gerettet hatte, „dessen ganzer Zauber mit dem Schiff in die Tiefe versunken war“.
Dann – Tag um Tag, Jahr um Jahr rangen sein Verstand, seine Vernunft vergeblich um Lossprechung. Aber sein Gewissen blieb unerbittlich. So hoffte er sie von einem Anderen, einem Älteren, Erfahreneren zu empfangen – jenem Captain Marlow, dem eigentlichen Erzähler dieser Geschichte, der seinen Freunden dann so ausführlich von jener Begegnung mit Jim berichtet hat.4
Eine andere Gelegenheit, ein Tod, der zugleich eine Sühne war, aber nicht eine Flucht.
Mag sein -- das Leben in jenen Ländern damals brachte solche Lagen. Und die See bringt sie so eindringlich, wie sonst im Dasein eines Mannes höchstens der Krieg. Dann wird das Spiel zwischen Mensch und Schicksal mit unheimlicher Deutlichkeit zu einem Spiel zwischen diesen beiden allein. N u r diesen beiden.
Denn ist nicht die „Wirtschaft“ das Schicksal, das „milieu“, die Gesellschaft – dann war das alles nur Schleier. Tausende malen diese Schleier, als wären sie alles. Sie finden in ihnen das Letzte und nennen diesen Fund „Naturalismus“. Aber sie malen nur Einzelheiten.
Durch den „Schleier der Einzelheiten“ zur Tiefe – er sagt: zur „Mitte des Lebens“ vorzudringen, bezeichnet Conrad als Ziel s e i n e s Schreibens.
Er zieht Hülle um Hülle von seinen Gestalten und alles, was so wesentlich schien – Gewohnheit, Umwelt, Gesellschaft – fällt ab. Und doch dringt auch er nicht ans Ende. Des Menschen Letztes bleibt unerklärt. Auch Ibsens zwiebelschälender Peer Gynt kann Schicht um Schicht ablösen – der innerste, aus unbekannten Welten übernommene Keim gibt sich nicht preis.
Auch Conrad kann nicht sagen, w a r u m seine Helden, etwa sein merkwürdig zwielichtiger „Lord Jim“ – im entscheidenden Augenblick ihres Lebens gerade so und nicht entgegengesetzt handeln. Weiß Conrad von s i c h, warum er zur See ging? Weiß er, warum er sich eines Tages hinsetzte und schrieb?
Die Wendung kam allmählich. Zuerst unbewusst, fast widerwillig, und erst spät hat Conrad ein Schicksal bejaht, das aus einem Seemann und Tatmenschen einen Literaten gemacht hat.
Denn es erklärt nichts, zu sagen, dass seine Gesundheit ihn zwang. Es gibt nichts wesentlich Zwingendes in unserem Leben außer uns selbst. Krankheiten, Enttäuschungen allein erklären keine Wandlung. Und: W a r es überhaupt eine Wandlung?
Als kleine Junge hatte Conrad einst mit dem Finger auf den großen weißen Fleck unerforschten Gebiets gezeigt, der damals auf den Landkarten das Innere Afrikas bedeckte. Und dazu bemerkt: „Da will ich hin“. 25 Jahre später ließ sich Conrad von betrügerischen Spekulanten verleiten, mit einem Kongodampfer diesen weißen Fleck zu erschließen.
Was folgte, war eine Kette von Widerwärtigkeiten: Zusammensein mit Menschen übelster Sorte, dann Einsamkeit in der Fieberhölle des Urwalds. Schließlich Flucht im Kanu, allein und schwerkrank, nach Monaten ein Schiff nach Europa, dann ein Spital in Antwerpen.
Wahrscheinlich hatte Conrad schon während seiner letzten Fahrten begriffen, dass er unter den Augenblicksmenschen seiner Umgebung immer Außenseiter geblieben war: Einer, der innerlich mitschrieb, was er erlebte, und nicht wie jene e i n Abenteuer über dem n ä c h s t e n vergaß.
Er war schon Außenseiter gewesen, als er blutjung nach Marseille kam. Denn alles, war er liebte, die See, ihre Gefahren, und ihre Menschen, jene Wirklichkeit am Rande letzter Entscheidungen, die ihm „Leben“ bedeutete, sie alle riefen nach Dauer, nach Gestalt, nach Vollkommenheit.
So, wie er sie in Wahrheit erfuhr, waren sie stets ohne Anfang und Ende.
„So sei es im Leben“ – klagt er einmal – „unvollkommene Freude, unvollkommener Schmerz, unvollkommenene Schurkerei oder Heldenhaftigkeit“. Vollkommene Abenteuer gäbe es höchstens in Büchern für Knaben.
„Meine“ – so setzt er fort, - „fanden nie einen Abschluss. Sie lösten sich in Nichts auf, ehe ich Gelegenheit hatte, mehr zu tun als irgendein anderer“.
Vielleicht vergaß Conrad: die Gelegenheit bietet sich nur dem, der handelt unter dem ausdrücklichen Verzicht, gleichzeitig zuzusehen.
„Denn wir,“ – schrieb Flaubert lange vor ihm und nahm damit die Erkenntnis Conrads vorweg – „… wir sind nicht da, es zu haben, sondern es zu sagen“.
=====================