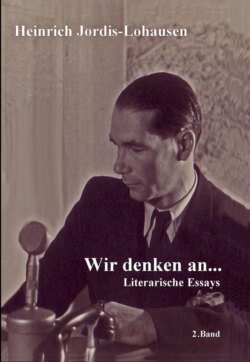Читать книгу Wir denken an ....... - Heinrich Jordis-Lohausen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lord Byron
Оглавление„Ich hasse, was nur erdichtet ist, Poesie ist Leidenschaft“, das heißt, sie ist erlitten – oder sie ist nicht.
Wer das sagt, dem ist Dichten nur Überwurf, nur Gewandung rund um sein Leben, dieses aber das eigentlich Faszinierende. Und Byrons Leben hatte alles, um zu faszinieren und Anderen zum Traum zu werden, sodass, als der große Traum „Napoleon“ ausgeträumt war, eine neu heranwachsende Jugend, für die es nun keine Schlachtfelder und keine Barrikaden mehr gab und damit kein Leben in Gefahr, den Traum „Byron“ erfand, weil seine Einzigkeit für sie Wagnis, Schlachtfeld und Barrikaden in einem verhieß und sein Vorbild einen Ausweg zu weisen schien aus einer hoffnungslos eingeheckten und umfriedeten Welt, wenn auch nur den Ausweg eines rücksichtslosen Individualismus abseits jeder Politik.
Dazu kam alles, was anzieht: Schönheit, Melancholie, Laster und das Umwittertsein von Geheimnissen. Er war lahm, aber von bestrickendem Wesen. Man dachte ihn einsam, obgleich er ein bezwingender Gesellschafter war und sah ihn nicht anders als unter dunklen Segeln einem dunklen Geschick entgegenfahrend. So schien nur ein Hintergrund denkbar: die graue Weite des Atlantiks. Er aber lebte seit seiner schottischen Kindheit, wenn nicht in London oder nahe davon, so in Italien oder Griechenland und das Meer, das ihn umgab, war das mittelländische und die Sprache, die er sprach: italienisch.
Das alles und manches andere – im Ganzen eine Summe von Widersprüchen wie die verschiedenfarbigen Pinselstriche eines Porträts – bleibt doch immer nur „Bild“, äußeres Abbild eines Schicksals, in das der Knabe Byron hineingeboren wurde und dessen er sich irgendwie entledigen musste, wie ein Schauspieler sich seiner Rolle entledigt.
Wir selbst sind nicht unser Leben und kaum je gerät ein Leben so, dass einer sagen könnte: dieses Leben bin ich. Es ist unser Weg durch den Strom. Aber wir sind nicht der Strom, wir sind nur der Kahn, der ihn quert oder entlang treibt und bloß zwischen den Sandbänken der Kindheit scheinen beide manchmal wie eins (darum so oft die rückerinnernde Sehnsucht nach ihr, wie nach einem verlorenen Land).
Byrons Kindheit jedoch war kalt und unfreundlich. Sein Vater nahm sich das Leben so leichtsinnig und ohne Bedenken, wie er zuvor die Mitgift zweier Frauen verspielt hatte. Mit der ersten, die nicht seine eigene war, ging er nach Frankreich. Und vor seiner zweiten floh er. Der Knabe jedoch, den er zurückließ, konnte nicht fliehen. Er musste eine Mutter erdulden, die launisch, geizig und ungerecht war. Fassungslos steht der Siebenjährige vor ihrem Unverständnis, als er eines Tages mit Entsetzen entdeckt, dass er nicht gerade gewachsen ist wie alle anderen Kinder, sondern hinkt. Fassungslos hört er statt Mitgefühl Vorwürfe, sodass er sich zitternd und stammelnd verteidigen muss: „Aber Mutter, ich bin so geboren!“ So trägt der kleine Lord niemals das Bild eines ihm ganz zugehörenden Menschen vor Augen wie andere Kinder, sondern trägt es verschlossen in sich. Und er verteilt seine Zärtlichkeit an Tiere und Freunde und seine Aufopferung für sie und für alle, die ihm anhängen – wie später für seinen Kammerdiener Fletcher und den Gondoliere Tita Falcier – ist sprichwörtlich.
Aber alles das ist Stückwerk für einen Menschen, der jung ist und, weil er jung ist, einen Partner will – einen für alle. Dem Achtjährigen spielte diese Rolle eine kleine Cousine, dem Zwölfjährigen die schon vom Tode gezeichnete Margaret Parker. Aber das waren Träume, keine Wirklichkeiten. Auch die seligen Ritte des Halberwachsenen mit der ebenso jungen Ann Chaworth waren es nicht. Sie endeten bloß in jäher Enttäuschung, als er aus dem Nebenzimmer unerwartet herüberhörte, mit welchen Worten sie die Neckerei ihrer Zofe abfertigte: „Glaubst du, ich mache mir etwas aus dem lahmen Jungen?“.
Sie trafen ihn so tief, dass er mitten in der Nacht davonging ohne Abschied, ohne Wagen, ohne Pferd, ohne Ziel – nur fort.
Noch wusste er nichts von dem bestrickenden Zauber seiner äußeren Erscheinung, die später Frauen wie Männer in gleicher Weise gefangen nahm. Damals lernte er nur Schmerzen zu verbeißen und seinen Körper unbarmherzig zu stählen, um auszugleichen, was die Natur ihm versagte. Und schließlich erlebte er die Genugtuung, ausdauernder und schneller zu schwimmen als andere und besser zu schießen als sie und im Sattel von keinem geschlagen zu werden. Und noch als Mann wird er allein und ohne Hilfe den Tajo und die Dardanellen durchqueren und das Bewusstsein dieser Leistung wird ihm mehr sein, als jeder gesellschaftliche und jeder dichterische Erfolg. Auch Byron war zuerst Mann und dann Lord und dann erst Dichter. Und neben dem Lord stand der Empörer, der auf eingeborenen Menschenrechten bestand und das überall und gegen jedermann selbst gegen Götter. Und gegen diese vor allem. Daher sein „Korsar“, der sich das Recht nimmt, das ihm die Gesellschaft verweigert, daher sein „Kain“, der den langweiligen, ewig fügsamen, statt fühlloser Früchte lebende Tiere opfernden Abel in einem Anfall von Zorn erschlägt, weil dieser Abel selbst noch ein Tier ist – und duldet nicht ein Mensch, der prüft und aufbegehrt: „Warum soll ich mich mühen? Weil mein Vater das Paradies verwirkt hat? Was tat denn ich? Ich war noch ungeboren. Ich suchte nicht Geburt, noch liebe ich, wozu mich die Geburt gebracht….Sein Wille wars und es heißt, Er sei gut? Wer weiß denn das? Weil Er allmächtig ist, muss Er deshalb auch gütig sein? Ich schließe nach den Früchten und die sind bitter.“
Als solch bittere Frucht sah sich auch Ann Chaworth zurückgewiesen, als sie später als Mrs.Musters versuchte sich dem mittlerweile berühmt gewordenen Lord Byron zu nähern.
Als Byron von Ann Chaworth fortlief, war er noch Schüler in Harrow. Dann kam er 17-jährig nach Cambridge. Er hat später die Jahre dort die romantischste Zeit seines Lebens genannt – „years of passion“, Jahre der Leidenschaft, die ihn den Quellen des Lebens am nächsten gebracht haben und die zugleich seine unbekanntesten sind. Man weiß nur, dass er wiederholt mit einem sehr hübschen Knaben gesehen wurde, der ihm auffallend ähnlich schien, und dass er frech genug war, einer verwandten älteren Dame, der er am Strand von Brighton nicht ausweichen konnte, als seinen jüngeren Bruder vorzustellen, was offenkundig weder sein Bruder, noch überhaupt ein Mann, sondern ein Mädchen war.
Wir kennen alle Namen aus seinem Leben, ausgenommen den ihren. Und auch der unvermeidlich nachfolgende Familienskandal konnte das Geheimnis nicht lüften. Doch die Zukunft bewies, dass diese Episode mehr als bloß Übermut, dass sie die eigentlich entscheidende war und den Schlüssel zu vielem liefert, was später beharrlich missdeutet wurde. Und manches lässt vermuten, dass ihr Ende den großen, nie mehr verheilten Riss in seinem Leben hervorrief.
Ihr folgte seine plötzliche Abreise aus England im Juli 1809 und ein zweijähriger Aufenthalt in dem damals noch türkischen Griechenland. Dann Rückkehr nach London, aufsehenerregende Rede im Oberhaus zugunsten der aufständischen Weber, erste Veröffentlichungen und erster, unwahrscheinlich plötzlicher Ruhm.
Mit einem Schlag war der nunmehr 25-jährige Lord einer der interessantesten Männer Englands und sein Privatleben Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit. Sein „Privatleben“, das hieß nicht seine sportlichen Neigungen, nicht Aquarelle und Gedichte, und nicht seine Ideen und auch nicht seine Tiere, sondern hieß in den Augen der „society“ Frauen, und da diese zunächst Damen des englischen Hochadels waren, wusste man ziemlich alles über sie, auch dass die meisten sich ihm an den Hals geworfen haben und nicht umgekehrt er ihnen. Was jedoch nicht auf Lady Milbanks, seine spätere Gattin zutrifft, so wenig wie auf die Italienerinnen seiner venezianischen Zeit, jedenfalls nicht auf die 16-jährige Contessa Guicciolo, die – obwohl anfangs noch dem Namen nach mit dem Grafen Guicciolo verheiratet – als Letzte unter vielen und am längsten seine Gefährtin gewesen ist.
Wir kennen Byrons eine Bemerkung, er sei zeitlebens nicht in die Verlegenheit geraten, ein Mädchen noch erst verführen zu müssen, und ebenso die zweite, Frauen liebten nur ihren ersten Liebhaber, nach ihm nur noch die Liebe. Das klingt – im Falle Byrons – wohl viel mehr nach Enttäuschung und frühverwundeter Zärtlichkeit, als nach jugendlicher Großsprecherei, wie auch seine Ausschweifungen in Italien mehr den Charakter der Betäubung tragen und des Vergeudens einer Lebenskraft, deren Aufsparen sinnlos geworden war.
Wir kennen auch den gehässigen Ausspruch Mary Lambs über ihn: „Eine Tugend und tausend Sünden“. Wir wissen, dass es Themen gab, über die niemand vor ihm zu sprechen wagte; und wissen weiter, dass Byron gelegentlich seiner Trauung mit Lady Milbanks – die er im Übrigen zärtlich liebte – am ganzen Körper zitterte wie Espenlaub und dass seine Scheidung unter ungewöhnlichen Umständen erfolgte; und hören, dass noch Goethe für wahr hielt, Byron leide an Gewissensbissen wegen eines begangenen Mords.
Wir erinnern uns seiner todtraurigen Lieder an Thyrza und des immer wiederkehrenden Motivs einer geschwisterlichen Ähnlichkeit von Held und Heldin, was wiederum manchen seiner Verleumder als Bestätigung einer blutschänderischen Neigung zu seiner Halbschwester Augusta erschien. Augusta jedoch glich ihrem Bruder gar nicht und Lady Byron entkräftete durch ihre ununterbrochene Freundschaft mit ihrer Schwägerin alle derartigen Behauptungen.
Ihr Scheidungsantrag lief unter dem Vorwand seelischer Depressionen ihres Gatten. Als ihr eigener Anwalt daraufhin zur Versöhnung mahnte, teilte sie ihm mit, was bis heute geheim geblieben ist, aber genügt hat, ihn nun mit allem Nachdruck betreiben zu lassen, was er bisher verhindern wollte und was darüber hinaus und auf seine Veranlassung auch den gegnerischen Anwalt bewog, sein Amt als Rechtsbeistand Lord Byrons unverzüglich niederzulegen. Das war ungewöhnlich genug, und als schließlich Byron selbst in jäher Änderung seiner Haltung widerstandslos allen Forderungen seiner Gattin nachgab, lag der Schluss nahe, dass diese Scheidung einem dringenden Interesse beider Beteiligten entsprach und dass ein ebenso dringendes Interesse vorliegen musste, den wahren Scheidungsgrund geheim zu halten. Der wäre viel zu einfach, um je erraten zu werden, war Byrons einzige Erklärung dazu.
Spätere Biographien haben diese Bemerkung, über eine lange Kette von Schlussfolgerungen hinweg, mit dem Mädchen in Knabenkleidern am Stand von Brighton in eine einigermaßen wahrscheinliche Verbindung gebracht. Sie war ihm tatsächlich ähnlich gewesen wie eine Schwester. Sie war die Heldin seiner meisten Tragödien und doch die einzige, die niemand kannte, deren Namen niemand erfuhr und über die weder Tagebücher berichten, noch Briefe. Selbst ihre Grabstätte ist unbekannt. Irgendwo hieß es, liege die Tote verscharrt in ungeweihter Erde.
Gelten ihr die verzweifelten Verse an Thyrza? Und ihrem Kind die Ode an einen Sohn? Hatte der romantische Lord das einfache Mädchen heimlich geheiratet? Und war sie, als er von Griechenland heimkehrte, wirklich tot? Oder wollte sie nur tot sein für einen, der sie treulos verlassen hatte? Und war das seine heimliche, ewig beklagte Schuld?
Und war es Lady Byron, die dann von ihr und ihrem Doch-nicht-tot-sein erfuhr? Und nun mit einem Schlage begriff, dass ihre eigene Ehe ungültig, ihre Tochter unehelich war und ihr Gatte unwissentlich in Bigamie lebte?
Unsere Kenntnis davon wird nie vollständig sein, die Nachkommen Byrons haben alles getan, sie zu verschleiern. Wir ahnen nur, dass das Leben, das Byron seit Cambridge in ständig wechselnden Masken durchlitt, nicht mehr sein eigentliches Leben war und ihn weiter und weiter davon abgetrieben hatte, abgetrieben wie jenen Kahn in den Strom.
Noch sein Freiheitskampf an der Seite der Hellenen ist eine Flucht in die Tat, aber sein Stammeln am Sterbebett zu Missolounghi ein letztes Streben zurück – zurück zu verlorenen Küsten. Er will sich erklären, aber die Stimme versagt und keiner versteht ihn mehr. Nur ein Wort gewinnt noch greifbare Gestalt: „Ich lasse jemand sehr lieben in dieser Welt zurück“. Dann fällt er in Agonie und überlässt es der Nachwelt, den Sinn jener Worte zu enträtseln, die voll Verzweiflung niedergeschrieben, zu so mannigfachen Missdeutungen Anlass gab: „A man´s love is a thing of man´s life apart“ – eines Mannes Liebe ist etwas weit abseits seines Lebens.
===================