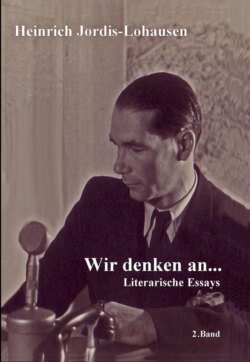Читать книгу Wir denken an ....... - Heinrich Jordis-Lohausen - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
John Galsworthy
Оглавление„Je größer die Schönheit, desto einsamer ist sie. Denn Schönheit verlangt Einklang und Einklang nach dem Letzten: nach Vereinigung“.
Dieser Satz, den Galsworthy einem seiner Lieblingshelden, dem jungen Jolyon Forsyte in den Mund legt, gibt den Schlüssel zu allem, was seine Werke an Leidenschaft, Schönheit, Liebe enthalten.
Er war einer der größten Menschendarsteller Englands – einer der größten seit langer Zeit überhaupt und einer der unaufdringlichsten.
Es gibt vieles in seinen Werken, das nur England, vieles, das nur seine Zeit interessierte; aber das Zeitliche verbirgt nur das Ewige: Gestalten wie Soames Forsyte und Irene sind ewig und immer wiederkehrend.
John Galsworthy kam am 14. August 1867 in Coombe Warren in der Grafschaft Surrey zur Welt. Das Vermögen seiner Eltern bewahrte ihn davor, einen Brotberuf ergreifen zu müssen und seine Feder zeigt die Überlegenheit dessen, der schreiben kann, ohne davon leben zu müssen.
Er studierte in Harrow und Oxford, wurde Doktor der Rechte und gewann auf einer anschließenden zweijährigen Weltreise so viel Abstand zu England, dass er seiner ersten besseren Erzählung den bezeichnenden Titel „Die Inselpharisäer“ gegeben hat.
Sie erschien im Jahre 1904, ein Jahr nachdem Galsworthy aus bloßer Laune und eigentlich nur einer Frau zuliebe zu schreiben begonnen hatte. Ein Jahr später, 1905 erschien sein erstes Theaterstück. Ihm sind später weit über zwanzig andere gefolgt, darunter solche von größter Bühnenwirksamkeit wie „Strife“ und andere, die wie „Loyalties“ in Presse und Öffentlichkeit zu lebhaftesten Meinungsverschiedenheiten Anlass gaben.
Sie hätten seinen Namen trotzdem kaum über die unmittelbare Gegenwart und über die Grenzen des englischen Sprachgebietes hinausgetragen, wäre er nicht nebstbei Verfasser weltbekannter epischer Werke, allen voran der „Forsyte-Sage“ und der „Modernen Komödie“ gewesen. Diese sind, obzwar Kritik der britischen Gesellschaft und Porträt ihres Mittelstandes während der vorletzten drei Generationen, doch mehr als bloß Schilderungen englischen Lebens.
In seiner Einleitung zur Forsyte-Sage meint Galsworthy, er habe das Wort „Saga“ mit wohlüberlegter Ironie gewählt, „seien doch auch die Menschen der alten Sagas Forsytes gewesen in ihrem Streben nach Besitz und so wenig gefeit gegen die Einflüsse von Leidenschaft und Schönheit wie Swithin, Soames oder der junge Jolyon.“
Unerschöpfliches Thema: die unberechenbaren Einbrüche der Schönheit in die wohlgeordneten Bezirke eines von Besitz, Vernunft, Gewohnheit und Schicklichkeit geregelten Lebens.
Die der Schönheit folgen, beschenkte sie mit Lust und Leid wie Irene, mit Glück und Gelassenheit wie Jolyon. Die nach ihr verlangen und doch von anderen Gütern nicht lassen mögen, schlägt sie mit nie zu stillender Sehnsucht.
Das ist das Schicksal Soames´, des eigentlichen Helden der Saga. Er heiratet nach langer vergeblicher Werbung die samtweiche Irene Heron, die 20-jährige verarmte Tochter eines Professors, die das Leben mit ihrer Stiefmutter nicht länger erträgt.
Dieser nüchtern korrekte, „bis in die Fingerspitzen egoistische“ Rechtsanwalt Soames Forsyte, „vermag alles Geld zu erwerben, nur nicht die Liebe seiner Frau. Sie empfindet nichts für ihn, hat nichts gemein mit ihm und es ist sein Verhängnis, dass sein höchster Besitz eigentlich niemals ihm gehört.“
„So büßt er seine Gier nach Eigentum“ sein Leben hindurch. „Denn keiner lechzt mehr nach Liebe als dieser Materialist“ und keiner bleibt hungriger nach Schönheit als er.
Er versteht nicht, dass ihm etwas unwiederbringlich zwischen den Fingern zerrinnen kann, wofür er den vollen Preis bezahlt hat, er kann nicht verstehen, dass man Schönheit, lebendige Schönheit nicht ebenso kaufen, einschließen und behalten kann wie andere Dinge.
Mit Absicht hat Galsworthy zum Partner Irenes keinen fetten, hässlichen Emporkömmling gewählt, sondern einen hochgewachsenen, gutaussehenden, beinahe formvollendeten Mann der oberen Mittelklassen, auf dessen ererbtes Barbarentum schon so viel Firnis gefallen ist, dass er sich, wenn auch hauptsächlich zwecks besserer Kapitalanlage, zu einem beachtlichen Kunstkenner- und Sammler entwickeln konnte.
Doch reicht seine Kennerschaft nur an jene untere Grenze menschlichen Schönheitssinns, an der unausrottbar der Glaube vorherrscht, man könne Schönheit häufen und speichern.
(Welches Glück für die Musik, dass man Melodien nicht anhäufen, nicht besitzen kann, dass man sie hören und entschwinden lassen muss und sie nicht anders aufzubewahren vermag als in Erinnerung und Sehnsucht).
Galsworthy, der Soames Bilder sammeln lässt, lässt dessen wesentlich älteren Vetter, Irenes zweiten Gatten Jolyon, malen und Musik lieben.
Noch am Vorabend seines Todes, nach zwanzigjähriger wolkenloser Ehe, hört Jolyon sie spielen und weiß: „Wie diese Stelle aus Cesar Franks Sonate war sein Leben mit ihr gewesen – ein göttlicher dritter Satz….“
Er begriff, ehe er starb, dass die Liebe Irenes ein Geschenk war. Er hatte sie nie auch anders begriffen, selbst nicht in den Tagen seiner Werbung. Es war in der „Galerie du Louvre“…. „Er sah sich nach ihr um und meinte, dort mehr als eine Frau sitzen zu sehen. Den Geist der Schönheit, den die alten Meister Tizian, Giorgione, Botticelli eingefangen und auf ihre Frauen übertragen hatten, diese unirdische Schönheit sah er von ihrer Stirn, ihrem Haar, ihren Lippen und ihren Augen widerstrahlen …. ‚Und das soll mir gehören?‘ dachte er, ‚es macht mir Angst‘ “!
Galsworthy hat Jolyon Forsyte wie später Mark Lennan in der „Dunklen Blume“ manches eigene Erlebnis und manchen eigenen Gedanken unterlegt: „Freiwilligkeit ist die Kraft jeden Bundes, nicht seine Schwäche“. Und: „Der Gipfel allen Besitzens ist, sein eigener Herr zu sein.“
Das sind Gedanken Jolyon´s, das heisst Galsworthys.
So ist jener in allem das Gegenstück zu Soames, der von der Vorstellung nicht loskam, dass selbst die Ehe eine andere Form von Besitz sei und ein Ehekontrakt ein Besitztitel ein für allemal. Soames kam umso weniger davon los, als seine Auffassung die gesellschaftlich geltende und gesetzlich geschützte ist.
Vergeblich erinnert ihn Irene an sein einstiges Wort, sie freizugeben, wenn sie mit ihm nicht mehr zusammenleben könne. Er verweigert die Einlösung, und sie verweigert sich ihm. Von rasender Eifersucht getrieben, dringt er eines Nachts in das sonst verschlossene Zimmer seiner Gattin, macht gewaltsam von seinem Besitzrecht Gebrauch und verliert sie damit endgültig und auf immer.
Besitz ist nicht Eigentum. Nur Liebe kann sich – gegenseitig – zu eigen geben. Was ich zutiefst als mir zugehörig empfinde, dem umgekehrt bin ich aus irgendwelcher Weise zu eigen. Das gilt sogar von Dingen. Sie geben uns – in der Weise der Talismane – zurück, was wir in sie hineingesteckt haben.
„Ich gehöre Dir wie auch Du mir gehörst“ – in früheren Zeiten band ein solches Verhältnis auch Herr und Knecht.
Besitz dagegen ist einseitig wie die – sogar im aufgeklärten England der Jahrhundertwende – immer noch bestehenden sogenannten „ehelichen Rechte“ des Mannes und damit notgedrungen auch ihr menschenunwürdiges Gegenstück, die entsprechenden „Pflichten“ der Ehefrau.
Liebe aber lässt sich nur als Geschenk erleben, als Gnade, oder gar nicht. Und heißt lieben andererseits so viel wie lassen und nicht halten, wie gewähren und nicht fordern, wie geben ohne der Gegengabe zu achten, so ist nur eins mit ihr unvereinbar: Zwang, jeglicher Zwang.
Unerträglich erschien der durch ihren Geliebten, den Architekten Bosenney erst wahrhaft zur Frau erwachten auch nur der bloße Gedanke, nun noch mit einem anderen als dem von ihr geliebten Manne zu schlafen, auch nicht mit Soames, schon gar nicht mit Soames. Keiner außer ihm hatte sie bisher erkannt, mit einem Mal aber war jetzt alles anders. Sie war jetzt nicht mehr die Seine, war es nie wirklich gewesen und jedes engere Zusammensein mit ihm erschien ihr fortan wie Ehebruch.
Man kann Ehe brechen auch mit dem eigenen Gatten, kann es als Frau auch mit dem Mann, mit dem rechtsgültig angetraut ist, fühlt man sich einem anderen zu innerst verbunden. Wirkliche Ehen werden im Himmel geschlossen. Sie bedürfen keines Vertrages, was sich sonst Ehe nennt aber trägt bloß irdische Unterschrift. Nur diese zwar hat irdische Rechtskraft: ihre offenkundige zuweilen teuflische Stärke, zugleich ihr dann ebenso offenkundiger Widersinn. Soames lässt Irene beides erleiden und erleidet selber die Folgen.
Was nützt es ihm, dass er Irenes Geliebten zuerst in den finanziellen Ruin und dann in den Tod treibt? Was hat er davon, dass Bosenney zuvor alle Qualen jener durchmacht, die ihre Geliebte in der Gewalt eines anderen wissen, eines, dessen Willkür sie nicht wehren können, weil hinter ihr das „Gesetz“ steht, und sich solche Gewalt jenem Gesetz zufolge als „Recht“ darstellt?.
Was nützt es Soames, dass er seinen Nebenbuhler durch alle Höllen jener Unglücklichen hindurch treibt, deren Verhängnis es ist, eine verheiratete Frau wirklich zu lieben?
Irene zieht Not und Einsamkeit einem glänzenden Gefängnis vor und widersteht allen Versuchen des Gatten, sie zurückzugewinnen.
Erst spät, in der uneigennützigen Liebe zu Fleur, seinem einzigen spätgeborenen Kind aus zweiter Ehe, gelangt Soames zu der Erkenntnis, dass Schönheit etwas Geistiges, nur durch eigene Hingabe Erfassbares sei.
Fleur wird es später nicht erspart bleiben, zu erfahren, dass auch Hingabe ihren Sinn verfehlt, wenn sie nichts anderes bezweckt, als den Partner zu fesseln. Sie verliert Jon, den Sohn Irenes im gleichen Augenblick, da er ihrer Verführung erliegt. Die Empfindung, ein Vertrauen gebrochen und sein inneres Gesetz verletzt zu haben, treibt ihn ohne Wiederkehr von ihr fort.
Dass sich Menschen nicht besitzen lassen, dass Liebe im Grunde unfassbar ist, erfährt der siebzigjährige Soames während einer letzten, zufälligen, nur Augenblicke währenden Begegnung mit Irene:
„Eine Stehlampe mit orangefarbenem Schirm stand beim Klavier und ihr Licht fiel auf Noten und Tasten, auf Wange und Haar der Spielerin. Obgleich er gewusst hatte, dass sie nun ergraut sein würde, berührte ihn doch der Anblick ihres Haares ohne eine Spur des früheren goldenen Schimmers wie ein Wunder. Es bedeckte sie in weichen, glänzenden Wellen wie eine Haube. Sie war in Abendtoilette und er konnte sehen, dass Schulter, Hals und Arme noch immer voll und schön waren. Ihr ganzer Körper bewegte sich von den Hüften an sanft im Rhythmus des Spiels…. Und wieder hatte er das Gefühl: ,Dort sitzt die Frau, die ich niemals gekannt habe, sie hat viele Fehler gehabt, aber ihr schlimmster war bis zum heutigen Tag dies verdammt Geheimnisvolle, mit dem sie sich umgab‘.“
Angeborene Ritterlichkeit zwingt Galsworthy, seine Heldinnen immer in Schutz zu nehmen. Für ihn, den wirklichen Mann, sind sie immer noch das schwächere Geschlecht. Das Leben ist unbarmherziger mit ihnen, seine Entscheidungen gelten unbedingter für sie. Ein zu schnell gefasstes Vertrauen, ein unbesonnener Schritt in der Jugend, eine voreilig geschlossene Ehe: alles das ist ungleich verhängnisvoller, ungleich folgenschwerer.
Und doch sind sie, an ihrer Schwäche gemessen, tapferer als ihre männlichen Partner. Gyp im „Jenseits“, Nell in der „Dunklen Blume“, Audrey im „Patrizier“, selbst Fleur; sie alle sind zu rückhaltloseren Opfern bereit als Lord Sommerhay, Mark Lennan, Eustace Milton, Jon Forsyte.
Galsworthy hatte die langen Jahre seines Schaffens zum größten Teil in Dartmoor, seinem kleinen Besitz in Devonshire verbracht.
Seine Landschaften, die wie mit Wasserfarben gezeichnet erscheinen, seine Tiere, die er nicht jagen mag, weil er sie liebt, seine einfachen Menschen am Weg sind Kinder langjähriger Beobachtung fern aller Stadt. Auch sie zeigen das Lächeln und die stille Gelassenheit eines Künstlers, der über dem Wissen seiner Jahre das Staunen der Jugend vor den Wundern des Lebens niemals verloren hat, und der die Überraschung hinnimmt, die es für diejenigen bereithält, die ihm nicht in die Zügel fallen….
Es ist das Erstaunen Mark Lennans vor der Leidenschaft Nells im „Herbst“ der „Dunklen Blume“, das leise Verwundern des sterbenden Jolyon, der zwischen wiegenden Halmen und sinnentrunkenen Bäumen die Welt mit einem letzten seligen Atemzug entlässt: Sommer…. Sommer…. Sommer !
Dasselbe Verwundern vor den Herrlichkeiten des Daseins, das Galsworthys erste Novelle in die Frage eines Mädchens ausklingen lässt:
„Können wir denn niemals genug haben?“
Die Antwort (die Galsworthy verschweigt) „Nie!“ ist unzweifelhaft.
======================