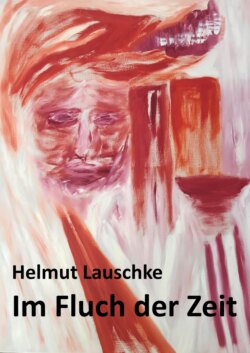Читать книгу Im Fluch der Zeit - Helmut Lauschke - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schlesischer Exodus und die Suche nach einer Bleibe mit Dach über dem Kopf
ОглавлениеZum Stand der Ethik und Verantwortung
Die Krise der Menschheit geht in zwei Richtungen: 1. Den Verfall in der Geistfeindlichkeit mit dem Ethikverlust und der Unsittlichkeit, 2. In die Notwendigkeit der Wiedergeburt der Zivilisation aus dem Schöpfungsgeist der großen Philosophie.
Die kleine Turmglocke läutete den Trauergottesdienst für den verstorbenen Pfarrer Altmann ein. Oberstudiendirektor Dr. Hauff und Direktor Hobel von der schlesischen Raiffeisenkasse, beide pensioniert, saßen in der ersten Reihe neben Konsistorialrat Braunfelder. Herr Stelzner vertrat den Bürgermeister. Die Kirche war halb gefüllt. Pfarrer Richter, dem 1917 eine Granate den linken Arm abgerissen hatte, führte den Gottesdienst und nannte Pfarrer Altmann einen Fechter für die Wahrheit und einen guten Menschen, der durch sein freundliches Wesen vielen Menschen geholfen und viele durch das Wort des Herrn getröstet habe. Er nahm den Mut und die Kraft aus der Tiefe des Glaubens und liebte die Offenheit der Kinder. Konsistorialrat Braunfelder ging auf die Verdienste von Pfarrer Altmann um die Wahrheit und die Menschen gar nicht ein. Er las eine leere Rede vom Papier ab, die eine Schalenrede ohne Inhalt und von daher eigentlich überflüssig war.
Eckhard Hieronymus verlas die Trauerbotschaft des Bischofs, der die Verdienste mit dem mutigen und unermüdlichen Einsatz des Verstorbenen hervorhob. Er beschrieb Pfarrer Altmann als ein leuchtendes Vorbild in einer schweren Zeit der großen Opfer, der ein großes Vermächtnis hinterließ, das nicht aus den Augen verloren werden dürfe. In einem Gespräch nach dem Gottesdienst zeichneten Oberstudiendirektor Hauff und Bankdirektor Hobel die Zukunft in schwarzen Farben. Dr. Hauff sagte, dass dem deutschen Volk ein Wolkenbruch mit einem Gewitter drohe, dem verglichen der 1. Weltkrieg nur ein kurzes Wetterleuchten war. In der Sakristei gab es noch ein kurzes Gespräch mit Pfarrer Richter, der noch einmal auf die große Leistung von Pfarrer Altmann zu sprechen kam, der sein Leben eingesetzt hat, wenn er das Böse angeprangert und das Wort der Liebe gepredigt hat. Pfarrer Richter sagte, dass er von der Gestapo belauscht werde und schon einige Male verwarnt wurde. Es sei der Verlust des Armes im Fronteinsatz, was den Leuten einen gewissen Respekt abverlangte, was ihn bislang vor dem Kellerverhör verschont hatte. Er sagte auch, dass dem Konsistorialrat die Angst vor dem Kellerverhör der Gestapo dermaßen in den Gliedern sitze und in den Kopf gestiegen sei, dass er seinen Mund verschlossen hält und sich zu den Gottesdiensten nur noch selten blicken läßt.
Eckhard Hieronymus nahm im ‘Schlesischen Hof’ das Mittagessen ein, was eine dicke Bohnensuppe mit einigen ‘verlorenen’ Speckstücken und zwei Graubrotscheiben war. Er verfolgte aus dem Fenster das stumpfsinnige Marschieren eines Fähnleins uniformierter Hitlerjungen auf dem Bahnhofsplatz mit hoch getragener Hakenkreuzfahne vorneweg. Am Nachmittag fuhr er mit dem Zug nach Breslau zurück, der mit einstündiger Verspätung Burgstadt verließ, die beiden Fördertürme und das mehrstöckige Verwaltungsgebäude des Minenkonsortiums im Abstand von etwa einem Kilometer passierte und die langgezogene Linkskurve hinter den hohen Kohlehalden nahm, hinter denen erst die Burg mit den beiden Turmkolossen und dann die Turmspitze der Elisabethkirche aus dem Blickfeld verschwanden. Felder reifen Getreides, grüne Wiesen mit weidenden Kühen und Pferden und Wälder mit säumenden Birken streckten sich weitläufig auf beiden Seiten unter dem rötlichen Licht der untergehenden Sonne, und die Dörfer mit den kleinen Häusern und Scheunen wechselten sich im abendlichen Frieden ab.
Eckhard Hieronymus kam verspätet in Breslau an. Polizisten mit Tschakos auf den Köpfen, umgehängten Gewehren und angeleinten Schäferhunden patrouillierten die Bahnsteige nach beiden Seiten ab. Junge SA-Männer in braunen Uniformen mit dem großen Hakenkreuz auf roten Armbinden standen, rauchten und sahen lachend drei vorübergehenden BDM-Mädchen in braunen Blusen mit den roten, durch schwarze Knoten aus verkreuzten schmalen Lederriemen gezogene Halsschleifen und in schwarzen Röcken hinterher. Über dem Bahnhofsausgang hing die große Hakenkreuzfahne, und an den Gebäudemauern klebten die Plakate, die dem Endsieg auf unterschiedliche Weise das ‘große’ Wort schrieben. Der Bahnhofsplatz lag im trüben Laternenlicht, als die Rathausuhr die zehnte Stunde schlug. Uniformierte Streifengänger kamen mit und ohne Hunde den wenigen Passanten auf dem Trottoir entgegen, andere folgten ihnen. Das trübe Licht der Straßenlaternen drückte auf die Stimmung der Menschen.
Luise Agnes legte den grauen Wollfadenknäuel und den angestopften Strumpf mit Nadel über dem Stopfpilz zur Seite und begrüßte Eckhard Hieronymus mit blassem Gesicht. Sie umarmten und küssten einander. Aus dem Radio erklang die dritte Beethoven-Symphonie, gespielt von den Berliner Philharmonikern unter Wilhelm Furtwängler. Eckhard Hieronymus berichtete vom Trauergottesdienst für den aufrechten Pfarrer Altmann, vom alt gewordenen Konsistorialrat Braunfelder, von Pfarrer Richter, der den linken Arm im 1. Weltkrieg verloren und einen bewegenden Nachruf auf den Verstorbenen gehalten hatte. Luise Agnes hatte Tränen in den Augen, als sie hörte, dass es den Schneider Stein nicht mehr gibt, der mit anderen Juden der Stadt vor Jahren in den Osten deportiert wurde. Ihre Gedanken gingen dabei zu ihrer Mutter Elisabeth Hartmann, der Ehefrau des Pfarrers im Ruhestand Eduard Hartmann, die mit Mädchennamen Sara Elisa Kornblum hieß und seit 1936 auf einem kleinen Bauernhof versteckt gehalten wurde und mit einer offiziellen Sterbeurkunde für tot erklärt war, damit sie als ‘Tote’ das Terrorsystem überlebte. Eckhard Hieronymus erwähnte den Brief des Bischofs, den er verlas, in dem Bischof Rothmann den Verstorbenen als ein leuchtendes Vorbild beschrieb, dessen Vermächtnis nicht aus den Augen verloren werden dürfe. “Das Wort des Herrn muss unsere Herzen erreichen, damit wir begreifen, wo wir stehen und wo wir stehen sollen.” “Wunderbar, wie recht er doch hat!”, rief Luise Agnes und wischte sich mit der Hand die Tränen von den Augen.
Sohn Paul Gerhard wurde im April 1944 mit 18 Jahren und anderen Klassenkameraden nach bestandenem Kriegsabitur zur Wehrmacht an die Ostfront eingezogen. Beim Abschied auf dem Bahnhofsplatz hatten auch Vater und Sohn Tränen in den Augen. Luise Agnes hatte die meisten der in der Nacht gebackenen Plätzchen in eine Blechdose getan und in seinen Tornister gesteckt. “Hast Du genug Taschentücher mitgenommen?”, war die letzte Frage der Mutter. “Ihr werdet von mir hören!” Mit diesem Ruf aus dem offenen Abteilfenster und mit winkendem rechten Arm verließ Paul Gerhard mit dem Zug nach anfänglichem Anrucken der Waggons Breslau Richtung Osten, als Luise Agnes ihm mit rollenden Tränen noch zurief: “Pass gut auf dich auf!” Alle winkten dem nicht mehr Heimgekehrten mit tränennassen Taschentüchern solange nach, bis das Zugende zum Punkt zusammengeschrumpft war.
Die Kesselschlacht gegen die Kirche hatte sich dramatisch zugespitzt. Pastöre wurden in den Kellern der Gestapo verhört, und viele kehrten aus den Kellern nicht zurück, dass mehr und mehr Pfarrstellen verwaisten und die Gemeinden ohne Pastöre waren. Bischof Rothmann bat den Superintendenten, den Text zu einem Rundbrief an die schlesischen Pastöre zu verfassen, in dem zu großer Vorsicht in den Predigten ermahnt werden soll, damit nicht noch mehr Pastöre in den Gestapokellern verschwinden. Der Bischof teilte dabei mit, dass er bald in den Ruhestand treten werde, aber nicht wisse, wer sein Nachfolger werden wird.
Eckhard Hieronymus legte am nächsten Tag den Entwurf vor, und der Bischof las ihn sorgfältig durch. Er las den Entwurf dreimal und machte am Ende eine nachdenkliche Miene. Er setzte mit dem Bleistift einige Korrekturen und sagte, dass einige Passagen gestrichen werden müssen, weil sie Anlass zu Missverständnissen geben, wenn der Rundbrief in falsche Hände komme. Nachdem der Entwurf bischöflich gekürzt und die nötigen Korrekturen bekommen hatte, wurde der Text vom Sekretär mit Schreibmaschine geschrieben. Bischof Rothmann bat nun den Superintendenten, den Rundbrief in seiner Vertretung zu unterscheiben und begründete die Bitte damit, dass er kurz vor seiner Pensionierung nicht noch mit der Gestapo in Berührung kommen wolle. Eckhard Hieronymus folgte mit Bedenken der bischöflichen Bitte und unterschrieb den Rundbrief, worauf ihm Luise Agnes hellsichtig und folgerichtig den baldigen Besuch der Gestapo prophezeite mit den Konsequenzen für ihn und die Familie.
Eckhard Hieronymus stand zwischen zehn und elf vor der Haustür. Er klingelte dreimal, weil seine Hände zitterten, und er den richtigen Schüssel am Bund nicht fand, um die Tür aufzuschließen. Luise Agnes öffnete in Sekundenschnelle die Tür und empfing ihn mit blassem Gesicht. “Ach ist das eine Erlösung, dass du wieder hier bist”, sagte sie im Tränensturz der Erleichterung. “Dass wir uns wiedersehen, ist das größte Geschenk meines Lebens”, fuhr sie mit verweinter Stimme fort. Sie ging in die Küche, um frischen Tee aufzubrühen, als gegen halbzwölf Mitternacht das Telefon klingelte. Beim dritten Klingelzeichen nahm Eckhard Hieronymus den Hörer ab und meldete sich mit “Hallo”. Die Männerstimme am anderen Ende fragte, ob er der Superintendent Dorfbrunner sei, was Eckhard Hieronymus bejahte. “Hier ist Rauschenbach. Entschuldigen Sie die späte Störung. Doch es eilt sehr”, sagte die Stimme am anderen Ende und fuhr fort: “Wir haben uns heute am Tisch im Haus der SA gegenübergesessen, wo ich den Vorsitz bei dem Gespräch geführt habe. Können Sie sich an mich erinnern?” “Ja, Sie sind frisch in meiner Erinnerung.” “Nennen Sie zwei der spezifischen Merkmale an mir, damit ich sicher sein kann, dass Sie der Superintendent Dorfbrunner sind.”
“Sie haben eine schräg verlaufende Narbe über der rechten Stirn von etwa sieben Zentimetern, und an der rechten Ohrmuschel fehlt das obere Viertel.” “Das ist korrekt. Ich muss Sie treffen. Ich rufe von der Telefonzelle Wilhelmstraße, Ecke Waterloostraße, ganz in der Nähe ihres Hauses an. Ich hole Sie mit meinem Wagen ab. Warten Sie vor der Tür. Ihr Leben ist nicht in Gefahr.” Der Hörer am anderen Ende wurde mit dem Klicklaut in die Gabel gehängt. Eckhard Hieronymus küsste Anna Friederike auf die Stirn und Luise Agnes, die mit der Teekanne aus der Küche kam, zog sich die Schuhe an und verließ das Haus, ohne dass die beiden etwas vom ‘Gespräch’ im Haus der SA erfahren hatten.
Der Wagen wartete vor der Tür, und die rechte Beifahrertür wurde von innen geöffnet. Bei der Fahrt entschuldigte sich Herr Rauschenbach für die späte Störung und die Aufregung, die er ihm und seiner Familie verursachte. “Aber es eilt. Ihre Position steht auf dem Spiel und damit ihr Leben und das Leben ihrer Familie. Ich will ihnen helfen, Sie vor den Folgen zu bewahren, die das Regime für Leute wie Sie reserviert hat. Das Regime hat für Sie, wie für so viele ihrer Pastöre einen Platz in einem der Konzentrationslager reserviert.” Der Wagen fuhr in einen Hain außerhalb der Stadt und hielt auf einem schmalen Wegstück unter dichtem Baumbestand an, wo Herr Rauschenbach Licht und Motor abstellte. Er zündete sich eine Zigarette an und bot Eckhard Hieronymus eine an, was er dankend ablehnte.
“Fangen wir von vorne an”, sagte Herr Rauschenbach, der seinen richtigen Namen nicht nennen wollte: “Der Auftrag, der mir gegeben wurde, ist, Sie der Volksverhetzung und Staatsgefährdung zu überführen und Sie auf diese schweren Vergehen hin vor dem Volksgericht anzuklagen. Damit ist automatisch das Berufsverbot verbunden. Je nachdem, wie das Urteil ausfällt, meist sind es die Höchststrafen für Pastöre, katholische Geistliche und Andersdenker, werden die Verurteilten nach kurzen Gefängnisaufenthalten in ein Konzentrationslager deportiert, wo die Chancen, da lebend wieder rauszukommen, der mathematischen Formel mit dem Grenzwert ‘0’ entsprechen. Ich habe mich bei dem Gespräch, das wir heute im Haus der SA hatten, wo Sie intelligent und umfassend auf die ihnen gestellten Fragen eingegangen sind und diese beantwortet haben, davon überzeugt, dass Sie kein Volksverhetzer sind.”
Herr Rauschenbach verwies auf den Beisitzer mit dem großen Parteiabzeichen, der den Auftrag in der gewohnten Weise erledigen und Eckhard Hieronymus beim Volksgericht wegen der ‘Vergehen’ verklagen wollte. Der Beisitzer sei ein Hundertfünfzigprozentiger und von beachtlicher Intelligenz, der als ehemaliger Studienrat für Deutsch und Geschichte schon viele Menschen ins Unglück gestürzt hat. Herr Rauschenbach erklärte, dass der Superintendent in dieser kritischen Situation einen Beitrag zur Selbstrettung und Rettung seiner Familie leisten müsse, wo der kleinste Beitrag der Antrag auf Mitgliedschaft der Partei sei. “Es gibt keine Alternative, wenn Sie den Kopf aus der Schlinge ziehen wollen, bevor sie zugezogen wird”, sagte er glaubhaft, dass Eckhard Hieronymus aus Sorge um Luise Agnes und Anna Friederike mit starken Gewissensbissen zustimmte. Herr Rauschenbach füllte das Antragsformular im Licht der Taschenlampe auf der Aktenmappe im Auto aus, und Eckhard Hieronymus unterschrieb das ausgefüllte Formular. Darauf brachte ihn Herr Rauschenbach nach Hause, wo Luise Agnes und Anna Friederike in großer Aufregung auf ihn warteten.
“Das Unglaubliche ist, dass es in der Gestapo einen Menschen gibt, der mir und meiner Familie helfen will.” Das sagte Eckhard Hieronymus, als er Luise Agnes und Anna Friederike vom Verhör im Haus der SA in der Kesselstraße und vom Mitternachttreff mit Herrn Rauschenbach berichtet hatte. Luise Agnes drückte ihrem Mann fest die Hand. Sie war erschüttert über die Art des Verhörs, durch das Eckhard Hieronymus gegangen war. “Da hast Du den Gesandten des Teufels gegenübergesessen. Ich habe zum lieben Gott gebetet, dass er dir beistehe und dafür sorgen möchte, dass Du da lebend wieder rauskommst”, sagte sie.
Im Osten war das dumpfe Grollen des nächtlichen Kanonendonners zu hören. Der Empfang beim Gauleiter in seiner hell erleuchteten Prunkvilla mit dem üppigen Abendessen, der reichen Auswahl deutscher und französischer Weine und anderer alkoholischer Getränke und den stets gefüllten Zigarettenständern endete mit dem Ruf: “Auf auf, Kameraden, auf geht’s auf den Endsieg zu!” Eckhard Hieronymus begleitete den neuen Bischof zu seiner Residenz. An der Haustür sagte Dr. theol. Horchheimer, dass der Krieg entschieden und sein Ende nahe sei. Nun komme es darauf an, die eigene Haut zu retten. Er sprach den Satz: “Auch wir müssen Breslau verlassen, bevor es zu spät ist, solange noch ein Zug in den Westen fährt. Wir werden ernten, was wir gesät haben.”
Luise Agnes und Anna Friederike waren sehr aufgeregt, als er zu Hause ankam. Die Domglocke schlug drei Uhr morgens, als es an der Tür klopfte. Ein Mann überreichte einen zusammengefalteten Zettel und sagte, dass Ludwig und Martha Lorch auf der Flucht seien und am Tage zuvor Breslau mit der versteckten Elisabeth Hartmann, geborene Sara Elisa Kornblum, der Mutter von Luise Agnes, passiert hätten. Der Mann war in Eile und lehnte die Tasse Tee ab. Er verließ die Haustür mit den Worten: “Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Ich wünsche ihnen für ihre Flucht alles Gute. Mögen Sie den Weg in die Zukunft, die wir nicht kennen, aber fürchten, heil überstehen.”
Der Exodus der Schlesier war in vollem Gange. Mutter Dorfbrunner und der kriegsversehrte Bruder Friedrich Joachim hatten mit Freunden vor einer Woche Breslau verlassen. Die Nachricht der Mutter war, dass sie auf dem Wege nach Dresden seien, um bei Onkel Alfred, dem Bruder der Mutter, in der Münchner Straße Unterkunft zu finden. Eduard Hartmann, der Vater von Luise Agnes und Pfarrer im Ruhestand war gestorben, ohne dass er sich von seiner Frau Elisabeth verabschiedet hatte, und Elisabeth ihm für die Himmelfahrt die Augen schließen, ihm den Abschiedskuss auf die Stirn geben und die Hände falten konnte. Sie war mit den tapferen Bauersleuten Ludwig und Martha Lorch, die sie neun Jahre lang auf ihrem Bauernhof versteckt hatten, auf dem Pferdewagen Richtung Halle an der Saale auf der Flucht, wie auf dem entfalteten Zettel zu entziffern war.
Eduard Hartmann wurde noch ein Notbegräbnis auf dem Hauptfriedhof seiner Heimatstadt zuteil, bevor die Russen die Stadtmauer erreichten. Kolonnen beladener Wehrmachtfahrzeuge, die von Kübelwagen und Krädern mit Beiwagen begleitet wurden, kamen verdreckt und verbeult aus dem Osten in die betriebsame Stadt. Hitlerjungen mit Kindergesichtern wurden eingezogen und leisteten vor der gehissten Hakenkreuzfahne auf dem Bahnhofsplatz den ‘Führer’-Eid. Ein Major der Luftwaffe mit dem umgehängten Ritterkreuz nahm den Eid ab. Dann bestiegen die Vereidigten, von denen die meisten Schuljungen waren, die offene Ladefläche eines Militärfahrzeugs und wurden zur Kaserne gefahren, die außerhalb der Stadt lag. Beim Abtransport für den Kampf in den bereits verlorenen Krieg winkten die Jungen mit dem Lächeln der hilflosen Verzweiflung den Eltern, Geschwistern und Freunden auf dem Bahnhofsplatz zurück. Jeder Quadratmeter Heimatboden sollte laut ‘Führer’-Befehl bis zum Letzten gegen den bolschewistischen Ansturm verteidigt werden. Glatzköpfige Menschen in gestreiften Jacken und Hosen wurden von SS-Männern bewacht durch die Stadt gefahren. Schützengräben wurden ausgehoben, Panzersperren errichtet und die einstige Perle an der Oder zur Schlachtfestung verschandelt. Russische Tiefflieger kurvten über der Stadt, und die fliegenden Maschinengewehre schossen wahllos in die hektische Betriebsamkeit der verzweifelten und zur Flucht aufbrechenden Menschen.
Den Dorfbrunners verblieben noch wenige Stunden. Luise Agnes und Anna Friederike packten die Koffer, während Eckhard Hieronymus sich noch von ein paar lieben Menschen verabschiedete, so von Herrn Kehrer, einem treuen Gemeindemitglied, der an einem Lungenkrebs litt. Als Eckhard Hieronymus an seinem Bett im zweiten Stock stand und sagte, dass er sich von ihm verabschieden möchte, machte Herr Kehrer große Augen und sagte: “Jetzt schon. Es ist doch noch nicht so weit.” Wenige Minuten später verstarb Herr Kehrer. Eckhard Hieronymus sprach mit der Tochter von Herrn Kehrer das Vaterunser und strich dem Verschiedenen mit der rechten Hand den Segen für eine gute Himmelfahrt über die Stirn. Dann suchte Eckhard Hieronymus Frau Kreutzer im kleinen Obergeschoss eines kleinen Hauses in der Schindelgasse auf. Ihr Mann, Adolf Kreutzer, läutete in den letzten Jahren die Glocken und half als Küster dem alten Peter Meyer aus, der an der Parkinsonschen Krankheit und unter Schwindelanfällen litt. Herr Kreutzer war Anfang dreißig, als er vor fünf Monaten, statt die Glocken zu läuten, an einem Wochenende eingezogen und an die Front geschickt wurde. Er war bei den heftigen Weichselkämpfen vor drei Wochen gefallen und hinterließ seine junge Frau mit drei kleinen Kindern. Frau Kreutzer sagte, dass sie ein kleines Zubrot zur schmalen Kriegerwitwenrente durch Putzarbeit im Hause eines hochgestellten Parteimenschen verdiene, diese Stelle aber wieder verlieren werde, weil sich der Mann mit seiner Familie im Westen in Sicherheit bringen wolle. Sie warte auf ihren Neffen, der mit einem Leiterwagen komme, um sie und ihre Kinder mit der wenigen Habe auf einen Bauernhof außerhalb der Stadt zu bringen, wo sie durch Feldarbeit das Essen und die Schlafplätze in der Scheune verdienen wolle. Eckhard Hieronymus dankte Frau Kreutzer für ihre Mitarbeit im Winterhilfswerk mit dem Sammeln von Mänteln und Schuhen für die frierenden Soldaten an der Front und für ihre stete Hilfsbereitschaft beim Putzen in der Kirche. Er wünschte ihr und ihren Kindern Gottes Schutz und Gottes Segen.
Wenig Zeit war verblieben, die Eckhard Hieronymus nutzte, um sich vom jungen Pfarrer Rudolf Kannengießer zu verabschieden, der durch seine gerade und mutige Persönlichkeit weit über die anderen Kirchenmänner Breslaus hinausragte. Er wurde einige Male von der Gestapo verhört und verwarnt und beim letzten Mal fürchterlich zugerichtet. Dennoch war er in der Festigkeit des Glaubens unerschütterlich. Es war ein Wunder, dass Pfarrer Kannengießer nicht inhaftiert oder in ein Konzentrationslager geschafft wurde. Es mögen die Tapferkeitsauszeichnungen gewesen sein, die er sich im Afrikafeldzug erworben hatte, bevor er als Verwundeter mit einer Kopfverletzung, die ihm einen Hörschaden beschert hatte, als wehruntauglich aus der Wehrmacht entlassen wurde. Eckhard Hieronymus klingelte in der Deutschstraße 25 auf den Klingelknopf für das Dachgeschoss des dreistöckigen Hauses. Beim dritten Mal Klingeln schaute Pfarrer Kannengießer aus dem kleinen Fenster und kam die Treppe herunter, um den Abschiednehmenden zu empfangen. Sie stiegen die schmale Treppe hinauf, wobei Eckhard Hieronymus dem jungen Pfarrer folgte.
Im letzten Treppenteil hörten sie das Brummen und Röhren von Flugzeugmotoren, dass sie zum kleinen Fenster des kleinen Arbeitszimmers mit dem vollgepackten Schreibtisch und den vollen Bücherregalen unter der schrägen Zimmerdecke mit der vergilbten Tapete eilten und die russischen Tiefflieger beobachteten, wie sie die Stadt anflogen, über der Stadt die MG-Magazine leer schossen und in einer Rechtskurve über dem anderen Stadtende davonflogen. Von deutscher Seite wurden Geschosssalven aus Handfeuerwaffen verpulvert, die sich jedoch als untauglich erwiesen. “Das ist nun das Ende. Dann werden auch bald die Großmäuler schweigen. Sie werden irgendwo untertauchen und die Verantwortung für das klägliche Ende mit der unglaublich großen Katastrophe auf die Menschen abwälzen, die dafür nicht ganz schuldlos sind, weil sie den Anfängen nicht wehrten und dem Teufel zur Macht verhalfen, und weil sie zum Teufelswerk schwiegen und noch mitmachten, anstatt dagegen zu protestieren”, sagte Pfarrer Kannengießer. Er sagte weiter, dass es für ihn unfassbar sei, wie die braunen und anderen Horden das Volk so rücksichtslos gequält und geschunden haben. Die Arroganz käme nun zwar vor den Fall, aber die unzählbaren Toten kehrten deshalb nicht ins Leben zurück. “Was hinter den Fronten an Menschen geschändet und getötet wurde, das werde als Schmach in die Geschichte eingehen und über vielen deutschen Generationen hängenbleiben, wenn von den Schlachten an den Fronten längst nicht mehr die Rede ist.
Was in den Konzentrationslagern geschah, bleibe vor der Welt unentschuldbar. Allein dafür wird dem armen deutschen Volk das Brandzeichen des barbarischen Verbrechens auf die Stirn gedrückt werden, das da nicht mehr wegzukriegen ist.” Auf die Frage, ob die Kirche hätte mehr tun können, um die Verbrechen zu verhindern, antwortete Pfarrer Kannengießer, dass die Kirche kläglich versagt habe, als es um die Erfüllung des Auftrags ging, sich für die armen, wehrlosen und gequälten Menschen einzusetzen. “Wir Kirchenmänner haben uns blind gestellt und uns wie taubstumme Zeugen weggeduckt, anstatt wie ein Paulus zu stehen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuprangern. Das Schweigen war ein großer Fehler, den wir vor Gott und den Menschen zu verantworten haben. Wir sollten uns jetzt schon unsere Gedanken machen, wie wir unser erbärmliches Verhalten vor der nächsten Generation rechtfertigen wollen, vorausgesetzt, dass wir das Ende des Terrorsystems überleben.”
Eckhard Hieronymus schaute betroffen in das klare Gesicht von Pfarrer Kannengießer und fühlte das Reißen im Gewissen wegen der Mitgliedschaft zur Nazipartei, was er auf Anraten des ‘Doppelagenten’ Rauschenbach so spät vor Toresschluss noch geworden war. Auf die Frage, ob er Breslau verlassen werde, sagte Pfarrer Kannengießer, dass er die Stadt nicht verlassen werde, weil es genügend Menschen gäbe, die seinen Beistand bräuchten. Da er keine Familie habe und sein Leben Gott und den Menschen zu dienen habe, solange es geht, habe er sich entschlossen, den Kampf um Breslau von seinem Dachfenster aus zu verfolgen. Pfarrer Kannengießer spürte die depressive Stimmung des Superintendenten und bot ihm einen Kornschnaps an, was in Maßen genommen eine gute Medizin in diesen Tagen sei. Sie stießen die gefüllten Schnapsgläser an und tranken auf das gegenseitige Überleben. Eckhard Hieronymus stellte das noch halb volle Glas zwischen die gestapelten Bücher auf den Tisch zurück und verabschiedete sich. Pfarrer Kannengießer brachte den Superintendenten an die Haustür und wünschte ihm und seiner Familie Gottes Segen. “Behalten Sie Breslau im Herzen, so wie die Menschen Breslaus Sie im Herzen behalten werden.”