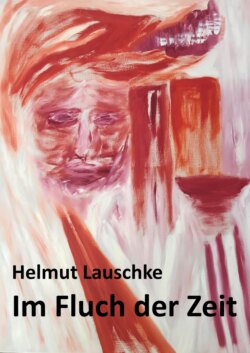Читать книгу Im Fluch der Zeit - Helmut Lauschke - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zwei ungewöhnliche junge Soldaten
ОглавлениеDraußen war es stockfinster gegen halbneun, als das Geräusch eines Motorrades zu hören war, das mal lauter, mal leiser wurde, dann ganz stockte und wieder zu hören war. Das Geräusch wurde lauter, und ein Licht war durch das andere kleine Küchenfenster zu sehen. Das Motorrad kam auf den Hofeingang zugefahren. Eckart Dorfbrunner, der wie die andern bei den Bratkartoffeln war, verließ den Tisch, zog sich eine warme Jacke an, die neben dem Herd aufgehängt war, und ging nach draußen. Der Motor war ab- und das Licht ausgestellt. Man hörte, wie zwei Männer zu Eckart sprachen. Was sie sprachen, das hörte man in der Küche nicht. Es dauerte lange, bis Eckart mit einem verstörten Gesicht zurückkam. Er berichtete im Stehen, dass zwei Landser mit dem Motorrad gekommen seien, die sich von der Truppe in Nisky abgesetzt hatten und sich nun verstecken müssten. Sie sagten, dass sie auf der Stelle erschossen würden, wenn sie von der Feldgendarmerie aufgegriffen würden. “Was sollen wir tun?”, fragte Eckart und sagte: “Die stehen draußen, es sind zwei junge Männer. Ich habe ihnen gesagt, dass ich erst mit meiner Mutter sprechen muss.”
Es kam zum langen Schweigen. Die Bratkartoffeln auf den Tellern wurden kalt. Dann sagte Wilhelm Theisen, dass es für alle gefährlich sei, Deserteuren Unterschlupf zu gewähren. Die würden von der Truppe mit Sicherheit gesucht. Da würde auch jeder Bauernhof in der näheren Umgebung von der Gendarmerie abgeklappert werden. Marga Dorfbrunner sah mit großen Augen auf den Tisch. Sie konnte sich nicht entscheiden, weder zur Seite der Hilfe noch zur anderen Seite der Ablehnung. “Was würdest Du tun?”, fragte sie Eckhard Hieronymus. “Wenn es mein Hof wäre”, sagte er, “würde ich den beiden Männern helfen, die doch in großer Not sind.” Wilhelm Theisen warf ein, dass sie die Gründe nicht wüssten, warum sich diese Männer von der Truppe abgesetzt hätten. “Darüber muss mit ihnen gesprochen werden”, erwiderte Eckhard Hieronymus. Marga Dorfbrunner, die Frau von Haus und Hof, sagte ihrem Sohn Eckart, die beiden Männer mit dem Motorrad in den Hof zu bringen und die Hofeinfahrt zu schließen. Eckart tat, was ihm aufgetragen war. Die beiden Männer in den verdreckten Uniformen setzten sich auf die Außenbank neben dem Kücheneingang. Das Motorrad stellte Eckart im Pferdestall ab. Nachdem in der Küche fertig gegessen war, räumte Anna Friederike die Teller und Bestecke vom Tisch in die Spüle. Bäuerin Dorfbrunner stellte die Kanne mit frisch gebrühtem Pfefferminztee auf den Tisch, dazu die Tassen mit Teelöffeln und die Zuckerdose. Während sie den Tee in die Tassen goss, gab sie dem Sohn auf, die beiden Männer in die Küche zu führen. Sie traten ein. Beide waren noch jung, und beide hatten ausgezehrte Gesichter. Der Jüngere von ihnen trug einen Kopfverband. Eckart brachte zwei Stühle. Die beiden Männer setzten sich an die freien Tischseiten. Jedem von ihnen schenkte die Bäuerin eine Tasse Tee ein.
“Wo kommt ihr denn so spät noch her?”, fragte Wilhelm Theisen die beiden Männer. “Wir mussten die Dunkelheit abwarten”, sagte der Ältere: “Das Motorrad stand auf einem Platz in der Nähe des Bahnhofs in Nisky. Es war nicht abgeschlossen, und der Zündschlüssel steckte. Ich habe den Kickstarter durchgetreten, und der Motor lief. Da bin ich mit dem Motorrad abgehauen.” “Und warum bist du abgehauen?”, fragte Eckard Hieronymus. “Das ist eine lange Geschichte”, sagte der Ältere und fing an, seine Geschichte zu erzählen: “In zwei Wochen ist es ein Jahr her, dass ich mit den anderen Klassenkameraden, wir standen eben vor dem Abitur, von der NAPOLA Grimma zur SS-Panzerdivision “Großdeutschland” eingezogen wurde.
Nach kurzer Ausbildung im Schießen wurden wir an die Ostfront befördert. Es war in Lublin, wo ich einem Erschießungskommando zugeteilt wurde. Einige hundert Menschen, es waren Männer aller Altersgruppen, hoben etwa einen Kilometer abseits von der Straße nach Warschau ein Massengrab aus. Weniger als hundert Meter weiter standen hunderte von alten und jungen Frauen, die jungen mit ihren Kindern. Sie alle sollten erschossen werden, obwohl sie den gelben Stern nicht trugen. Ich fragte den Kommandeur, was das für Menschen seien, und warum sie erschossen werden sollten. Der Kommandeur war ein junger, bissiger Untersturmführer des SS-Wachbataillons. Er schrie mich an, dass ich nicht zu fragen, sondern Befehle auszuführen hätte.
Die Frauen und Mütter mit ihren Kindern schauten voller Entsetzen, was die Männer unter scharfer SS-Bewachung hackten und schaufelten. Kinder schrien aus ihrer Not von den Armen weinender Mütter. Der Untersturmführer befahl uns, die Gewehre zu entsichern und in einer Stunde Aufstellung zur Straßenseite längs des ausgehobenen Grabens zu beziehen. Ich war mir sicher, dass ich auf diese wehrlosen Menschen nicht schießen könne und nicht schießen werde.
In dieser Stunde der Vorbereitung zur Massenerschießung ging ich zum Mannschaftswagen zurück, entsicherte mein Gewehr und schoss mir in den rechten Fuß. Der Vorfall wurde dem bissigen Untersturmführer gemeldet, der herbeieilte, auf mich einschrie und mich zur Minna machte. Er versicherte mir auf der Stelle das Disziplinarverfahren. Wutschnaubend ging er zur Grabung mit den wartenden Menschen zurück. Ein Kollege entfernte mir dann den Schuh und die Socke, säuberte die Wunde und legte den Notverband an. Die Grabung dauerte länger als erwartet. Der Untersturmführer befahl das Antreten der zu Erschießenden vor dem ausgehobenen Grab und der Mordschützen hundert Meter hinter der stehenden Reihe vor dem Grab. Ich wurde Zeuge dieses furchtbaren Geschehens.
Erst wurden die Männer, dann die alten Frauen und schließlich die jungen Frauen mit ihren Kindern von hinten, von links nach rechts erschossen. Sie fielen tot oder nicht ganz tot in den Graben, der sich mit mehreren Lagen von Erschossenen füllte. Ich hörte das Wimmern der Kinder und das Stöhnen von Erwachsenen und sah, wie die Erde von Männern eines mitgeführten Gefangenenzuges über die Lagen geworfen, das Massengrab zugeschaufelt und der lockere Boden von einem Kettenfahrzeug festgedrückt wurde. Dann stieg die Mannschaft mit ihren Gewehren auf die Wagen, die sie nach Lublin zurückbringen sollte. Ihnen folgten die Fahrzeuge mit den Gefangenen unter schwerer Bewachung.”
Er trank einen Schluck Tee, setzte die Tasse mit zittriger Hand auf den Tisch und fuhr mit der Geschichte fort: “Es war dunkel, und die Wagenkolonne hatte Lublin noch nicht erreicht, als die Kolonne von Partisanen in einer engen Straßenkurve vom Hügel aus mit Maschinengewehren angefallen wurde. Es kam zum heftigen Schusswechsel, bei dem es Tote in der eigenen Mannschaft gab und drei der acht Fahrzeuge zerstört wurden. Ich nutzte die Gelegenheit und verschwand in einen nahe gelegenen Wald. Dort wartete ich, dass die restlichen Fahrzeuge mit den SS-Leuten nach Lublin weiterfuhren. Die kalte Nacht verbrachte ich im Wald, und der Fuß schmerzte. Ich wusste, dass mir in Lublin die standrechtliche Erschießung wegen Befehlsverweigerung drohte, wie sie an vielen jungen Soldaten ausgeführt wurde, weil sie keine wehrlosen Menschen, vor allem keine Mütter mit ihren Kindern erschießen konnten.
Ich musste mich von dieser Einheit so schnell wie möglich absetzen. Dabei half mir die Tatsache, dass es bei den Deutschen Tote gegeben hatte, und der Untersturmführer mich unter den Toten wähnte und mir den Tod auch doppelt gönnte. Nur musste ich die schwarze Uniform über Nacht loswerden. Da auch Soldaten in grauen Uniformen bei der Erschießung waren, hoffte ich unter den erschossenen Deutschen eine noch tragbare Wehrmachtsuniform zu finden. Im frühen Morgen, dichter Nebel zog durch den Wald, fand ich zwei Tote in den gewünschten Uniformen. Ich wechselte meine gegen die ihre aus, vom einen die Hose, die Socken und Schuhe, vom andern das Hemd, die Jacke, den Mantel und das Koppel mit einigen Patronen in den Taschen. Auch wechselte ich das moderne Gewehr gegen ihr älteres aus. Das Aluminiumschildchen mit der Feldpostnummer entfernte ich vom Hals des Gefallenen und steckte es in die Jackentasche, in der außer einer halb leeren Zigarettenschachtel und einem Feuerzeug ein Brief der Eltern war, sodass ich mir zur Feldpostnummer auch den dazugehörigen Namen aneignete.
Es war die Gunst der Stunde, dass uns Spätgezogenen die SS-Nummer und die Blutgruppe nicht am Arm eintätowiert worden war. So saß ich in anderer Uniform mit dem durchschossenen Fuß am Straßenrand auf einer Holzkiste, die links mit Sand und rechts mit Streusalz gefüllt war. Ich versuchte zu gehen, doch nach hundert Metern hielt ich es vor Schmerzen nicht aus. So wartete ich auf ein Militärfahrzeug, um mitgenommen zu werden. Ich saß auf einer Anhöhe, von der ich die Kurven der ansteigenden Straße gut übersah. Es kamen Fahrzeuge der SS. Denen musste ich aus dem Blickfeld gehen und hockte mich hinter die Sand- und Streusalzkiste. Dann kam ein Sanitätsauto. Ich setzte mich auf die Kiste, zog, als das Fahrzeug mit Mühe die zweite Kurve nahm und etwa vierhundert Meter von mir entfernt war, das braun gestreifte Taschentuch aus der Manteltasche, das dem Gefallenen mit dem Brief und der Feldpostnummer gehörte, und winkte dem Fahrer entgegen. Der hielt an, sah den durchbluteten Notverband, rief “Komm Kumpel!”, öffnete die Ambulanztür, und ich stieg ein. Er stieg nach, legte mich auf die schmale Trage, entfernte den verdreckten Verband, säuberte die Wunde mit Spiritus, legte fachmännisch den neuen Verband an und gab die Tetanusspritze.
Der Sanitäter war ein kräftiger Mann. Er sagte, dass er ein Kumpel von der Ruhr sei. Er bot mir einen Schnaps aus der Flasche an, brach einen größeren Kanten von seinem Brot und gab ihn mir. Er sagte, dass er auf dem Weg nach Krakau sei, wo er Verwundete mit Kopfverletzungen laden müsse, die nach Breslau gebracht werden sollen. Der Kumpel von der Ruhr war ein ungewöhnlicher Mensch. Er stellte keine Fragen, als hätte er gesehen, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich sagte ihm, er solle mich mit meiner Verwundung nach Breslau fahren. Darauf sagte er: “Kumpel, du brauchst deinen Fuß. Das sehe ich ein.” Er schloss die Ambulanztür, startete den Motor und fuhr davon. Unterwegs hielt er mehrere Male an. Doch passierte er die Straßenkontrollen ohne Schwierigkeit. Nach einer dieser Kontrollen hielt er an, kam in die Ambulanz und sagte: “Junge, jetzt müssen wir aufpassen, denn nun sind die Goldfasane auf den Straßen.” Er legte mir einen Kopfverband an, der über beide Augen ging, und beschmierte ihn mit dem Blut der Fußwunde. Am späten Nachmittag erreichte das Fahrzeug das Notlazarett in Krakau. Zwei Verletzte mit Kopfverbänden wurden geladen. Einer kam auf die Doppelstocktrage, der andere wurde auf einer dritten Trage reingeschoben. Nachdem der zweite Verletzte auf der Zusatztrage reingeschoben worden war, fragte der Sanitäter nach meinem Namen und der Feldpostnummer. Beides, was dem Gefallenen von Lublin gehörte, gab ich an. Der Kumpel von der Ruhr setzte Name und Nummer zu den Namen und Nummern der beiden Kopfverletzten, deren Transportpapier der Kommandeur bereits unterschrieben hatte. So ging die Fahrt noch am selben Abend nach Breslau weiter, die von zahlreichen Straßenkontrollen in der Nacht unterbrochen wurde.
Jedesmal klopfte der Fahrer, wenn er die Schranke über die Straße sah, kräftig gegen das Blechgehäuse der Ambulanz; jedesmal knipsten wir das Licht aus, sprangen auf die Tragen, wo ich mir meinen blutverschmierten Kopfverband über die Augen ins Gesicht zog. Einmal kam das Klopfen zu spät. Der Kumpel war übermüdet. Nach einer scharfen Bremsung kam das Fahrzeug zum Stehen. Ich knipste das Licht aus. Wir drei lagen auf den Tragen, jeder mit seinem Kopfverband. Die Wachleute befahlen dem Kumpel, die Ambulanztür zu öffnen. Sie sagten, als sie die dunkle Ambulanz mit den drei Verletzten auf den drei Tragen ausleuchteten, dass sie hier Licht gesehen hätten, als das Fahrzeug angefahren kam. Der Kumpel sagte, dass er ab und zu das Licht anstelle, um zu sehen, dass die Verletzten noch so liegen, wie sie auf den Tragen in die Ambulanz hineingeschoben wurden. Es schien den Wachleuten plausibel, die noch einige Male die Verletzten ableuchteten und beim Anblick meines dicken und über die Augen gezogenen Kopfverbandes ihr medizinisches Gutachten mit den Worten abgaben, dass bei dem wohl kaum Chancen bestehen, mit dem Leben davonzukommen. Beim Schließen der Tür fiel dem jüngeren der beiden Wachleute die herumliegende Pik-zehn-karte neben der dritten Trage auf. Er fragte den Sanitäter, ob Kopfverletzte denn auch Skat spielen können. Es war die Schlagfertigkeit des Kumpels mit dem “Wohl kaum!”, dass die Wachleute von einer gründlichen Inspektion absahen, weil sie keinen Verdacht der Täuschung schöpften. Ihre Intelligenz brachte die Verbindung von der Skatkarte zum brennenden Licht in der Ambulanz nicht auf die Beine, sodass wir drei noch einmal ungeschoren davonkamen, als der Sanitätswagen nach Öffnen der Schranke davonfuhr. Doch der Kumpel hinter dem Steuer rief laut, dass man es hinten hörte: “Ihr Idioten, ich habe euch doch gesagt, dass ihr aufpassen sollt.”
Klaus merkte an der stillen Aufmerksamkeit der Zuhörer, dass seine Soldatengeschichte auf offene Ohren stieß. Er fuhr fort: “Nachdem wir etwa zehn Kontrollen passiert hatten, bei denen es, je näher wir an Breslau herankamen, SA-Leute sich an den Wachen beteiligten. Die nahmen sich besonders wichtig, ließen sich bei der Kontrolle besonders viel Zeit und leuchteten die Ambulanz und uns auf den Tragen mit dem eingefleischten Misstrauen des Systems des Bösen ab. Sie schienen den Kopfverbänden nicht zu trauen und leuchteten sie von allen Seiten mit großer Hartnäckigkeit ab. Sie fragten nach den Namen und verglichen sie mit den Eintragungen auf dem Transportpapier. Mich stupsten diese Kerle an, weil ich auf ihre Frage nicht reagierte. Ich versuchte, den Atem anzuhalten, solange es ging. Darauf sagte einer dieser Braunjacken mit der großen Swastika auf der roten Armbinde zum anderen: “Siehst du denn nicht, dass der nicht mehr atmet. Der ist bereits hinüber. Da kannst du lange auf eine Antwort warten. Komm, lass uns gehn!” Darauf schloss der Kumpel die Ambulanztür, schob den Riegel vor und hängte das Schloss ein.
Ich setzte meine Atmung wieder in Bewegung, und der Kumpel fuhr los. Bald pfiff er ein Liedchen der Erleichterung in seiner Kanzel, denn nun war Breslau nicht mehr weit. Der Morgen graute, als der Kumpel am Stadtrand hielt, die Ambulanztür öffnete und in den Raum rief: “Endstation! Wer aussteigen will, der soll es jetzt tun, denn nun geht es zum Lazarett.” Gustav entfernte seinen Kopfverband und stieg aus. Er sagte, dass er sich nach Görlitz durchschlagen wolle. Erwin hatte tatsächlich eine Platzwunde am Kopf und ich die Durchschusswunde am rechten Fuß. Ich entfernte den dicken Kopfverband und ließ mich mit Erwin zum Lazarett fahren, das im Stadtkrankenhaus untergebracht war. Der Kumpel fuhr durch die Einfahrt bis an den Eingang heran. Während wir auf Tragen mit Rollen verladen wurden, ließ sich der Sanitäter, der sich als wirklicher Kumpel zeigte, das Transportpapier von einem Offizier abzeichnen und mit dem Lazarettstempel versehen.
Auf die Feststellung des Offiziers, dass auf dem Papier drei Namen aufgeführt sind, obwohl nur zwei Verletzte mit der Ambulanz gebracht würden, sagte der Kumpel ohne die entscheidende Fallsekunde der argwohnerweckenden Verzögerung, dass der dritte auf dem Wege verstorben sei und er aus Platzgründen den Toten an einer Straßenkontrolle den Wachhabenden übergeben habe. Diese Erklärung leuchtete dem Sanitätsleutnant sofort ein, dass er keine weiteren Fragen stellte, das Papier unterschrieb, abstempelte und dem Kumpel mit den Worten zurückgab, dass er sich sein Frühstück mit der langen Nachtfahrt verdient habe, das er in der Kantine im zweiten Stock bekommen könne, wenn er sich an der Ausgabestelle auf ihn berufe. “Ich bin Doktor Haferkamp, Oberleutnant”, sagte der Offizier und gab dem Kumpel ohne Hitlergruß kameradschaftlich die Hand. Der Kumpel schob uns mit einem Krankenpfleger in den Flur vor die dortige Ambulanz. Dann verabschiedete er sich. Wir wünschten uns gegenseitig ein Überleben. Er verschwand zum Frühstück in den zweiten Stock. Diesen Kumpel von der Ruhr habe ich nie wieder gesehen und auch nie wieder etwas von ihm gehört. Ich muss gestehen, dass ich so einen Kumpel auch nie wieder angetroffen habe.”
Die Augen der Zuhörer blickten auf Klaus. Seine Geschichte riss mit, auch wenn sie von Tausenden von Soldaten in ähnlicher Weise erzählt werden könnte. Das empfanden jedenfalls Eckhard Hieronymus und Luise Agnes, die bei dieser Geschichte mit Leid und Schmerz an ihren Sohn Paul Gerhard dachten, von dem sie bis zu ihrer Wegfahrt von Breslau kein Lebenszeichen erhalten hatten. Eckart Dorfbrunner, der Bauer vom Hof, fragte den Klaus, wie er dann von Breslau nach Nisky gekommen sei. “Es war an einem Donnerstagmorgen”, fuhr Klaus mit seiner Kriegsgeschichte fort, “die Fußwunde befand sich in Heilung. Die gesplitterten Fußknochen wurden sich selbst überlassen. Die Schmerzen waren bei Belastung des Fußes zurückgegangen, wenn auch nicht ganz verschwunden. Der Lazarettarzt wechselte den Fußverband und sagte, dass er mich entlassen werde. Er schrieb das Wehruntauglichkeitsattest für die nächsten drei Monate aus und begründete die lange Dauer der Rekonvaleszenz mit dem Risiko der iatrogenen Fußknochenentzündung und Osteomyelitis.
Erwin war zwei Tage nach der chirurgischen Versorgung der großen Kopfplatzwunde aus dem Lazarett entlassen worden. Er wohnte bei seinen Eltern in Breslau und gab mir an seinem Entlassungstag Anschrift und Telefonnummer seiner Eltern. Ich rief ihn an, und Erwin holte mich persönlich ab. Dort wohnte ich für einige Tage, und ich wurde von den Eltern in großartiger Weise versorgt. Ein Freund besuchte Erwin an einem Wochenende, um sich von ihm und seinen Eltern zu verabschieden. Der Freund sagte, dass er Anfang der Woche nach Dresden fahren werde, wo er einen Posten in der Materialbeschaffungsstelle der Verwaltung der Heeresabteilung Mitte zu übernehmen habe. Erwin hatte dem Freund, der den Namen Heinrich hatte, die Geschichte meiner Flucht erzählt, die er ohne weitere Fragenstellerei offenbar verstand und akzeptierte, weil auch ihm die Lubliner Erschießung wehrloser Menschen unter die Haut gefahren war. Ich fragte diesen Heinrich, ob er eine Möglichkeit sehe, mich bis Görlitz mitzunehmen. Er sah die Möglichkeit darin, dass er von seinem Vater, der in der Gauleitung als Sekretär in der Abteilung für Information und Bildung arbeitete, ein Schreiben zur Personenbeförderung auf meinen Namen erbitten werde, mit dem ich ohne weitere Kontrollen in den Westen reisen könne. Zwei Tage später, an einem Dienstag, gab mir Heinrich das Schreiben, in dem stand, dass Klaus Mehring im Auftrag der Gauleitung Breslau nach Görlitz zu reisen habe, um sich über die Wohnungssituation der Menschen, die sich durch den Zustrom der schlesischen Flüchtlinge zugespitzt habe, zu orientieren und dem Gauleiter seine Erkenntnisse auf schnellstem Wege zuzuleiten. Dem Schreiben war der große Stempel “Der Gauleiter – Schlesischer Gau – Abteilung für Information und Bildung” mit dem fettbalkigen Hakenkreuz in der Stempelmitte aufgedrückt. Es trug die Unterschrift “C. von Brenninger”, die dem Vater von Heinrich gehörte.
Mit diesem Schreiben und einer kleinen Handtasche, die mir Erwin samt Waschlappen, Seife, Zahnbürste, Zahnpaste und einem kleinen Handtuch geschenkt hatte, ging ich am folgenden Tag zum Bahnhof, um den Zug nach Görlitz zu nehmen. Beim Vorzeigen dieses Schreiben mit dem Gauleiter im Briefkopf wie im Stempel wurde ich an den Kontrollen mit dem größten Respekt und der größten Zuvorkommenheit behandelt. Ich reiste im Luxuswaggon der Goldfasane und hohen Offiziere mit den Totenköpfen an den Mützen mit allen Annehmlichkeiten des bequemen Sitzens, der freien Selbstbedienung mit heißen und kalten Getränken bis zu den Schokoladen und Salzstangen sowie allen möglichen Sorten von Zigaretten und kleinen Zigarren. Zu lesen gab es die neueste Ausgabe des Völkischen Beobachters, den ich weit aufgeschlagen vor meine Nase hielt, um bei der Fahrt nicht von Fragen der lästigen Art behelligt zu werden.
Der Zug, der mit Anbruch der Dunkelheit Breslau verließ, war ohne jegliche Unterbrechung am nächsten Morgen gegen sechs im Görlitzer Bahnhof eingefahren. Ich verließ den Zug, ohne nur einmal kontrolliert oder sonstwie belästigt worden zu sein. Mein Schreiben mit dem Gauleiter oben wie unten öffnete mir alle Türen, die für andere hermetisch verschlossen waren. So konnte ich im Bahnhof einen sauberen Waschraum mit warmem Wasser, guten Seifen, Rasierapparaten mit ungebrauchten Rasierklingen, sauber aufgestellten Rasierpinseln und Rasierseife benutzen. Zuvor machte ich von den sauberen, beheizten Toiletten Gebrauch. Nach dem Rasieren, die letzte Rasur lag einige Tage zurück, und dem Waschen konnte man das Rasierwasser benutzen, das in grünen Fläschchen abgefüllt war, die in größerer Zahl auf den Ablagen vor den breiten Spiegeln standen. Bei der letzten Kontrolle am Bahnhofsausgang wurde mir beim Vorzeigen des “braunen” Papiers in fast devoter Art mitgeteilt, dass für Reisende wie mich im Bahnhofshotel das Frühstück auf Kosten der Partei eingenommen werden kann. Ich ging in den Speiseraum des gegenüber gelegenen Hotels und bekam ein Frühstück mit zwei Spiegeleiern mit Speck, einem Butterwürfel, dänischer Marmelade und drei Weißbrotscheiben. Dazu gab es Kaffee aus türkischen Röstbohnen. Ein Kännchen mit Milch und die gefüllte Zuckerdose standen auf dem weiß gedeckten Tisch zur freien Bedienung.
Ich konnte es nicht begreifen, wie sich das Leben durch ein Schreiben der Gauleitung schlagartig zum Besseren verändert, dass da bequem gereist, sich im geräumigen Waschraum mit warmem Wasser, verschiedenen Seifen und anderen Luxusartikeln rasiert und gewaschen, das Gesicht mit Rasierwasser eingerieben werden konnte und dann auf Kosten der Partei im Bahnhofshotel das Frühstück serviert wurde, wo Dinge auf den gedeckten Tisch kamen, an die der Normalverbraucher im Traum nicht mehr dachte. Selbst Zigaretten und eine volle Schachtel Streichhölzer lagen auf einem Glasschälchen neben dem schmalen Blechbehälter mit den Zahnstochern zur freien Bedienung. Nach dem Frückstück machte ich eine kurze Tour durch die Stadt, überquerte einige Male die Brücke über die Neiße in beide Richtungen und sah, wie auch hier SA-Leute unruhig auf und ab gingen, aus ihren rohen Gesichtern in die Gesichter der Entgegenkommenden blickten, die sich vor dem Angestoßen- und Angepöbeltwerden nie sicher sein konnten. Jedes Gesicht, das ein feineres Profil hatte, lief Gefahr, als das Gesicht des inneren Feindes von den Rohgesichtern angesehen, klassifiziert und auf die rüde, braune Art belästigt zu werden, wobei die Belästigung bis in die gefürchteten Keller der Gestapo ging. Auch hier wurden auf beiden Seiten der Neiße Schützengräben ausgehoben. Die Hack- und Schaufelarbeit wurde von russischen Kriegsgefangenen und Häftlingen in blau-weiß gestreiften Jacken und Hosen unter Bewachung der SS durchgeführt. Man rechnete ganz offensichtlich mit dem Zusammenbruch der deutschen Verteidigung und dem baldigen Anrücken der russischen Panzer. An den Brückenpfeilern wurden die Dynamitladungen angebracht.
Gustav, der dritte Skatbruder in der Ambulanz, der vor dem Lazarett ausstieg und sich nach Görlitz durchschlagen wollte, fehlte jede Spur. Ich sprach mit den Eltern und versicherte ihnen, dass es Gustav lebendig bis nach Breslau geschafft hatte und dass die Eltern die Hoffnung nicht aufgeben sollten. Schließlich nahm ich den Zug nach Nisky, zu dem ich durch mein “braunes” Papier freien Zugang und die Berechtigung hatte, im Wagen der 1. Klasse zu reisen. Nach der Zugfahrt durch eine gefrorene, teils mit Eis überzogene Landschaft kam ich nach einer dreiviertel Stunde in Nisky an. Dort machte ich erst meinen Erkundungsrundgang, der erfreulicherweise weniger umhergehende und misstrauisch umheräugende SA-Leute pro Einwohner bot. Die warmen Bäder aus den heißen Quellen waren der braunen und anderen Nazi-Oberschicht vorbehalten.
Vor der Bäckerei in der Muskauer Straße stand ein Mann im verdreckten Mantel. Er war unrasiert und abgemagert. Ich kaufte ihm zwei Brötchen und zwei Stück Apfelkuchen. Er nahm es an und dankte, fragte, ob er mit mir reden könne. Ich sagte ihm, dessen Alter ich nicht schätzen konnte, dass mit mir jeder reden könne, der etwas auf dem Herzen und etwas Wichtiges zu sagen habe. Der Mann, der mit Heißhunger die Brötchen aß, fragte nach einem Spaziergang durch den Park, wo er mir seine Geschichte erzählen wolle. Ich willigte ein, und wir gingen zum Park. Er sei dem “Gelben Elend” in Bautzen entkommen, in dem er als politischer Häftling sieben Monate gesessen hatte. Er sei von seinem besten Freund denunziert worden, dem er anvertraute, dass die Nazis grausam an den Menschen handelten und Hitler den Krieg verlieren würde, weil jede Überheblichkeit vor den Fall kommt. “Dafür bin ich eingelocht worden”, sagte er und erzählte seine Geschichte: “Es war der blanke Zufall oder die unbegreifliche Menschlichkeit eines älteren Wärters, dass ich mich nach dem Verladen der Maschinenkisten in der Dunkelheit hinter dem Güterwagen verstecken und in der Nacht entkommen konnte. Den Mantel, den ich anhabe, fand ich zwischen den Gleisen, wie auch die Mütze, die Hose, die Schuhe und die Tasche.
Vom Güterbahnhof Bautzen habe ich mich in einer Woche nach Nisky durchgeschlagen. Doch nun sind meine Kräfte am Ende, denn außer den liegengebliebenen Feldfrüchten, die ich mit Steinen aus dem gefrorenen Boden losgeschlagen habe, und einigen Äpfeln, die noch an den Bäumen hingen, habe ich nichts gegessen, weder ein Brot noch eine warme Mahlzeit. An einen Schlaf war in der Kälte nicht zu denken, auch wenn ich in Scheunen und zweimal in Schweineställen übernachtet habe. Kannst du mir in meiner beschissenen Situation helfen? Ich heiße Heinz.” Da stellte mir Heinz die Frage nach dem Leben. Ich nannte ihm meinen Namen und sagte, dass ich selbst in der Bredouille stecke. Ich sagte ihm, dass ich darüber nachdenken werde, ob und wie ich ihm helfen könne. Wir verabredeten uns für den Nachmittag im Park. Da wollten wir unsere Gedanken und Pläne austauschen und die praktischen Möglichkeiten miteinander besprechen.
Ich kaufte mit den letzten Groschen ein Brot und ein halbes Stück Margarine und packte es in die Tasche zum braunen Brief mit dem Gauleiter im Briefkopf und im Stempel. Das Taschenmesser zum Schneiden und Schmieren war mit der halb leeren Zigarettenschachtel und dem Feuerzeug in der Jackentasche des gefallenen Kollegen, der nach der Massenerschießung von Zivilisten an der Straße von Lublin nach Warschau bei der Rückfahrt nach Lublin bei dem Partisanenüberfall mit anderen Wehrmacht- und SS-Leuten erschossen wurde. Zum Austausch der Gedanken und Pläne, wie zwei Leben aus der Klemme zu holen sind, war es mit Heinz nicht mehr gekommen. Er machte große Augen, als ich zur verabredeten Zeit mit dem Motorrad der Wehrmacht im Park erschien, ihm das Zeichen zum Aufsitzen gab und mit ihm die Stadt vor der Dämmerung verließ, gefrorene Feldwege durch die Oberlausitzer Landschaft fuhr und nun in der Stockfinsternis mit Heinz bei euch angekommen bin.”