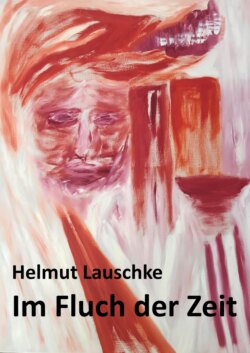Читать книгу Im Fluch der Zeit - Helmut Lauschke - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Es nimmt kein Ende
ОглавлениеWiederkunft, die ich schaue, o Wahrheit, du Überschlaue, kein Bein bringt ihr zum Schwingen, solange Kriege die Profite bringen. Du kannst sagen, was du willst, auch du, Mutter, die du dein Baby stillst, zu weit gegangen ist der Wahn, das kräht doch morgens schon der Hahn.
Keiner verlässt sich auf den Sonnenschein, wenn er zurückgelassen ist, allein in einer Hütte sitzt, dass ihm die Kehle brennt und draußen alles durcheinanderrennt, wenn dunkle Wolken blutig regnen, Kirchen Übeltäter auch noch segnen, dann braucht die Sonne nicht zu scheinen, solang vor Schmerzen Kinder weinen.
Ich frag dich nach dem letzten Abendmahl, du winkst geflissentlich: ein andermal, da ist kein Stein mehr auf dem andern, wo Trauer ist, beginnt das Wandern; das war schon bei den Griechen so und nicht anders bei den Römern überm Po, wo nicht das Wort als Schwerter sprachen, der Sieg sich maß an Toten und an Lachen.
Viel geschrieben wird von Siegen, die gegen Untergänge kleinlich wiegen; ob Pyrrhus oder Alexander der Große, stets hingen Köpfe in der Soße. Man kann sich drehen, wie man will, auf dem Planeten wird's nicht still, solange die Granaten pfeifen, schlagen, kannst du die Vernunft nicht fragen.
Eckhard Hieronymus saß auf dem Koffer mit zusammengepressten Beinen und sah aus dem Fenster. Er dachte an die Zeit in Burgstadt mit dem guten Pfarrer Altmann und dem geschwätzigen Konsistorialrat Braunfelder, der mit den kuzen fleischigen Fingern ständig am Brustkreuz rumfummelte, und dann an die Zeit in Breslau, an das Verhör im Haus der SA in der Kesselstraße, den Nachttreff mit Herrn Rauschenbach und an den paulinisch mutigen Pfarrer Kannengießer. Er dachte an den verschollenen Sohn Paul Gerhard, als er hunderte von Männern in zerlumpter Kleidung auf gefrorenem Boden mit Hacken und Schaufeln stehen und arbeiten sah, die in der Kälte riesig lange Schützengräben aushoben. Die Männer wurden von Soldaten mit umgehängten Gewehren bewacht. In Gedanken stellte sich Eckhard Hieronymus das kilometerlange Massengrab irgendwo im Osten vor, in das der Körper seines Sohnes geworfen und mit den anderen Toten zugeschüttet worden war. Männer in Zivil gefolgt von SA-Männern gingen durch den Gang. Sie schauten mit dem deutschen Blick der Gründlichkeit in die überfüllten Abteile und machten ihre ‘Stichproben’, wenn sie sich die Ausweise zeigen ließen. Einige ‘Reisende’ hatten diesen Männern zu folgen, während andere im Gang vorher in der Wagentoilette oder in Richtung des vorderen oder hinteren Waggons verschwanden. Eckhard Hieronymus sah, dass die Männer der Staatssicherheit vor den Toiletten hielten, an die verriegelte Toilettentür klopften und den Toilettenbenutzer einer eingehenden Prüfung unterzogen.
Auf freier Strecke hielt der Zuge einige Male an, um Wehrmachtzüge mit angehängten Lazarettwagen und Güterzüge mit aufgeladenen Panzern und anderem Kriegsgerät vorbeizulassen, die alle Richtung Westen fuhren. Am Nachmittag setzte ein heftiger Schneesturm ein, dass die Lokomotive Volldampf gab, um die lange Wagenkette durch das Schneegestöber zu ziehen. Die dicht wehenden Schneeflocken vereisten am Fenster. Eckhard Hieronymus rieb sich die Müdigkeit von den Augen, um sicher zu sein, dass er in dem Gestöber Menschen in verschneiter Kleidung sah, die mit Hacken und Schaufeln lange Gräben der zurückgesetzten Verteidigungslinie aushoben und dabei von gewehrtragenden Soldaten in verschneiten Mützen und Mänteln beaufsichtigt wurden. Der Wahnsinn kannte keine Grenzen und nahm auf die Menschen keine Rücksicht, das dachte Eckhard Hieronymus beim Anblick der Trostlosigkeit. Die Kontrolleure kamen noch einige Male durch den Gang, schoben mal die eine, mal die andere Abteiltür auf und verlangten nach den Papieren. Da zeigte es sich nützlich, wenn das Parteiabzeichen sichtbar getragen wurde, was viele ‘Reisende’ taten. Diese Menschen als die Opportunisten der letzten Minute hatten vor den Männern in den Ledermänteln und den SA-Uniformen nichts zu befürchten als die gemeinsame Erkenntnis, dass es mit dem braunen, hakenverkreuzten Spuk bald zu Ende sein wird, je nachdem, wie schnell die russischen Divisionen auf die zerbombte Reichshauptstadt vorstoßen. Doch bis dahin sollten die Menschen das Fürchten nicht verlernen, denn ohne die letzte Quälerei sollte der Krieg nicht zu Ende gehn.
Die Nacht hatte den Abend mit der roten Dämmerung über der verschneiten Landschaft abgelöst. Der Schneesturm hatte sich gelegt, als der Zug die Neiße überquerte und in den Görlitzer Bahnhof einfuhr. Der Lautsprecher schrillte bei der Ansage im sächsischen Tonfall: “Görlitz. Sie haben Görlitz erreicht. Der Zug nach Dresden hat einen kurzen Aufenthalt. Durchreisende haben in den Wagen zu bleiben. Reisende mit dem Reiseziel Görlitz verlassen den Zug und haben sich am Schalter ‘3’ zu melden. Halten sie die Ausweise bereit.”
Streifen patrouillierten in Uniformen mit angeleinten Schäferhunden die Bahnsteige auf und ab. Es waren nur wenige Menschen, die mit Gepäck und Kindern den Zug verließen, um in Görlitz und Umgebung zu bleiben. Alte Menschen trugen schwer an ihrem Gepäck, und Mütter führten übermüdete Kinder an der Hand oder trugen sie schlafend auf den Armen. Eckhard Hieronymus ging die Fenster der vorderen Waggons ab und fand Luise Agnes und Anna Friederike auf den Fensterplätzen einander gegenüber sitzend. Luise Agnes döste den Erschöpfungsschlaf, und Anna Friederike schlief, beide mit seitwärts gedrehten Köpfen. Er klopfte gegen das Fenster. Luise Agnes öffnete die Augen und dann das Fenster. “Seid ihr kontrolliert worden?”, fragte Eckhard Hieronymus mit Sorge um Frau und Tochter. “Nein, hier war keiner, der nach den Ausweisen verlangt hat”, sagte sie. Eckhard Hieronymus war erleichtert und sagte, dass die nächste Station Bautzen sei, wo sie aus dem Zug zu steigen hätten. Luise Agnes hatte es verstanden. Sie gab ihm die Dose mit den restlichen Marmeladenbroten durchs Fenster und sagte: “Du musst auch etwas essen.” Er ging mit der Brotdose zu seinem Waggon zurück, bahnte sich den Weg durch die Menschen im Gang und setzte sich auf den Koffer. Er aß die restlichen Schnitten und sah durchs Fenster, wie die Streife zwei Männer, die schon im vorgerückten Alter waren, vom Bahnsteig abführten, den einen mit Handschellen, den anderen ohne. Ihnen folgten drei Männer, einer im dunkelgrünen Ledermantel und zwei in den braunen Uniformen der SA. Die Wagenkette ruckte, als die Lokomotive mit dem aufgefüllten Tender angekoppelt wurde. Wieder schrillte der Lautsprecher, als die Stimme im sächsischen Tonfall das Schließen der Türen (“Dieren schliesen”) befahl. Es vergingen einige Minuten des Wartens, während über den Bahnsteig Männer in dunklen Ledermänteln Richtung Zugende gingen, gefolgt von einem Rudel gestiefelter Rohgesichter in den braunen Uniformen. Die Koppeln schlugen an, die Waggons ruckten, und der Zug setzte sich in Bewegung.
Das letzte Stück der Nachtfahrt ging durch die verschneite Oberlausitz, die mit ihren kleinen Dörfern vom Halbmond märchenhaft beleuchtet wurde. Es war gegen vier Uhr morgens, als der Zug im Bautzener Bahnhof einfuhr. Die Bremsen rieben hart, dass die Räder knirschten und quietschten. Die Waggons ruckten einige Male, bis der Zug zum Stehen kam. Aus dem Lautsprecher kam es auf sächsisch: “Bautzen. Durchreisende haben den Zug nicht zu verlassen. Reisende mit dem Ziel Bautzen können aussteigen und haben sich am Schalter ‘1’ mit ihren Pässen (“Bässen”) zu melden. In wenigen Minuten fährt der Zug über Bischofswerda weiter nach Dresden.” Eckhard Hieronymus bahnte sich mit Koffer und Tasche den Weg zum Ausgang. Mehr Menschen als in Görlitz verließen den Zug. Auch hier waren es Familien mit Kindern und alten Menschen, die sich mit dem Gepäck der letzten Habe auf dem Bahnsteig versammelten. Wie in Görlitz und Liegnitz patrouillierten uniformierte Streifen mit finster blickenden Gesichtern, angeleinten Hunden und umgehängten Gewehren die Bahnsteige in beiden Richtungen ab. Bahnhof und Bahnsteig waren für die lange Wagenkette zu kurz. Lokomotive und die beiden ersten Wagen standen außerhalb des Bahnhofs, was das Aussteigen erschwerte. Freundliche Männer halfen alten Menschen und Müttern mit ihren Kindern und dem Gepäck aus den vorderen Wagen. Sie griffen unter die Arme und hoben die, die es allein nicht schafften, vom unteren Trittbrett herunter und trugen ihnen die kleinen Kinder und die Koffer mit der letzten Habe zum Bahnsteig hinterher.
Es versammelten sich die Schlesier doch in großer Zahl auf dem Bahnsteig, als die sächsische Stimme durch den Lautsprecher zum Schließen der Türen rief und die Lokomotive mit dicken Dampfsäulen in die Luft die lange Wagenkette aus dem Bahnhof heraus zog. Eckhard Hieronymus nahm noch einmal Gelegenheit, die Fenster des angehängten Lazarettwagens zu betrachten, aus denen die Verwundeten mit Kopf-, Schulter- und Armverbänden verzweifelt und hoffnungslos blickten. Die triste Beleuchtung des Bahnsteigs tat das ihre, um die blassen jungen Gesichter alt aussehen zu lassen, als seien aus Kindern nach wenigen Wochen und Monaten verbrauchte, hilflose Greise geworden. Eine Streife forderte die ‘Bautzener’ zum Verlassen des Bahnsteigs auf. So gingen die Menschen, es waren bald hundert schlesische Flüchtlinge, durch die auch hier bewachte Sperre zum Schalter ‘1’. Sie stellten sich in die Reihe und hielten die Pässe und sonstigen Ausweispapiere in den Händen. Der Beamte in grauer Jacke hinter dem Schalter drückte nach kurzer Dokumentbetrachtung den Aufenthaltsstempel ‘Bautzen’ mit den gekreuzten Haken im Zentrum des Rundstempels und dazu den Datumsstempel in die Pässe und auf die Papiere. Dann gingen die ‘Bautzener’ in den Wartesaal, um von dort die Toiletten aufzusuchen und sich über den Waschbecken die Hände zu waschen, die Zähne zu putzen und mit dem feuchten Lappen über die Müdigkeit der Gesichter zu fahren.
Es war noch dunkel, und draußen hatte es gefroren. Der Bahnhofsplatz war von einer dünnen Schneeschicht überzogen, als Eckhard Hieronymus zum trüb erleuchteten Telefonhäuschen ging und das abgegriffene Telefonbuch holte, um mit Luise Agnes im Wartesaal nach den Telefonnummern der örtlichen Dorfbrunners zu suchen. Zwei Dorfbrunners standen im Telefonbuch, von denen einer eine vierstellige und der andere eine dreistellige Nummer hatte. Eckhard Hieronymus schrieb die Nummern auf einen Briefumschlag und brachte das Telefonbuch zum Telefonhäuschen zurück. Einspännige Pferdedroschken fuhren auf dem verschneiten Bahnhofsplatz auf, und die Kutscher warfen graue Decken über die Rücken magerer Pferde. Zwei Nahverkehrszüge liefen nacheinander ein und brachten Menschen aus den umliegenden Dörfern, die in Schulen, der Verwaltung und in Fabriken arbeiteten. Zwischen sieben und acht Uhr erschien der Wagen, um die ‘Hoyerswerdaer’ abzuholen. Der Neffe holte den Sack mit Holz vom Dachträger und warf einige Holzscheite in den Heckzylinder des Holzvergasers. Dann hievte er die schweren Koffer auf den Träger, wo der Sack mit den verbliebenen Scheiten noch dazukam, und verschnürte das Dachgepäck mit Stricken am Traggestänge. Es gab einen herzlichen Abschied mit dem Versprechen, in Kontakt zu bleiben. Voll beladen verließ der Hoyerswerdaer Wagen den gefrorenen Bahnhofsplatz. Die Räder drückten frische Reifenspuren in die dünne Schneedecke.
Es war neun Uhr vorbei, als Eckhard Hieronymus von seinem ersten Erkundungsgang durch die Stadt zurückkehrte. “Eng ist es hier. Bautzen lässt sich mit Breslau nicht vergleichen. Da fehlt dieser Stadt doch das Profil der Öffnung und der Weite”, sagte er, und Luise Agnes hörte den Unterton der Enttäuschung heraus. Sie gingen zum Telefonhäuschen, um den Kontakt mit den beiden Dorfbrunners am Ort aufzunehmen, während Anna Friederike im Wartesaal blieb und in ihrem “Wallenstein” las. Luise Agnes zog die Tür des Telefonhäuschens hinter sich zu, und Eckhard Hieronymus holte den Briefumschlag mit den Telefonnummern aus der Brieftasche und legte ihn auf das abgegriffene Telefonbuch auf der Ablage. “Du siehst an den kurzstelligen Nummern, dass Bautzen eine Kleinstadt ist”, sagte sie. “Mit welchem Dorfbrunner fangen wir an?”, fragte er, und Luise Agnes schlug den mit der vierstelligen Nummer vor.
Eckhard Hieronymus nahm den Hörer von der Gabel, schob die Zehnpfennigmünze durch den Schlitz, die mit lautem Geklapper in den Kasten fiel, und drehte die vierstellige Nummer. Nach dem dritten Klingelton sagte eine rauhe Männerstimme “Standortkommandantur Ost”. Eckhard Hieronymus erschrak und glaubte sich verwählt zu haben. Er war im Begriff den Hörer einzuhängen, als die Stimme am anderen Ende “Hallo! Wer ist da?” rief. “Hier spricht Dorfbrunner, kann ich mit Herrn Dorfbrunner sprechen?”, antwortete Eckhard Hieronymus verdattert. Der Mann am anderen Ende: “Obersturmführer Dorfbrunner ist in einer Besprechung. Er hat mir aufgetragen, nicht gestört zu werden. Sind Sie ein Verwandter, weil Sie sich mit demselben Namen nennen?” Eckhard Hieronymus: “Die Verwandtschaft nehme ich an, weil es so viele Dorfbrunners nicht gibt.” “Auch Kaltenbrunners gibt es nicht viele”, sagte der Mann am anderen Ende und gab einen Lachstoß von sich. Dann sagte er: “Wenn Sie auch ein Dorfbrunner sind, dann warten Sie mal. Ich versuche den Obersturmführer zu erreichen.” Eckhard Hieronymus schob ein weiteres Münzstück durch den Schlitz und wartete mit dem Gesicht der Verunsicherung.
“Dorfbrunner hier”, sagte plötzlich eine resolute Stimme. “Auch hier ist Dorfbrunner im Telefonhäuschen am Bahnhof”, erwiderte Eckhard Hieronymus. “Sind wir miteinander verwandt?”, fragte der Dorfbrunner vom Ort. “Wenn ihre Vorväter aus dem Dorf Pommritz kommen, dann sind wir blutsverwandt”, erklärte Eckhard Hieronymus. Der Dorfbrunner am anderen Ende: “Mein Großvater hatte in Pommritz den Hof geführt, der noch immer von den Dorfbrunners geführt wird. Das ist ja eine komische Überraschung. Und woher kommst Du?” “Ich komme aus Breslau” “Was aus Breslau? Da hat es die Dorfbrunners auch nach Schlesien verschlagen.” “Der Stammbaum der Dorfbrunners wurzelt tief in Pommritz. Er ist einige hundert Jahre alt und in seiner Krone weit verzweigt.” “Mann, das hast du aber gut gesagt. Du bist wohl ein Akademiker?” “Einer von der Kirche.” Der andere Dorfbrunner lachte: “Das hat den Dorfbrunners noch gefehlt, ein Akademiker für den lieben Gott.” “Und was bist Du?”, fragte Eckhard Hieronymus. Der andere Dorfbrunner lachte noch immer: “Weder das Eine mit dem Akademiker, noch das Andere für den lieben Gott.” Nach kurzer Pause sagte er: “Du telefonierst vom Bahnhof aus. Ich meine, dass das Telefonat uns Grund gibt, ein Glas Champagner auf das Blut der Dorfbrunners au trinken. Ich schicke einen Wagen, der dich abholt, damit sich diese beiden Dorfbrunners mal gegenüberstehen.” Eckhard Hieronymus: “Ich habe noch Frau und Tochter und drei große Koffer dabei.” Der andere Dorfbrunner: “Das Auto ist groß genug. Da passt ihr alle samt Koffer rein. Sagen wir zehn Uhr.” Damit war das Gespräch mit dem vierstelligen Dorfbrunner beendet. Eckhard Hieronymus hängte den Hörer ein und bat Luise Agnes um einen kurzen Spaziergang. Dabei drückten beide ihre Verwunderung aus, dass es einen Dorfbrunner bei der SS gibt.
Nach der vierten Runde um den Bahnhofsplatz, auf dem nun die Pferdedroschken kamen und gingen, ging Eckhard Hieronymus mit Luise Agnes wieder zum Telefonhäuschen, um den zweiten Dorfbrunner mit der dreistelligen Nummer anzurufen. Der Hörer war abgenommen, und die Münzen waren eingeworfen, als Eckhard Hieronymus die drei Nummern mit der Wählscheibe drehte. Beim achten oder neunten Klingelzeichen wurde der Hörer am anderen Ende abgenommen. Eine ältere Frauenstimme sagte “Dorfbrunner in Pommritz”, und Eckhard Hieronymus erwiderte: “Hier ist auch Dorfbrunner.” Darauf legte die Frau den Hörer auf, und Eckhard Hieronymus probierte es noch einmal. Nach dem Leerzeichen wählte er die drei Nummern, und das Klingelzeichen ging durch. Nach dem dritten Klingelton meldete sich wieder die Frauenstimme mit “Dorfbrunner in Pommritz.” Eckhard Hieronymus wollte nun nicht den gleichen Fehler machen. Er unterließ es, seinen Namen zu sagen, sondern fragte, ob er mit Herrn Dorfbrunner sprechen könne. “Wer sind Sie?”, fragte die Frau. “Ich bin Eckhard Hieronymus Dorfbrunner aus Breslau.” “Wer sind Sie?”, fragte die Frau noch einmal, und Eckhard Hieronymus sagte noch einmal seinen Namen und die Herkunft. “Sie sind auch ein Dorfbrunner? Dann rufen Sie aus Bautzen an?”, fragte die alte Stimme. “Ja, ich bin der Breslauer Dorfbrunner und rufe aus Bautzen von der Telefonzelle am Bahnhof an” erklärte Eckhard Hieronymus. Die alte Stimme: “Was sagen Sie? Sie sind der Breslauer Dorfbrunner?” Eckhard Hieronymus: “Das stimmt. Meine Vorfahren kommen aber aus dem Dorf Pommritz.” Die alte Stimme: “Wie bitte? Ich bin in Pommritz, bin Frau Dorfbrunner. Mein Mann ist vor drei Jahren gestorben.” Eckhard Hieronymus: “Nachträglich mein herzliches Beileid.” Die alte Stimme: “Danke, das kommt nun aber reichlich spät. Mein Sohn führt nun den Hof. Der ist im Augenblick im Schweinestall. Wenn Sie in einer halben Stunde noch einmal anrufen, dann können Sie mit ihm sprechen. Ich werde ihm sagen, dass Sie angerufen haben und der Dorfbrunner aus Breslau sind.” Eckhard Hieronymus bedankte sich und sagte, dass er dann wieder anrufen werde, und hängte den Hörer ein. Er faltete den Briefumschlag mit den Nummern zusammen, steckte ihn in die Brieftasche und verließ mit Luise Agnes das Telefonhäuschen.
Sie gingen zum Wartesaal des Bahnhofs zurück, in dem nur noch wenige Schlesier saßen und darauf warteten abgeholt zu werden. Anna Friederike war mit einem jungen Mann im Gespräch und hielt ihren “Wallenstein” in der rechten Hand. Sie gab dem jungen Mann offensichtlich eine Bemerkung, dass ihre Eltern auf sie zukommen, worauf dieser sich von ihr verabschiedete und freundlich grüßend an Luise Agnes und Eckhard Hieronymus vorbeiging und den Wartesaal verließ. “Ihr seid aber lange geblieben. Habt ihr noch mit dem lieben Gott telefoniert?”, fragte sie etwas unpässlich. “Nein, wir haben mit den beiden Dorfbrunners telefoniert, wie wir es abgesprochen hatten”, erklärte Eckhard Hieronymus und berichtete der Tochter in groben Zügen den Verlauf der Telefonate. Luise Agnes verschwand zur Toilette, als Anna Friederike dem Vater die Frage “Was nun?” stellte. Eckhard Hieronymus schaute die Tochter an, die am Gesicht des Vaters ablas, dass er die Frage nicht beantworten konnte. Sie fragte, ob sich die Familie in einem Hotel einbuchen solle. Eckhard Hieronymus erklärte, dass es noch früh am Tage sei. Er wolle das zweite Telefonat mit dem Sohn auf dem Bauernhof in Pommritz abwarten. Auch würde der andere, der erste Dorfbrunner mit der vierstelligen Rufnummer um zehn Uhr einen Wagen schicken, um sie mit den Koffern abzuholen. “Abholen wohin?”, fragte Anna Friederike. Eckhard Hieronymus zögerte etwas: “Genau weiß ich es auch nicht. Ich nehme an zur Standortkommandantur Ost.” “Was ist das denn?”, fragte Anna Friederike entsetzt. “Das muss ein Verwaltungsgebäude sein, wo dieser Dorfbrunner arbeitet, den der Mann an der Telefonzentrale den Obersturmführer Dorfbrunner nannte”, erklärte Eckhard Hieronymus. “Hört das denn überhaupt nicht auf mit diesen Führern? Das ist ja fürchterlich!” “Was ist fürchterlich, mein Kind?”, fragte Luise Agnes, die von der Toilette zurückkam und die Bemerkung von Anna Friederike aufgefangen hatte. Eckhard Hieronymus sagte im gedämpften Ton: “Nicht hier.” So wurde aus Gründen “Der Feind hört mit” von der weiteren Erörterung abgesehen.
Es war viertel vor zehn. “Wir wollen noch einmal mit Pommritz telefonieren, bevor das Auto kommt und uns abholt”, mahnte Eckhard Hieronymus und bat Luise Agnes, einige ‘1 Reichsmark’-Scheine am Fahrkartenverkaufsschalter in Groschen zu wechseln. Er ging schon zum Telefonhäuschen, in dem eine Frau so leise telefonierte, dass draußen nichts zu hören war. Sie drehte sich nach beiden Seiten um und sah Eckhard Hieronymus auf das Telefonhäuschen zukommen, worauf die Frau nach kurzer Zeit den Hörer einhängte und das Häuschen verließ. Luise Agnes eilte mit den eingewechselten Groschen herbei, und beide drückten sich ins Häuschen. Luise Agnes zog die Tür hinter sich zu, während Eckhard Hieronymus den gefalteten Briefumschlag mit den Telefonnummern aus der Brieftasche zog und auf das abgegriffene Telefonbuch legte. Er nahm den Hörer ab, Luise Agnes schob einige Groschen durch den Münzschlitz, und er drehte nach dem Leerzeichen die drei Nummern mit der Wählscheibe. Nach dem zweiten Klingelzeichen meldete sich “Eckart Dorfbrunner in Pommritz” mit einer kräftigen Stimme. Eckhard Hieronymus nannte seinen Namen und die Telefonzelle vor dem Bautzener Bahnhof.
“Guten Tag! Sie sind der Breslauer Dorfbrunner, wie mir meine Mutter sagte.” “Das ist richtig.” “Was führt Sie Bautzen?” “Die Russen, die vor Breslau stehen oder schon in die Stadt eingedrungen sind.” “Ach so, das ist ja keine gute Nachricht.” “Um die Wahrheit zu sagen, es ist eine schlechte Nachricht.” “Dann haben Sie Breslau verlassen?” “Ja, ich bin mit meiner Familie aus Breslau geflohen.” “Dann sind Sie hier als der Flüchtling Dorfbrunner aus Breslau.” “Genauer gesagt, der Flüchtling Dorfbrunner mit Frau und Tochter und drei Koffern.” “Dann sieht es für uns alle nicht gut aus.” “Das können sie so noch einmal sagen. Warum ich Sie aus der Telefonzelle anrufe, ist schlichtweg die Tatsache, dass wir weder ein Bett noch ein Dach über dem Kopf haben und seit zwei Tagen keine warme Mahlzeit hatten. Lässt sich da von ihrer Seite etwas machen; ich meine, können Sie uns helfen, unser Flüchtlingsdasein zu erleichtern?” “Da muss ich erst mit meiner Mutter reden. Von meiner Seite bestehen keine Bedenken, dem Breslauer Dorfbrunner und seiner Familie in dieser Bedrängnis zu helfen.” “Vielen Dank, das ist sehr liebenswürdig. Wie können wir verbleiben?” “Wir verbleiben als Dorfbrunners, die sich gegenseitig helfen, wenn ein Dorfbrunner in Not ist. So habe ich das von meinem Vater gelernt, der sagte, dass das Blut der Dorfbrunners das Blut der gegenseitigen Hilfe ist.” “Na, da spricht ja noch ein richtiger Dorfbrunner.” “Bleiben Sie am Apparat, ich spreche mit meiner Mutter.” Luise Agnes flüsterte, während Eckhard Hieronymus die Hand auf die Sprechmuschel hielt: “Lass uns beten, dass es klappt!”
Es trat eine längere Pause ein, und Luise Agnes warf weitere Groschen in den Münzsprecher. Nach Minuten des bangen Wartens: “Sind Sie noch dran, der Dorfbrunner aus Breslau?” “Ja, ich bin noch dran.” “Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Sie ist im Prinzip einverstanden.” “Dafür danke ich ihnen und ihrer Mutter.” “Haben Sie etwas einzuwenden, wenn wir Sie, ihre Frau und Tochter in der Scheune unterbringen? Denn so groß ist unser Haus nicht, dass wir gleich ein Zimmer für Sie einrichten können.” “Wir stellen keine Ansprüche und sind mit der Scheune mehr als einverstanden, wenn wir nur einen Platz zum Schlafen bekommen.” “Dann ist es gut. Ich werde gegen drei mit der Pferdedroschke in Bautzen sein und Sie abholen.” “Haben Sie vielen Dank für diese Menschlichkeit. Geben Sie unseren tief empfundenen Dank an ihre Mutter weiter. Sie helfen als ein Dorfbrunner einem anderen Dorfbrunner, der seine Heimat bereits verloren hat.” “Ich werde ihren Dank meiner Mutter ausrichten.” Damit war das Telefonat beendet. Luise Agnes sagte, dass die drei Breslauer Dorfbrunners Gott zu danken hätten, der die Weichen zum Verbleib in der Scheune auf dem Pommritzer Hof gestellt hatte.
Eine Turmuhr hatte die zehn Uhr geschlagen, als eine große Horchlimousine vor dem Bahnhofseingang stand. Eckhard Hieronymus fragte den wartenden Fahrer in schwarzer SS-Uniform, ob er von der Standortkommandantur Ost komme. Der Fahrer bejahte und sagte, dass er vom Obersturmführer Dorfbrunner geschickt sei, um den Namensvetter aus Breslau mit Frau und Tochter und drei Koffern abzuholen. “Der Namensvetter bin ich, und das ist meine Frau”, sagte Eckhard Hieronymus. Der junge SS-Mann stieg aus der Limousine, nahm Haltung an und grüßte militärisch, wobei die Kuppen der gestreckten Finger der rechten Hand die rechte Stirnseite berührten. “Kann ich ihnen behilflich sein?”, fragte er in freundlicher Weise, nachdem er die militärische Haltung aufgegeben hatte. Der SS-Mann folgte den beiden zum Wartesaal.
Anna Friederike blickte aus ihrem “Wallenstein” auf, als die Eltern vor ihr standen, und erschrak, als sie den Mann in der schwarzen Uniform hinter ihnen stehen sah. Ihr Gesicht erblasste wie vom Blitz getroffen. Der SS-Mann grüßte sie freundlich: “Sie lesen Schillers “Wallenstein”. Der gehörte mit “Don Carlos” zu meiner Lieblingslektüre in der Oberprima.” Zum ersten Schreck kam nun bei Anna Friederike die Verwunderung hinzu, weil sie das mit der Lektüre von einem SS-Mann nicht erwartet hatte. Eckhard Hieronymus und Luise Agnes gingen mit ihren Koffern und Taschen voraus, und Anna Friederike und der SS-Mann, der Friederikes Koffer trug, folgten. Die Koffer wurden im geräumigen Kofferraum verstaut, und der SS-Mann öffnete den Frauen die Hecktüren und schloss sie, während Eckhard Hieronymus das Einsteigen vorn allein bewältigte. Die Limousine passierte den Wachposten ohne anzuhalten und fuhr in einen großen Hof, auf dem andere Limousinen standen. Der SS-Mann führte die Breslauer in einen Raum, der mit einem Perserteppich ausgelegt und mit barocken Möbeln, einer großen, mit Gläsern gefüllten Vitrine und schwarzen Ledersesseln und einer dreisitzigen Ledercouch bestückt war. An der Wand hing das Großfoto des Reichsführers der SS in Farbe neben drei szenisch überladenen Landschaftsbildern in Öl der Dresdner Schule. Die fotografische Gegenwart des Bleichgesichtes mit den Zügen eines beengten Pedanten wirkte abstoßend. Die drei Koffer wurden vor dem Raum abgestellt.
Ein Hüne von Mann in weißem Hemd mit offenem Kragen, runtergezogenem Knoten des schwarzen Schlipses und schwarzer Uniformhose betrat den Raum und ging lachend auf Eckhard Hieronymus mit den Worten zu: “Dann bist du der Breslauer Dorfbrunner, der Akademiker für den lieben Gott.” Sie gaben sich die Hand. “Ich bin Reinhard Dorfbrunner, und das sind deine Frau und Tochter.” Eckhard Hieronymus, der einen Kopf kürzer war, stellte dem Hünen mit den blauen Augen und dem blonden Haar Luise Agnes und Anna Friederike vor. “Setzt euch! Erwin, hol den Champagner oben aus dem Eisschrank!” Erwin, der Fahrer, verließ den Raum, und die Dorfbrunners verteilten sich auf die Sessel, und Luise Agnes und Anna Friederike setzten sich auf die Couch. “Wie hast du so schön wie ein rechter Akademiker gesagt: Der alte, mehrere hundert Jahre alte Stammbaum der Dorfbrunners wurzelt tief in Pommritz. In seiner Krone ist er weit verzweigt. So sitze ich nun dem Breslauer Dorfbrunner mit Frau und Tochter gegenüber, von dem ich in meinem Leben noch nie etwas gehört habe.”
“Wenn ein Baum so alt ist, und die verzweigten Äste so weit ausladen, ist es doch für einen Dorfbrunner unmöglich, alle anderen Dorfbrunners zu kennen”, erwiderte Eckhard Hieronymus. Der Hüne Dorfbrunner lachte: “Dann kann es auch sein, dass wir in Südamerika Verwandte haben. Nach denen sollten wir suchen und mit ihnen Kontakt aufnehmen, damit wir wissen, wo wir hingehen können, wenn es hier zu brenzlig wird.” Der SS-Offizier brachte die Flasche gekühlten französischen Champagner. Er holte vier Sektgläser aus der Vitrine und stellte sie auf den Klubtisch. Der Obersturmführer öffnete die Sektflasche mit Bravour, ließ den Korken gegen die Decke knallen, sagte lachend: “der schoss ja in die Luft wie eine V-Rakete nach London”, und füllte die Gläser. Im Nachgang sagte er: “Da war Power hinter. Die könnten wir jetzt gut gebrauchen, um die russischen Panzer wie Fliegen abzuknallen.”
Da legte sich sein Lachen. Die Breslauer sahen auf die Gläser und folgten den eigenen Gedanken. “Prost! Trinken wir auf die Dorfbrunners, auf den alten Stammbaum mit den tiefen Wurzeln in Pommritz und auf ihr dickes Blut!” Der Hüne Dorfbrunner leerte sein Glas und füllte es nach: “Sag mal, du Breslauer Dorfbrunner, du hast ja bei deinen Vornamen noch einen Heiligen drin, ich meine den Hieronymus. War denn dein Vater auch schon ein Akademiker für den lieben Gott?” “Von Beruf nicht. Er war Studienrat für Geschichte und Geographie.” Der Hüne blickte zum Namensvetter und griff nach dem Sektglas: “Das hört sich schon besser an. Ich hatte auf der NAPOLA in Grimma auch einen Lehrer Dorfbrunner, der Deutsch und Geschichte unterrichtete. Er war durch seine unerbittliche Strenge gefürchtet.” “Dann warst Du auf der Schule, die früher die Fürstenschule war, in die auch Lessing ging.” “Welcher Lessing?” “Der Kamenzer Gotthold Ephraim Lessing.” “Ach der. An den kann ich mich noch dunkel erinnern, weil wir in der Oberstufe dessen ‘Nathan’ lasen und ihn im Klassenaufsatz unter dem Thema: “Die Profitsucht der Juden und das arbeitende deutsche Volk” zu interpretieren hatten.” “Er war immerhin ein großer Dichter”, fügte Eckhard Hieronymus hinzu. Darauf erwiderte der Hüne Dorfbrunner: “Das kann ich nicht beurteilen. Dafür fehlt mir der Vergleich. Was ich dir aber sagen kann, dass ein Dichter, der den Nathan auf einen so hohen Stuhl setzte und selbst den Ephraim im Vornamen hatte, arisch nicht rein war. Zugegeben, dass zu seiner Zeit, es war das frühe achtzehnte Jahrhundert, stimmt’s?”, Eckhard Hieronymus nickte, “die Kenntnis über die Notwendigkeit der völkischen Rassentrennung unter Beachtung der hygienischen Gesichtspunkte noch nicht so weit vorangeschritten war.”
Luise Agnes machte einen betrübten Blick, und Eckhard Hieronymus gab den Blick der Entschuldigung zurück. Der Hüne Dorfbrunner nahm nun den Namenvetter ins Visier: “Sag mal, du Breslauer Akademiker für den lieben Gott mit dem Heiligen im Namen, war es nicht schwer, bei den Menschen für den lieben Gott zu werben?” Eckhard Hieronymus spürte die sarkastische Spitze: “Was meinst Du, für den lieben Gott werben? Du weißt es doch, so alt der Stammbaum der Dorfbrunners ist, so lange wissen seine Namensträger, dass der liebe Gott keine menschliche Werbung braucht. Darauf ist er nicht angewiesen. Angewiesen ist dagegen der Mensch auf seinen Trost und seine Gnade und das auch, als in Breslau die ersten russischen Panzergranaten einschlugen und wir im Zug saßen und darauf warteten, dass er den auf die Stadt gerichteten Kanonenrohren noch rechtzeitig davonfuhr.” Hüne Dorfbrunner machte ein beklommenes Gesicht. Waren doch die Fakten stärker als die hakenkreuzige Propaganda der hitlerisch gestiefelten Schwell- und Schreiköpfe mit den hinterher marschierenden stumpfgesichtigen braunen und andersartig uniformierten Kolonnen.
Als das Gespräch unter den Dorfbrunners auf die wehrlosen Menschen und die Brutalität des Systems einzumünden drohte, schaute der Obersturmführer auf die Uhr und zog die ‘Notbremse’: “Ihr habt doch lange nicht mehr vernünftig gegessen. Ich lade euch zum Mittagessen ein. Es ist schon ein Uhr vorbei. Wir müssen uns beeilen. Heute gibt es Ochsenschwanzsuppe und Schweinskotelett mit Bratkartoffeln und Gemüse. Die gute deutsche Küche ist uns doch noch geblieben. Trinken wir auf die Dorfbrunners und ihr dickes Blut!” Der Hüne leerte sein drittes Glas, während die Breslauer mit den leeren Mägen noch beim ersten Glas saßen. “Lasst uns den Rubikon überschreiten und zum Speiseraum gehn”, sagte er und erhob sich aus dem Sessel, wobei die Hünenhaftigkeit zur vollen Geltung kam. Reinhard Dorfbrunner ging voraus, und die Breslauer folgten. Sie betraten den Speiseraum, wo von den sechs Tischen einer für den Obersturmführer und seine Gäste reserviert war. An den fünf anderen Tischen saßen die SS-Männer, an einigen Tischen in Gesellschaft junger aufgeputzter Frauen in weißen Blusen und schwarzen Röcken. Der Obersturmführer wurde beim zügigen Vorbeigang an den Tischen von seinen Leuten respektvoll gegrüßt. “Na Jungens, schmeckt es heute?” Wie auf Kommando kam es im Chor: “Jawoll, Obersturmführer, heute schmeckt es gut!” “Dann ist es gut, denn ich kann euch nicht sagen, wie lange es noch schmecken wird.” Die jungen SS-Leute, von denen einige die Gesichter unerfahrener Jungen hatten, die gestern noch bei der Hitlerjugend waren und ihr Kriegsabitur abgelegt hatten, lachten, als hätten sie vor den anrückenden russischen Armeen keine Angst.
Obersturmführer Dorfbrunner bat die Gäste Platz zu nehmen und half den Damen auf die Stühle. “Was trinken wir? An Weinen kann ich euch einen Chablis, Jahrgang 40, einen würzigen Traminer, Jahrgang 39, einen Beaujolais, Jahrgang 41, und einen Cabernet Sauvignon, Jahrgang 42, anbieten. Wenn ihr Biertrinker seid, dann könnt ihr wählen vom Radeberger Pils über Düsseldorfer Alt bis zum Pilsener Urpils.” Die Breslauer schauten sich sprachlos an, weil sie weder das eine noch das andere kannten. Aus der Küche, die eine Hotelküche war, wurde die Ochsenschwanzsuppe serviert und ein Körbchen mit Weißbrotscheiben auf den Tisch gestellt. Eckhard Hieronymus sagte dem Namensvetter, dass sie weder Bier- noch Weintrinker seien, weil diese Getränke für sie nicht zu haben waren. Der Hüne Dorfbrunner erwiderte: “Hier könnt ihr sie haben, und ihr seid meine Gäste. Ich freue mich, mit dem Namensvetter aus Breslau, seiner Frau und hübschen Tochter zu speisen. Ich schlage vor, dass wir mit dem Urpils beginnen.” Er bestellte das Bier. Umgehend wurden die Biergläser auf den Tisch gestellt und aus dem Barschrank vier eisgekühlte Flaschen vom Pilsener Urpils gebracht.
Die Ochsenschwanzsuppe war für die Breslauer eine Delikatesse. Seit Jahren hatten sie so etwas nicht gegessen. Sie waren noch am Löffeln, als die Serviererin, ein vollbrüstiges BDM-Mädchen von etwa zwanzig mit weißer Schürze über der braunen Bluse und dem schwarzen Rock den vom Obersturmführer geleerten Suppenteller vom Tisch nahm. “Prost, auf Pommritz und die Dorfbrunners!” Das volle Bierglas leerte der Hüne in einem Zug. Er war in guter Stimmung und rief in den Speiseraum: “Leute, das ist mein Namensvetter aus Breslau mit seiner Frau und Tochter. Er ist ein Akademiker und arbeitet für den lieben Gott.” Schallendes Gelächter kam von den Tischen. Einer rief: “Das ist ja ein ganz neuer Zug bei den Dorfbrunners.” Ein zweiter meinte: “Wenn die Dorfbrunners Rücken an Rücken stehen, dann kann ihnen nichts passieren; der eine hat den Führer und der andere den lieben Gott vor Augen.” Wieder gab es schallendes Gelächter. Der Obersturmführer sagte, dass aus den Dorfbrunners Generationen von Lehrern und Wissenschaftlern hervorgegangen seien, die sich ihrer Verdienste nicht zu schämen hätten. “Das haben wir auch nicht angenommen, dass sich ein Dorfbrunner für das schämt, was er getan hat”, kam es im Chor zurück, und der Obersturmführer lachte. Er war zum Spaß aufgelegt, als er sagte: “Wenn ihr mich auf die Schippe nehmen wollt, dann versohl ich euch vor den Augen meines Namenvetters und des heiligen Hieronymus die Ärsche.” Alle lachten. Ein dritter rief: “Wir lassen unsere Hosen schon runter.” Nun schüttelten sich alle vor Lachen, und der Obersturmführer lachte mit. “Aber vor den Damen wollt ihr das doch nicht tun, was?”, rief er amüsiert in den Speiseraum. Es kam im Chor: “Vor den Damen behalten wir die Hosen an.”
Die Portionen mit dem Schweinskotelett, die mit einem Spiegelei überzogen waren, und den Bratkartoffeln waren riesig. Dazu gab es gedünstetes Gemüse aus Bohnen und Möhrenwürfeln und eine mit Kirschschnaps raffinierte Lauchsoße. Es war eine Delikatesse, von der die Breslauer Dorfbrunners nicht einmal geträumt hätten. Der Hüne Dorfbrunner bestellte den Chablis, Jahrgang 40, dazu. Die Serviererin räumte die Biergläser ab und stellte die Weingläser auf den Tisch. “Fabelhaft” sagte er zum Probeschluck und fügte hinzu, dass die französischen Weine doch Spitzenweine seien. Die junge Serviererin füllte die Gläser, und der Obersturmführer hob das Glas mit den Worten: “Lasst uns anstoßen. Die Gläser sollen klingen, solange es noch was zu klingen gibt. Dabei möchte ich auf euer Wohl trinken, dass ihr es gut überstehen möget, was uns allen bevorsteht, dem keiner weglaufen kann.”
Sie stießen die Gläser mit gemischten Gefühlen an und tranken einen Wein, den die Breslauer noch nie getrunken hatten. “Sag mal, Du Gottesmann mit dem Hieronymus im Namen, habt ihr denn schon eine Unterkunft gefunden, wo ihr bleiben könnt? Ihr braucht doch sicher ein Bett zum Schlafen. Ich kann euch zwar keinen Platz im Himmel beschaffen, aber zwei Zimmer im dritten Stock des Hotels, wo Mann und Frau im Doppelbett des einen und die Tochter im Einzelbett des anderen Zimmers schlafen können. Ihr müsst doch hundemüde sein.” Eckhard Hieronymus bestätigte den hohen Müdigkeitsgrad und das Verlangen, wieder in einem Bett zu schlafen, und bedankte sich für das Angebot. Er sagte, dass er mit Eckart Dorfbrunner vom Hof Pommritz gesprochen habe, der nach Rücksprache mit der Mutter drei Schlafplätze in der Scheune angeboten hat. Darauf meinte der Obersturmführer, dass die Dorfbrunners ein gutes Herz und ein dickes Blut der Zusammengehörigkeit hätten. Er habe Eckart Dorfbrunner als einen harten Arbeiter auf dem Feld beobachtet, der den Hof nach dem Tode seines Vaters ordentlich weiterführt. “Das sind fleißige und hilfsbereite Menschen, auf die ihr euch verlassen könnt.”
Das reichliche Essen und der getrunkene Alkohol gaben den Gesichtern eine angenehme Wärme und hatten das Nervensystem belebt, was die triste Situation weniger schwer empfinden ließ. Die anderen Tische waren geräumt, als Reinhard Dorfbrunner dem Breslauer Namensvetter, seiner Frau und Tochter seine persönliche Hilfe anbot, wenn sie in der Klemme sein sollten. “Meldet euch, ich kann durch meine Verbindungen regeln, was sonst nicht zu regeln ist. Ich kann euch die Lebensmittelkarten der Sonderklasse beschaffen, wie sie die Funktionäre mit ihren Familien bekommen.” Eckhard Hieronymus bedankte sich für dieses Angebot und sagte dem Namensvetter, dass er sich melden würde, wenn er vor unlösbaren Problemen stehe. “Tu das”, ermunterte dieser ihn, “denn heutzutage kann kaum noch etwas erreicht werden, wenn die nötigen Verbindungen fehlen.” Sie erhoben sich von ihren Plätzen und verließen den Speiseraum. Hüne Dorfbrunner rief den Adjutanten, die Koffer wieder einzuladen und die drei Breslauer zum Bahnhof zu fahren. Sie verabschiedeten sich, und die drei bedankten sich für das üppige Mahl und das Angebot der Hilfe.