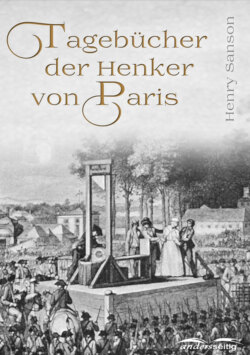Читать книгу Tagebücher der Henker von Paris - Henry Sanson - Страница 5
1. Band Einleitung
ОглавлениеAm 18. März 1847 kam ich ermüdet und erschöpft von einem jener langen Spaziergänge nach Hause zurück, bei welchen ich die abgelegensten Gegenden aufsuchte, um dort meine düsteren Träume und meinen fortwährend aufgeregten Geist begraben zu können. Kaum hatte ich die Schwelle des Hauses übertreten, kaum war das alte Torgitter knarrend in die verrosteten Angeln gefallen, als mir der Pförtner einen Brief übergab.
Augenblicklich erkannte ich das breit zusammengefaltete Papier und das große Amtssiegel, bei dessen Anblick ich stets vor Schrecken und Schmerz erbebte. Zitternd griff ich daher nach der Botschaft und erwartete darin einen jener fürchterlichen Befehle zu lesen, welchen zu gehorchen mein furchtbares Amt mir zur Pflicht machte.
In meinem Arbeitszimmer angelangt, löste ich verzweiflungsvoll das verhängnisvolle Siegel, welches irgendeinen Auftrag zur Todesvollstreckung einschließen sollte; nachdem ich aber den Brief geöffnet, las ich – meine Entlassung!!!
Ein ganz sonderbares und unerklärliches Gefühl bemächtigte sich nun meiner Person. Ich wandte meine Augen den Bildnissen meiner Ahnen zu; ich ließ meinen Blick über alle diese düsteren, nachdenklichen Gesichter hinschweifen, auf denen man den nämlichen Gedanken las, der auch mein Dasein bisher niedergedrückt und geschändet hatte.
Ich betrachtete meinen Großvater, im Jagdanzuge, melancholisch auf sein Gewehr gestützt und mit der Hand seinen Hund liebkosend, vielleicht den einzigen Freund, der ihm vergönnt gewesen.
Ich sah ebenfalls nach dem Bilde meines Vaters hin, welcher in Trauerkleidung gehüllt, die er nie ablegte, den Hut in der Hand, ernst dastand.
Es schien mir, als ob ich alle diese stummen Zeugen davon in Kenntnis setzte, dass endlich jenes unselige Verhängnis, das auf ihren Geschlechtern gelastet, sein Ende erreicht und ich sie gleichzeitig meinem Beginnen beigesellte. Ich zog die Klingel, ließ mir ein Waschbecken und reines Wasser bringen, und hier – allein, ohne Zeugen, vor Gott, der bis auf den Grund des Herzens und bis in die innersten Falten des Gewissens sieht – wusch ich feierlich meine Hände, welche fortan von dem Blute meiner Mitmenschen nicht mehr besudelt werden sollten.
Dann verfügte ich mich nach dem Gemache meiner Mutter, einer armen und heiligen Frau: denn auch wir fanden Frauen!
Ich glaube sie noch vor mir zu sehen in ihrem alten, mit Utrechter Samt überzogenen Lehnstuhl, aus welchem sie sich nur noch mit Mühe emporrichten konnte. Ich legte den mir von dem Justizminister gewordenen Bescheid auf ihre Knie nieder. Sie durchlas ihn, und ihre freundlichen Augen, aus denen ich so oft meine ganze Kraft und meinen Mut geschöpft hatte, mir zuwendend, sagte sie:
»Gesegnet sei dieser Tag, mein Sohn! Er macht dich frei von der blutigen Erbschaft deiner Väter; in Frieden wirst du den Abend deines Lebens genießen, und vielleicht wird die göttliche Vorsehung es bei diesen Gaben nicht allein bewenden lassen ...«
Und da ich, fast erstickt von Aufregung, in welcher die Freude endlich durchzubrechen begann, stets in Schweigen verharrte, fügte sie hinzu:
»Übrigens musste es wohl ein Ende nehmen. Du bist der letzte Spross deines Geschlechtes. Der Himmel hat dir nur Töchter gegeben; ich habe ihm stets dafür gedankt.«
Bereits am folgenden Morgen stritten sich achtzehn Bewerber um meine blutige Verlassenschaft, und ihre Bittschriften, mit den höchsten Empfehlungen versehen, liefen in den ministeriellen Vorzimmern von Hand zu Hand.
Man sieht, meine Ersetzung verursachte keine Schwierigkeiten. Was mich selbst betrifft, so war mein Entschluss bald gefasst. Ich beeilte mich, jenes von so traurigen Andenken bevölkerte Haus, wo sieben Generationen der Meinigen, in Schmach und Schande eingepfercht, ihre Tage verlebt hatten, ebenso meine Pferde, meine Equipage, auf welcher sich als Wappenschild eine zersprungene Glocke1 befand, zu verkaufen. Mit einem Worte, ich entfernte alles, was ein Andenken an die Vergangenheit unterhalten oder erwecken konnte. Ich schüttelte den Staub von den Füßen und verließ jene erbliche Wohnung, wo ich, wie meine Ahnen, weder den Frieden des Tages noch die Ruhe der Nächte hatte genießen können. – – –
Seit zwölf Jahren bin ich nun unter erborgtem Namen an diesem Orte wie begraben und genieße hier mit geheimgehaltener Schande Freundschaften, die zu usurpieren ich mir zum Vorwurf mache und welche ich durch die Entdeckung meines Inkognitos zu verlieren jeden Augenblick fürchten muss. Außerdem wage ich für meine Person nicht, etwas anderes zu lieben als einige Tiere, Gefährten meiner Einsamkeit, denen ich – man verzeihe mir diese Empfindsamkeit – eine um so zärtlichere Sorgfalt widme, als ich mein Gewissen darüber zu beschwichtigen suchte, den Schrei der Menschlichkeit erstickt zu haben, wenn es sich um meine Nebenmenschen handelte.
Eitle Vorsicht unserer ärmlichen Weisheit! Gerade in dieser Zurückgezogenheit, wo ich allem, selbst meinen Erinnerungen entfliehen wollte, gerade hier fühle ich sie wieder aufleben und mich mit ihrem ganzen Gewicht niederdrücken! Hier nun, als sechzigjähriger Mann, des Lebens müde, dessen Süßigkeiten ich nie ohne Beimischung von Bitterkeit gekannt, habe ich der sonderbarsten und dennoch so naheliegenden Versuchung, die sich meines Geistes bemächtigen konnte, nachgegeben:
Ich rief mir die Reihe von Ahnen ins Gedächtnis, unter welchen selbst ein Kind von sieben Jahren nicht hatte Gnade finden können. Mein Urgroßvater, Karl Johann Baptiste Sanson, geboren zu Paris am 19. April 1719, folgte seinem Vater am 2. Oktober 1726 im Amte, und da es nicht möglich war, dass ein Kind in solchem Alter persönlich das furchtbare Amt vollziehe, zu dem es berufen war, so gab ihm das Parlament einen Stellvertreter namens Prudhomme; ausdrücklich wurde aber dabei bestimmt, dass es den Hinrichtungen beizuwohnen habe; durch seine Anwesenheit wurde der Akt erst gesetzlich bestätigt. Ist diese Minderjährigkeit und diese Regentschaft in der Geschichte des Schafotts nicht ein der Betrachtung werter Gegenstand?
Ich dachte an meinen Großvater, der zu jener Zeit, für die das Wort »Schrecken« ein viel zu sanfter Ausdruck zu sein scheint, gezwungen war, das bluttriefende Beil an die edelsten wie an die strafbarsten Häupter zu legen, ohne dass ihm jener Abscheu vor dem Verbrechen oder jene Verachtung des Opfers verblieben wäre, welche in mir nie den Schrei des Herzens zu ersticken vermochten.
Indem ich die sonderbaren Jahrbücher, die ich selbst fortgeführt und welche mit der Chambre ardente beginnen, um über die Saturnalien der Regentschaft und der Regierung Ludwigs XV. hinweg bis zur Revolution und endlich bis zu unserem Jahrhundert zu gelangen, eifrig studierte und in denselben einem Durcheinander der berühmtesten und verachtetsten Namen begegnete, fragte ich mich, ob hier nicht die Elemente zu einem Buche vorhanden seien und ob die Sorgfalt, es zu schreiben, nicht die beste Verwendung sei, die ich von den Tagen meines Alters machen könnte.
Gott behüte mich vor dem Gedanken, dass ich, wie andere glauben konnten, je die Absicht gehabt hätte, der Guillotine eine Schutzrede zu halten oder die Rehabilitierung des Scharfrichters zu versuchen! Eher wäre meine Hand vertrocknet, als dass sie ein Werk versucht hätte, welches meiner innersten Überzeugung zuwiderläuft.
Der Grund, der mich mit der Feder bewaffnete, ist die große zur Zeit vor dem Gerichtshofe der Zivilisation anhängige Sache, zugunsten derer so viele beredte Stimmen seit Montesquieu, Beccaria, Filangieri bis auf Viktor Hugo sich haben hören lassen, um die Abschaffung jener unversöhnlichen Züchtigung zu verlangen, deren leibhaftige Personifizierung zu sein ich das Unglück gehabt.
Wenn man mich fragen wollte, wie ich mit derartigen Gefühlen so lange Zeit die mir erblich zugefallenen Dienstverrichtungen habe fortsetzen können, so habe ich einfach zu erwidern: »Man darf nur den Blick auf die Bedingungen meiner Geburt richten.«
Das Schwert des Gesetzes hat sich in meiner Familie fortgeerbt wie der Degen bei den Edelleuten, wie das Zepter bei den königlichen Geschlechtern: konnte ich mir ein anderes Dasein erwählen, ohne hierdurch das Andenken meiner Ahnen zu verleugnen und das Alter meines an dem gemeinschaftlichen Herd sitzenden Vaters zu beschimpfen? Durch heilige Pflichten an den Block und an das Beil geschmiedet, musste ich die traurige Aufgabe vollziehen, welche mir meine Geburt auferlegte. Aber inmitten meiner Laufbahn, der einzige Sprössling dieser Art einer Scharfrichterdynastie, habe ich dennoch mit Freuden dem Purpur des Schafotts und dem Zepter des Todes entsagt. Möchte es mir noch vergönnt sein, eine Strafe aus unseren Institutionen verschwinden zu sehen, deren Anwendung schon jetzt immer seltener wird, die sich inmitten der Zivilisation wie das letzte Überbleibsel menschlicher Barbarei ausnimmt! Möchten in nicht langer Zeit die Leser dieser Blätter bei Schließung des Buches sagen können: »Es ist das Testament der Todesstrafe, geschrieben von dem letzten Henker!«
Sanson.