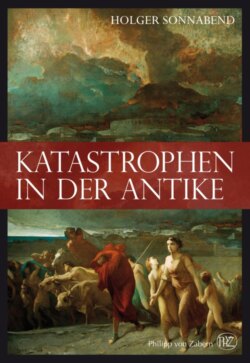Читать книгу Katastrophen in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Katastrophe von Santorin
ОглавлениеSchriftliche Quellen zu Naturkatastrophen in der Antike sind nicht frei von Tücken und Fallstricken. Indes fällt die Rekonstruktion antiker Naturkatastrophen noch schwerer, wenn keine Textquellen zur Verfügung stehen. Naturgemäß ist dies bei jenen Katastrophen der Fall, die vor der Verwendung der Schrift (bei den Griechen war dies erst seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. der Fall) stattgefunden haben. Hier schlägt dann die Stunde der Archäologen, der Geologen, der Geoarchäologen und überhaupt der Naturwissenschaftler. Sie entwickeln häufig die unterschiedlichsten Theorien und Lösungsansätze, wie das Beispiel Santorin zeigt.
Santorin, von den Griechen meist Thera genannt, ist eine der attraktivsten Inseln der Gruppe der Kykladen, deren südlichsten Teil sie zugleich bildet. Wer zum ersten Mal nach Santorin kommt und keine Gelegenheit gehabt hat, sich im Vorfeld über Geographie, Geologie und Geschichte der Insel zu informieren, staunt über ihre eigenartige Gestalt. Sie gleicht in ihrer Form einem Viertelmond oder einer Sichel. Steil ragen die Felsen nach oben, wo sich fast trotzig die Häuser der Inselstadt erheben. Die Sichel umrahmt zwei kleine Inseln, von den Griechen Palaia Kameni und Nea Kameni genannt. Beide Inseln sind Vulkaninseln und liegen in der Caldera der Vulkaninsel Santorin. Die eigenartige Gestalt von Santorin ist das Ergebnis einer nun tatsächlich gigantischen Vulkan-Eruption, durch die die Insel buchstäblich explodierte und in der Folge jene so charakteristische Form annahm.
Durch den verheerenden Vulkanausbruch im 17. Jahrhundert v. Chr. wurden große Teile der griechischen Insel Santorin (Thera) buchstäblich in die Luft gesprengt
Was diese Eruption für die damaligen Bewohner von Santorin bedeutete, lässt sich erahnen, auch wenn keine schriftlichen Berichte vorliegen. Es kann davon ausgegangen werden, dass kaum jemand die Katastrophe überlebt hat. Welche Dramen, welche Tragödien sich abspielten, bleibt völlig im Dunkeln. Ein Touristenmagnet ist die Stadt Akrotiri im Süden von Santorin. Manche sprechen gern vom „griechischen Pompeji“. Das ist in gewisser Hinsicht nicht unzutreffend, denn die Ausgrabungen in Akrotiri (das ist der moderne Name, wie die Stadt in der Antike hieß, ist unbekannt) brachten eine Stadtanlage zum Vorschein, die noch viel von dem zeigt, wie sie aussah, bevor der Vulkan ausbrach. Akrotiri zeigt aber auch die Schäden, die der Vulkan anrichtete, außerdem sind Spuren von Erdbeben zu erkennen.
Akrotiri wird gern als eine „minoische“ Stadt bezeichnet. Tatsächlich stand sie in der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. stark unter dem Einfluss der Kultur der ca. 100 km südlich gelegenen Insel Kreta. Dem Mythos zufolge war König Minos der kreative Kopf hinter der kretischen Kultur, die man zu Recht als die erste europäische Hochkultur bezeichnet. Nach Santorin strahlte der Glanz der Kreter in der Weise aus, dass sich die Bewohner von Akrotiri in Städtebau, Architektur und Kunst stark an den minoischen Vorbildern orientierten. Von der ganzen Herrlichkeit blieb indes nicht viel übrig, als der Vulkan die Insel in die Luft sprengte. Wann diese Naturkatastrophe, die ohne Frage zu den schwersten der gesamten Antike gezählt werden muss, genau stattgefunden hat, lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. In diesem Punkt weichen die Meinungen der Gelehrten nach wie vor relativ deutlich voneinander ab. Es gibt eine Frühdatierung in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts v. Chr., die unter anderem durch Bohrungen im Grönland-Eis zustande gekommen ist. Damit konkurriert die Spätdatierung, die die Katastrophe rund ein Jahrhundert später, also gegen Ende des 16. Jahrhunderts v. Chr., ansetzt. Das sind keine rein akademischen Fragen, denn die damit zusammenhängenden Aspekte sind wiederum von großer Bedeutung für den Untergang der minoischen Kultur auf Kreta. Der griechische Archäologe Spyridon Marinatos, seines Zeichens Ausgräber von Akrotiri, war der Protagonist einer Aufsehen erregenden These. Er vertrat die Ansicht, der Vulkan-Ausbruch auf Santorin habe nicht allein dieser Insel schwersten Schaden zugefügt, sondern eine riesige Flutwelle ausgelöst, die für die Zerstörung der großen Paläste auf Kreta (Knossos, Phaistos, Malia, Kato Zakros) verantwortlich gewesen sei. Das wäre dann eine Naturkatastrophe von wahrhaft gigantischen Dimensionen gewesen, wenn auf ihr Konto auch das Ende der ersten europäischen Hochkultur gegangen wäre. Jedoch spricht, neben einer gewissen sachlichen Unwahrscheinlichkeit, auch die Chronologie gegen diese These – jedenfalls dann, wenn man sich, wofür eine Menge spricht, der Frühdatierung der Santorin-Katastrophe anschließt. Die kretischen Paläste wurden nach der Mitte des 15. Jahrhunderts v. Chr. zerstört. Wenn die Eruption des Santorin-Vulkans auf ca. 1620 v. Chr. anzusetzen ist, wird man unmöglich einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen herstellen können. Die minoische Kultur auf Kreta ging wohl nicht durch eine Naturkatastrophe, sondern eher durch kriegerische Einwirkung (von Seiten der Mykener) zugrunde.
Spyridon Marinatos, der 1974 beim Einsturz einer Mauer inmitten des Ausgrabungsgeländes von Akrotiri ums Leben kam, ist auch der prominenteste Vertreter einer These gewesen, die bis heute durch die Reiseführer und die Medien geistert. Kurz gefasst lautet sie: „Santorin war Atlantis“. Genauer gesagt: Der Ausbruch des Santorin-Vulkans ist der historische Kern der Geschichte von Atlantis – jenem sagenhaften Kontinent, der durch eine große Naturkatastrophe unterging. Der griechische Philosoph Platon hat die Geschichte von Atlantis ausführlich erzählt, sie auch ausdrücklich im Meer „jenseits der Säulen des Herakles“, also westlich der Straße von Gibraltar verortet. Atlantis soll also draußen auf dem Atlantik gelegen haben – das bedeutete aus der Sicht der mediterran denkenden Griechen im Prinzip nichts anderes als „außerhalb der Welt“, mithin: nicht existent. Atlantis ist eine „Utopie“ im wahrsten Sinne dieses Wortes: ein „Nicht-Ort“. Es bedurfte zur Konstruktion dieses mythischen Szenarios auch keiner tatsächlichen Katastrophe, die als Ausgangs- oder Vergleichspunkt hätte fungieren müssen. Platons Atlantis ist gewissermaßen eine Mixtur aus unzähligen Erfahrungen mit Naturkatastrophen, wie man sie im Mittelmeerraum zur Genüge machen konnte. Der Historiker als Spielverderber – eine bekannte Rolle, die aber die Touristikbehörde von Santorin sicher nicht daran hindern wird, weiter die Glasboden-Boote mit dem Namen „Atlantis“ in die Caldera zu schicken, wo man dann à la Helike gebannt ins Meer starrt, um noch Spuren des versunkenen Kontinents zu entdecken.
Noah und seine Frau in der Arche – auf einer Münze der römischen Kaiserzeit aus Apameia Kibotos in Phrygien (auf der Vorderseite Kaiser Septimius Severus). Die Stadt war eine Hochburg der antiken Diaspora-Juden