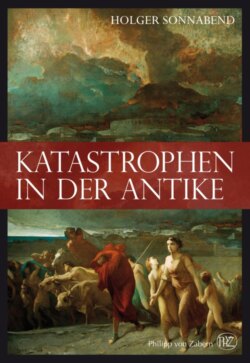Читать книгу Katastrophen in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Poseidon, der Erderschütterer
ОглавлениеWarum kam es überhaupt zu Naturkatastrophen? Für die meisten Menschen in der Antike war, wie die Fallbeispiele bereits gezeigt haben, die Antwort auf diese Frage völlig klar: Naturkatastrophen waren das Werk von Göttern. Sie wollten den Menschen auf diese Weise entweder ein Zeichen geben oder sie wollen damit eine Strafe verhängen. Als Zeichen konnten sie auf bevorstehende Umwälzungen politischer oder kriegerischer Art hinweisen, als Strafe sanktionierten sie moralische oder religiöse Verfehlungen der Menschen. In jedem Fall reagierte man, und das war bei Griechen und Römern ziemlich deckungsgleich, mit Gebeten und Opfern, auch mit ritualisierten Zeremonien. All dies diente dazu, sich mit den Göttern zu versöhnen, ihnen keinen Anlass mehr dazu zu geben, den Menschen eine schreckliche Naturkatastrophe zu schicken.
An welche Götter aber sollte man sich konkret wenden? Waren alle aus dem großen Vorrat an Göttern, den Römer und Griechen hatten, gleichermaßen verantwortlich, gewissermaßen in einer Art konzertierter Aktion? Oder gab es ganz bestimmte Götter, die als Adressaten von Opfer- und Bußhandlungen in Frage kamen, weil sie die Auslöser der Katastrophen waren? Die Christen hatten es später leichter, sie konnten sich an den einen Gott wenden (wie übrigens auch die Juden und später die Muslime). Bei den Römern herrschte einige Unsicherheit. Der antike Autor Aulus Gellius, der im 2. Jahrhundert n. Chr. lebte, hat das diesbezügliche Dilemma seiner Landsleute einfühlsam beschrieben (Noct. Att. 2,28): Die „alten Römer“, wie es der alte Römer Gellius bemerkenswerterweise ausdrückt, führten zwar brav die traditionellen Zeremonien durch, wenn es ein Erdbeben gab oder ein Erdbeben gemeldet wurde (als Vormacht in Italien pflegten die Stadtrömer immer auch die Sühnung für Katastrophen in allen übrigen römischen Gebieten mit zu übernehmen), doch waren sie sich nicht sicher, welche Gottheit denn nun zuständig war. Nicht auszudenken, was passieren konnte, wenn man sich an den falschen Gott wandte und der richtige dann beleidigt wäre. Dieser würde sich vermutlich rächen, indem er gleich eine neue Katastrophe schickte. So einigte man sich salomonisch auf eine allgemeine Formel: si deo si deae (wir opfern – „sei es einem Gott, sei es einer Göttin“).
Die Griechen machten sich das Leben nicht so schwer. Sie hatten als Verantwortlichen Poseidon ausgemacht, den sie auch mit dem Beinamen „Erderschütterer“ versahen (auf Griechisch heißt das ennosigaios). Er war sogar noch mehr der Gott der Naturkatastrophen als der Gott der Meere, als den man ihn heute meistens sieht. Die Rolle des Erderschütterers spielt Poseidon, den die Römer als Neptun kannten, bereits in den Epen Homers. So ist die Zuweisung also recht früh erfolgt. Poseidon war leicht beleidigt, deswegen musste man sich mit ihm gut stellen. Versäumnisse wurden hart bestraft, wie es beispielsweise die Bewohner der Stadt Tralleis in Kleinasien schmerzlich erleben mussten. Ihre Stadt war von einem Erdbeben heimgesucht worden. Daraufhin wandten sie sich an jene Instanz um Hilfe, die von der gesamten griechischen Welt als Auskunftsstelle in allen problematischen Lebensfragen in Anspruch genommen wurde: das Orakel von Delphi. Dieses teilte mit, dass man es versäumt habe, dem Poseidon einen Altar zu errichten und ihn durch Opfer und Hymnen zu ehren. Da habe sich der Gott missachtet gefühlt und habe der Stadt Tralleis als unfreundlichen Gruß ein Erdbeben geschickt. Die Bewohner von Tralleis achteten künftig genau darauf, die Opferhandlungen für Poseidon akkurat und regelmäßig zu vollziehen. Das scheint tatsächlich geholfen zu haben. Jedenfalls hören wir im Zusammenhang mit Tralleis seitdem nichts mehr von schweren Erdbeben.