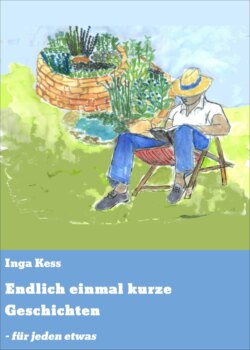Читать книгу Endlich einmal kurze Geschichten - Inga Kess - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wo fängt Armut an
ОглавлениеOutfit, Handydesign, ja selbst die Marke der Schultasche oder des Füllhalters können heute darüber entscheiden, ob ein junger Mensch seitens seiner Gleichaltrigen als Underdog oder aber als Gleichberechtigter betrachtet wird. Der Maßstab für soziale Akzeptanz unter Jugendlichen hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm verschoben. In der Frage, was und wie viel ein Kind braucht, wie Kinderarmut zu definieren ist, sind sich selbst die Politiker uneinig und feilschen um Höhe und Art staatlicher Zuwendungen.
Was Armut heißt, beantwortet sich für unsere Generation vor einem völlig anderen Erfahrungshintergrund.
Gemessen am heutigen Maßstab waren Kinder, die noch kurz vor oder während des Krieges geboren wurden, in den ersten Jahren nach dem Krieg sehr arm. Nur wussten sie dies nicht und hätten auch daher den Begriff Kinderarmut, heute ein oft gebrauchtes Schlagwort, nie für sich reklamiert, denn so ging es zahllosen Kindern, von einigen Ausnahmen abgesehen.
Viele der Kinder waren mit ihren Eltern aus Ostpreußen oder Schlesien vertrieben worden. Zwei Drittel der Kinder einer Schulklasse hatten keinen Vater mehr. Die Väter waren im Krieg gefallen. Einige Väter galten als vermisst oder waren, im günstigsten Fall, noch nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt.
Manch eine Stadt zählte vor dem Krieg rund 20.000 Einwohner, nach dem Krieg waren es über 60.000. Die einheimische Landbevölkerung war durch die Menge der Flüchtlinge, die zugewiesen wurde, nicht mehr in der Lage zu helfen. Viele hatten kaum selbst etwas. Es waren einfach auch zu viele, die da kamen. So waren die meisten Zugezogenen dankbar für einen Kürbis oder ähnliche Naturalien, für die die Frauen den ganzen Tag Kartoffeln lesen mussten, auch die Kinder halfen dabei. Damals gehörte die Kinderarbeit auch hier zur Normalität.
Eine Frau, durch den Krieg in eine Stadt verschlagen, war Kriegerwitwe mit drei kleinen Kindern. Sie war gut ausgebildet, hatte einen Beruf gelernt, was zu jener Zeit außergewöhnlich war. Vor dem Krieg arbeitete sie als Sekretärin in einem großen Industrieunternehmen. Feldarbeit überhaupt nicht gewohnt, arbeitete sie trotzdem zunächst bei einem Bauern, um die drei kleinen Kinder zu ernähren. Wie alle anderen Frauen arbeitete sie auf dem Feld, um die schmale Rente ein wenig aufzubessern. Geld gab es aber keins, nur einen Kürbis pro Tag. Die Kinder bekamen in der Regel ein paar Kartoffeln. Herbstferien, sogenannte Kartoffelferien, richteten sich nach der Kartoffelernte.
Später bekam die junge Witwe eine Arbeit bei einem Verband, der sich um Kriegsopfer kümmerte.
Die junge Frau hatte bei der Evakuierung des Ruhrgebietes fast ihren gesamten Hausrat verloren. Einen Lastenausgleich gab es für sie nicht. So ging es in der kleinen Familie recht sparsam zu.
Weder Mutter noch Kinder fühlten sich arm, denn die schrecklichen Hungerjahre während der Zeit der Besatzung durch die Siegermächte, in denen nur die Schulspeisung den Hunger linderte, waren vorbei. Die Jüngste litt noch an den Folgen einer Hunger-Tuberkulose, damals eine weit verbreitete Krankheit.
Diese Jüngste erinnert sich an ein Weihnachten direkt nach dem Krieg, als sei es gestern gewesen. An jenem Weihnachten bekam sie ein Glas Marmelade geschenkt. Immer noch sieht sie das Glas Brombeermarmelade vor sich, ein ganz großes Glas Brombeermarmelade, ganz für sie alleine. Die Freude war riesig, so dass sie die Freude voller Glück mit allen teilen wollte, mit ihrem Bruder, mit ihrer Schwester, mit ihrer Mutter. Alle ließ sie von ihrer Marmelade probieren, auch ihre beste Freundin durfte kosten - und letztendlich blieb für sie selbst kaum etwas übrig. Aber sie war glücklich und zufrieden, weil sie ein so schönes Geschenk bekommen hatte, das so groß war, dass sie es noch mit ihrer Familie und ihrer Freundin teilen konnte.
Wenige Jahre später schockte das Kind eine andere Geschichte zutiefst, so dass sie diese auch bis heute noch nicht vergessen hat.
Bettler an der Straße gehörten zum Straßenbild. Da saßen sie nun, Kriegsversehrte, Hungernde und baten um eine milde Gabe. Manchmal klingelten sie auch an der Haustüre und baten um etwas zu essen. Die Kleine war allein zu Hause, als es schellte. Ein Bettler stand an der Haustüre und erklärte, dass er schrecklichen Hunger habe und sich kein Essen kaufen könne. Von den Worten des Mannes tief berührt, lief sie hoch in die Wohnung und holte ein mit Wurst belegtes Brötchen, das sie von einer Nachbarin geschenkt bekommen hatte. Es sollte ihr Abendessen werden. Normalerweise gab es keine Brötchen. Dazu fehlte immer noch das Geld, und ein Brötchen mit Butter und Wurst gab es so gut wie nie. Doch die Kleine wusste noch zu gut, wie sich Hunger anfühlte. Schweren Herzens nahm sie deshalb ihr Brötchen und brachte es dem Mann. Dieser fragte zunächst noch freundlich: „Hast du denn kein Geld?“, worauf die Kleine sagte: „Geld kann man doch nicht es sen!“ Wutentbrannt nahm der Bettler das Brötchen und warf es in den Stadtgraben, wo sich die Enten über die Mahlzeit her machten.
Ungesehene Tränen - Anthologie zum Literaturwettbewerb Kinderarmut, Custos Verlag, Solingen, 2011