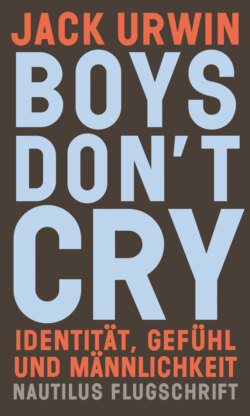Читать книгу Boys don't cry - Jack Urwin - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nach zwei Weltkriegen verändern sich ein paar Dinge …
ОглавлениеAls Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts der Prozess der Globalisierung begann, erfuhr die Welt einen Wandel bis dahin nicht gekannten Ausmaßes. Reisen und Handel zwischen den Kontinenten hatte es vorher auch schon gegeben. Hunderte von Jahren, doch ab da funktioniert die Welt wirklich als etwas mehr als eine Ansammlung individueller Staaten. Angesichts der menschlichen Natur überrascht es nicht, dass in dieser Zeit im Abstand von gerade mal zwei Jahrzehnten die ersten beiden Weltkriege ausbrachen. Auch wenn die Globalisierung an sich nicht der Auslöser für diese Konflikte war, führten die veränderten geschäftlichen Beziehungen und die wachsende gegenseitige Abhängigkeit zwischen internationalen Verbündeten fast unvermeidlich dazu, dass sehr viel mehr Länder in diese Kriege hineingezogen wurden. Das hieß natürlich, dass Großbritannien Zugriff auf mehr Menschenpotenzial hatte; die Kehrseite war, dass das auch für unsere Feinde galt.
Bis dahin hatte Großbritannien auf eine allgemeine Wehrpflicht verzichtet, doch als 1914 der Krieg ausbrach, suchte der Kriegsminister Lord Kitchener Wege, so viele Männer wie möglich dazu zu bringen, sich freiwillig zum Militär zu melden. In der Annahme, Männer wären eher bereit, ihrem Land zu dienen, wenn sie dies im Kreis ihrer Familie und Freunde tun könnten, wurden die sogenannten Pals-Bataillone aufgestellt. Diese bestanden aus Männern, die sich zusammen bei örtlichen Rekrutierungskampagnen meldeten, und sie erwiesen sich, wie der Journalist und Historiker Bruce Robinson bemerkt, als äußerst erfolgreich:
»Lord Derby war der Erste, der die Idee auf die Probe stellte, als er Ende August erklärte, er werde versuchen, in Liverpool ein Bataillon aufzustellen, das ausschließlich aus Ortsansässigen bestand. Innerhalb von Tagen hatten sich in Liverpool so viele Männer eingeschrieben, dass es für vier Bataillone reichte.
Der Erfolg in Liverpool war anderen Städten Ansporn gleichzuziehen. Das war das große Geheimnis hinter den ›Pals‹: Der Stolz der Städte und der Gemeinschaftsgeist spornten andere Städte an, miteinander in Wettstreit zu treten, wer die größte Zahl an Rekruten aufbrachte.«11
Das Ziel, die Kriegsstärke zu vergrößern, wurde erreicht, doch im ganzen Land wurden Straßen und Städte eines Großteils ihrer männlichen Bevölkerung beraubt. Als wären die Toten, die dem Feind zum Opfer fielen, nicht genug, wurden im Laufe des Krieges 306 britische Soldaten für Verbrechen exekutiert, auf die im zivilen Leben nicht die Todesstrafe stand. Bei vielen lautete die Straftat Feigheit. Heute, wo ein größeres Verständnis für psychische Gesundheit herrscht, hat sich das Wissen durchgesetzt, dass diese Männer unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litten und ihr vorgebliches Verbrechen keine bewusste Entscheidung war. Noch im Jahr 1993 weigerte sich Premierminister John Major, diese Männer zu begnadigen, indem er behauptete, sie hätten einen fairen Prozess bekommen und sie zu begnadigen hieße, jene zu beleidigen, die einen ehrenhaften Tod auf dem Schlachtfeld gefunden hatten. Die Blair-Ära brachte schließlich eine Kehrtwende, aber erst im Jahr 2006.
Noch nie zuvor hatten so viele Männer für ihr Land gekämpft. Die Männer, die den Krieg überlebten, hatte das strenge Reglement der militärischen Kultur, der sie sich hatten unterwerfen müssen, verändert. Die Hinrichtungen wegen Feigheit waren genauso sehr eine Warnung wie eine Strafe: Wer sich auch nur den kleinsten Augenblick der Schwäche erlaubt, läuft Gefahr, in der Morgendämmerung durch ein Exekutionskommando den Tod zu finden. Das wurde den Rekruten mit solcher Schärfe eingedrillt, dass die Auswirkung oft unumkehrbar war, so dass sie bei ihrer Rückkehr nicht die geringste Chance hatten, sich wieder in eine gesunde Gesellschaft zu integrieren. Zwar wurden sie als Helden bejubelt, doch von ihrer Regierung wurden sie im Stich und mit ihren körperlichen und seelischen Wunden allein gelassen.
Krieg war einmal etwas gewesen, an dem teilzunehmen britische Männer sich aus freien Stücken entschlossen, doch mit der Einführung der Wehrpflicht während des Ersten Weltkriegs und der Rückkehr dazu bei Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 markiert die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts einen beachtenswerten Wendepunkt. Die Wehrpflicht galt offensichtlich nur für Männer, denn nur Männer waren damals befähigt, in der Armee zu dienen, aber es muss hier trotzdem vermerkt werden.
Die Assoziation von Männlichkeit und Militär mag schon Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg zementiert worden sein, doch die Wehrpflicht veränderte den Blick der Gesellschaft auf Männer grundlegend, indem sie ihnen ihren freien Willen raubte und sie zwang, sich zu fügen. Mit anderen Worten, sie machte ihre Männlichkeit obligatorisch.
In dem Moment, als man die Männer der Möglichkeit beraubte zu wählen, ob sie in den Krieg zogen oder nicht, gab es einen neuen, staatlich sanktionierten Bedarf an Männlichkeit. Wehrdienstverweigerer und Pazifisten, die sich zu kämpfen weigerten, riskierten, ins Gefängnis zu gehen, aber bedeutsamer ist vielleicht, dass sie großer gesellschaftlicher Ächtung ausgesetzt waren und in den Augen mancher selbst heute noch als Feiglinge gelten. In einer Folge von Question Time im Jahr 2009 reagierte Nick Griffin (der damalige Anführer der ultrarechten British National Party) auf Anschuldigungen von Jack Straw (zu dem Zeitpunkt Justizminister), er sei ein Nazi-Unterstützer, mit dem Hinweis, sein eigener Vater habe im Zweiten Weltkrieg in der Royal Air Force gedient, während Straws Vater im Gefängnis gesessen habe, weil er »sich geweigert hatte, gegen Adolf Hitler zu kämpfen«12. Das war unleugbar eine billige Nummer, aber der Vorfall macht anschaulich, dass Wehrdienstverweigerer immer noch stigmatisiert werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass viele derer, die im Krieg kämpften, dies widerstrebend taten, doch es herrschte allgemein Einigkeit darüber, dass es schlicht die Pflicht eines Mannes war, seinem Vaterland zu dienen, und dieser Pflicht unterwarf man sich fraglos. 1960 wurde die Wehrpflicht wieder aufgehoben, doch bis dahin war sie für zwei Generationen britischer Männer Realität gewesen, und auch wenn sich die rechtliche Situation geändert hat, sind die Einstellungen, die daraus erwuchsen, so fest in der Gesellschaft verankert, dass sie noch an zukünftige Generationen weitergegeben werden.
Ich fasse mich hier kurz, denn über den emotionalen Tribut des Krieges habe ich bereits gesprochen, und auf das Militär komme ich später noch ausführlicher zurück, doch es ist wichtig: Nicht nur der Kriegsdienst war Pflicht – auch alles, was danach kam, war obligatorisch. Von den Männern wurde erwartet, mit dem Leben ganz normal weiterzumachen, und wenn es Probleme gab – insbesondere psychische –, hatten sie diese, wie alle anderen auch, klaglos durchzustehen. Weil es eine allgemeine Pflicht war, weil man nur einer von vielen war, die alle denselben Mist durchgemacht hatten, und weil man weder etwas Besonderes war noch einzigartig, war der Druck groß, es abzuschütteln, wie alle anderen es auch abzuschütteln schienen, und sich so zu verhalten wie alle anderen Männer auch. Infolgedessen betrachtete die Gesellschaft das, was unter Männern zur Norm wurde, zunehmend als männlichen Wesenszug. Männlichkeit ist im Kern schlicht ein Spiegel dessen, wie die Mehrheit der Männer agiert, und wenn ein Ereignis einen großen Prozentsatz der männlichen Bevölkerung verändert, verändert sich damit auch das, was wir als männlich erachten.