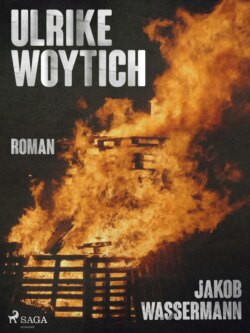Читать книгу Ulrike Woytich - Jakob Wassermann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ulrike erzählt
ОглавлениеIch bin fünfundzwanzig Jahre alt,“ fing Ulrike an, „aber ich habe so viel erlebt, als hätt ich bereits fünfzig auf dem Rücken. Man sieht mirs nicht an, ich habe zähe Knochen, und eher brech ich mir den Wirbel nach hinten, als dass ich ihn nach vorn beuge. Sollt ich aufzählen, wie oft ich auf einer Bretterdiele statt in einem ordentlichen Bett geschlafen habe, so käm eine hübsche Summe heraus, aber das Jahr ist lang, und gibts Tage, wo man die Zähne in die Faust beisst, um das Schlimmste zu überstehen, so gibts wieder andre, wo einem die Sonne auf den Scheitel scheint, und man fühlt, dass man jung ist und stark und dass man zwei Arme hat, um sich damit zu regen, und ein Paar Augen, um damit zu schauen. Ihr Nesthäkchen, wie ihr dasitzt, wisst von alledem nichts, euch wird der Braten fertig aufgetragen und die Schuhe werden euch neu vom Schuster geliefert, wenn die alten zerschlissen sind, und wenn der Wind an den Fenstern rüttelt, denkt ihr höchstens: schlecht habens die Leute, die bei solchem Wetter sich draussen plagen müssen.“
Schon nach ihren ersten Worten hatte sie langsam schleichende Schritte vernommen. Sie stellte sich aber ahnungslos, obwohl sich die Aufmerksamkeit der Zuhörer teilte und sie unbehaglich dem Geräusch lauschten, dessen Ursprung ihnen bekannt war. Dann erschien Mylius im Rahmen der Tür; unter der drohend verzogenen Stirn glommen die kleinen Augen wie zwei trübe Phosphorflämmchen; der hässliche Ingrimm, der sich in seinen Zügen ausdrückte, liess Ulrike stutzen. Mit ratloser Wut schaute er über die gelagerte Gruppe, die Lippen bebten ihm und formten Fragen, und er stiess, ausser sich, hervor: „In drei Teufels Namen, was hat der Unfug zu bedeuten? Unfug drinnen, Unfug hier.“
Ulrike, die sich unterbrochen hatte, schaute ihn ruhig an und sagte: „Jetzt rede ich. Vielleicht interessiert Sie, was ich rede, dann können Sie zuhören, Herr Mylius, das Wort entziehen lass ich mir nicht; ich war vorher da, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wenn ich fertig bin, können Sie mir wegen strafwürdiger Aufsässigkeit die Türe weisen, das steht bei Ihnen, aber ich habe meinen Freunden da versprochen, dass ich ihnen meine Geschichte erzähle, das Versprechen will ich halten, und solange müssen Sie sich gedulden. Auf der Bank neben der gnädigen Frau ist noch ein Platz frei, darf ich Ihnen den anbieten?“
Mylius rang vergeblich nach Erwiderung. Die Kaltblütigkeit und Kühnheit, mit der er sich zurecht- und abgewiesen sah, beraubten ihn der Sprache. Dabei das heitere Lächeln, der sprühende Blick, die lebhaft herrische Geste: er war wie vor den Kopf geschlagen. Dergleichen war neu, es bestürzte ihn, und er wusste nicht, wie er sich benehmen sollte, um Würde, Autorität und Ansehen zu retten. Die vier Kinder starrten in ihre dampfenden Schalen, die Töchter furchtsam geduckt, Lothar gespannt lauernd; Christine war beklommen; die Magd am Fenster grinste verlegen. Dieses Grinsen machte ihn toll vor Ärger; er wollte abermals losbrechen, irgendetwas schreien, sich Luft verschaffen, doch Ulrike, die ihn im Auge behielt wie eine Schlangenbändigerin, hatte schon wieder begonnen. Er presste giftig die Lippen zusammen und entschloss sich zu schweigen und sich einstweilen zurückzuziehen. Wie aber die dunkelgetönte Stimme munter und beredt hinfloss, zwang es ihn gegen seinen Willen, ja zu seinem Verdruss, stehenzubleiben, dann hielten ihn die Worte fest, die sich zu Bericht und Bild gestalteten, der wilde Unmut legte sich, obschon die Brauen noch eine Weile finster geballt waren, es dünkte ihn, dass er sich nichts vergebe, wenn er, solange es ihm gefiel, an den Türpfosten gelehnt und ohne weitere Gemeinschaft zu suchen, ebenfalls zuhörte.
Als Ulrike dessen inne wurde, ging ein zufriedener Schimmer über ihr Gesicht.
„Ich bin aufgewachsen in Gegenden, wo die Hunde auf den Feldern langsam zu Wölfen werden“, setzte sie ihre Erzählung fort. „Mein Vater war österreichischer Offizier. Angewiesen auf den Sold und ohne die Protektion, die alle Dummköpfe und Schmarotzer in die Höhe bringt, schleppte er seine mühselige Existenz durch ein halbes Dutzend östliche Grenzgarnisonen. Er hatte spät geheiratet; es fehlten die Mittel; mit dreiundvierzig Jahren wurde er Major, mit fünfzig Oberst, dabei blieb es. Was ist so ein Oberst dorten in der Juden- und Woiwodenwildnis, besonders wenn er nicht von Adel ist und kein Vermögen hat und eine Frau und eine Horde Kinder an ihm hängen? Figur zum Bejammern.
Die Woytichs stammen aus Polen. In ihren Adern rinnt Musikerblut. Meines Vaters Vater war einer der wenigen Schüler von Paganini; Paganini, ein Zauberer, wie die Welt keinen zweiten gesehen hat, ihr wisst es vielleicht, soll ihn alle seine Hexereien und Kunststücke gelehrt und ihn geliebt haben bis an seinen Tod. Davon erzählte der Vater oft, wenn er in mitteilsamer Laune war, und es hat dann auch, wie ihr bald hören werdet, eine Rolle in meinem Leben gespielt. Der Vater selbst war Virtuose auf der Geige, obschon von der zuchtlosen Art. Manchmal während der Manöver spielte er den Kameraden in einer galizischen Schenke bis zur Morgenfrühe vor, dann schwemmte er die Melancholie um sein vertanes Dasein mit Wein fort.
Meine Mutter, sie ist dem Vater bald nachgestorben, war eine schöne Frau und ist in ihrer Jugend viel bewundert und umworben worden. Sie war auch eine starke Frau, aus einem starken Geschlecht, wovon ein Beweis ist, dass weder sechs Geburten noch die Armseligkeit der Verhältnisse etwas über sie vermochten. Sie verstand ihr Leben zu geniessen, und die Leute munkelten allerlei; es gab auch viel Zank und Streit zwischen ihr und meinem Vater, so dass das Familienleben bei uns jedenfalls kein erquickliches war; aber wenn ich mir ihr Bild zurückrufe, hab ich eine stattliche stolze Dame vor mir, und die Erinnerung an sie ist pures Vergnügen, was auch sonst dahinter liegen mag. Sie wird schon gewusst haben, was sie tat; darüber steht am wenigsten denen ein Urteil zu, die ihre Erbärmlichkeit im Finstern betreiben. Wen der Herrgott in grosser Form zugeschnitten hat, der verachtet das Krüppelpack, das Gut und Böse beständig ineinandermanscht, dass es sich ausnimmt, wie wenn einer das Tedeum und das Gaudeamus in einem Atem plärrt.
In meinem fünften Jahr war ich mit der Mutter und meinem älteren Bruder Franz, der jetzt bei der Botschaft in Madrid ist, einen Winter lang hier in Wien. Die Mutter war krank und musste in einem Heim liegen, wir zwei Kinder wohnten beim Onkel Klemens und seiner Smirczinska, die ihm auch heut noch die Wirtschaft führt. Eines Tages, ich glaube, es war zu Weihnachten, schenkte er mir einen funkelnagelneuen Golddukaten. Es war ein Wunder, das damals viel beredet wurde, denn Geben und Schenken war seine Sache nie. Kurz, ich bekam den Dukaten, mit vielen kräftigen Ermahnungen, und von da ab musst ich jeden Sonntag nach dem Kirchgang zu ihm in sein Zimmer gehen und ihm den Dukaten vorweisen. Da sprach er dann von dem Wert des Goldstücks, was man sich dafür kaufen könne, wie es sich, zweckmässig verwendet, von selbst vermehre und sogar den Grundstock zu künftigem Reichtum zu bilden vermöge. Das verstand ich natürlich nicht, aber der goldene Dukaten wurde mir auf die Art ein verehrungswürdiges Ding; ich trug ihn eingenäht in ein Leinwandsäckchen auf meiner Brust, jahrelang, ich knüpfte meine Träume und meine Hoffnungen an ihn, es gab keine Versuchung, die mich hätte bewegen können, ihn auszugeben, es hätte kein Betrüger so schlau sein können, ihn mir zu entlocken, und kein Dieb so abgefeimt, ihn mir zu stehlen. Nicht als hätt ich damals und auch später das Geld blind vergöttert wie so manche, die sich eher das Herz herausschneiden lassen, als dass sie einer armen Seele mit dem, was sie errafft haben, eine Freude bereiten; eigentlich gings mir nur um den Dukaten: ein Bild von Hilfe und Verlass. Geld, ja Geld; soviel man nur gewinnen kann; um nicht leiden zu müssen, um nicht hungern zu müssen, um nicht demütig zuschauen zu müssen, wenn die andern vor der besetzten Tafel sitzen. Das erkannte ich früh; Schmalhans war Küchenmeister bei uns; es fehlte an allen Ecken und Enden; nichts war in gutem Stand; die Wäsche zerlumpt, Kleider gerade zur Notdurft; das Silber versetzt; Schulden über Schulden. Die Mutter kümmerte sich wenig, mit den Jahren ging sie immer trotziger ihre eigenen Wege, dem Vater glitt das Hauswesen aus den Händen, Dienstpersonen hatten wir längst keine mehr ausser dem Burschen, der kochte und die Zimmer aufräumte. Ein Bruder starb an Scharlach, ein Schwesterchen an der Auszehrung, ich musste sie pflegen und war zu der Zeit kaum zehn Jahre alt. Aber von Jahr zu Jahr wurden mir mehr Lasten aufgewälzt. Beim Umzug in eine andre Garnison war die Mutter jedesmal lang vorher verreist. Die Gläubiger drangsalierten mich; ich musste bei Fleischer und Bäcker um Verlängerung des Kredits betteln; ich musste sorgen, dass der Vater sein Essen bekam und die jüngeren Geschwister die Schule nicht versäumten. Oft sass ich die Nächte bis zum Morgen beim Strümpfestopfen und Hemden ausbessern, auf dem Tisch vor mir eine englische oder französische Grammatik. Ich will mich nicht rühmen, aber ich habe was geleistet bis zu meinem siebzehnten Jahr, das steht fest vor Gott und Menschen. Was dann kam, ist wieder ein Blatt für sich.
Um jene Zeit, meine beiden Brüder waren schon in der Kadettenschule, zu Hause war nur noch ich und meine Schwester Anastasia, ereignete sich die Geschichte mit Vaters Geige. Diese Geige war ein altes Instrument; er hatte sie von seinem Vater geerbt, dem Liebling Paganinis eben; mehr wussten wir nicht, mehr wusste er selber nicht. Später stellte es sich heraus, dass der Grossvater ein die Geige betreffendes wichtiges Dokument deponiert hatte, aber da er ganz plötzlich am Schlagfluss starb und während seines Lebens nie darüber gesprochen hatte, vermutlich weil er nicht wünschte, dass man in seiner Umgebung den Wert des Instruments erfuhr, damit es nicht zum Gegenstand von Habgier und Spekulation gemacht würde, wusste auch niemand, wo und bei wem sich dieses Dokument befand, ja nicht einmal, dass es überhaupt existierte. Er hatte die Geige ausdrücklich dem jüngeren Sohn vermacht und darüber erhob sich auch kein Zweifel oder Zwist. Mein Vater hatte Anrecht auf sie schon durch seine Fertigkeit im Spiel und hielt sie auch stets in Ehren.
Sooft er spielte, fiel sogar den unmusikalischesten Zuhörern der herrliche Silberton der Geige auf; ich selbst habe ihn nur zwei- oder dreimal spielen gehört und erinnere mich, dass ich ganz hingerissen war. Als er einst wieder vor den Kameraden spielte, trat ein junger ungarischer Offizier namens Ribeny auf ihn zu und ersuchte ihn, die Geige betrachten zu dürfen, da er, wie er behauptete, etwas vom Geigenbau und von alten Geigen verstehe und es ihn dünke, dass dies ein ungewöhnlich schönes und kostbares Instrument sei. Mein Vater reichte ihm die Geige, der andere besah sie lange, drehte sie um und um, beklopfte und behorchte sie, danach zog er meinen Vater beiseite und sagte, er möchte die Geige kaufen und biete ihm dreitausend Gulden. Da lachte mein Vater und antwortete, sie sei ihm nicht feil, und er wolle sich nicht von ihr trennen. Ribeny bot vier-, dann fünf-, dann sechstausend, aber mein Vater, obwohl er nachdenklich und ihm die Weigerung schwer wurde, wies ihn entschieden ab.
Eines Tages nun erhielt er einen Brief von seinem Bruder Klemens, dem Hofrat, der ihn in grosse Aufregung versetzte. Ich muss bemerken, dass Onkel Klemens, der um zwanzig Jahre älter war als er und heute ein Mann von sechsundsiebzig Jahren ist, für ihn fast ein höheres Wesen war, nicht bloss seiner Stellung und Vergangenheit wegen, sondern weil er schon als junger Mensch dazu erzogen worden war, sich ihm in allem zu fügen und unterzuordnen. Was Klemens sagte, war wie Spruch des obersten Gerichts; was Klemens tat, war Vorbild und nicht zu erschüttern. Onkel Klemens hatte Grossvaters Möbel geerbt, und unter diesen befand sich auch ein uralter Sekretär aus Nussbaumholz, so ein richtiges ehrwürdiges Stück, wie es oft in Familien von einer Generation auf die andre kommt. Bei einer Reparatur, die notwendig geworden war und zu der Onkel Klemens den Tischler gerufen hatte, wurde in dem Sekretär ein bisher verborgen gewesenes Geheimfach entdeckt, und darin lag das Dokument, durch das unbezweifelbar erwiesen wurde: erstens, dass die Geige eine echte Guarneri war; zweitens, dass Paganini selbst darauf gespielt und sie meinem Grossvater als Zeichen seiner Liebe geschenkt hatte. Hierdurch erhielt die Geige einen kaum schätzbaren Wert, wie ihr euch denken könnt, und es begann um sie ein langer und aufreibender Kampf, der meinen Vater schliesslich Gesundheit und Leben kostete.
Aller Einzelheiten kann ich mich nicht entsinnen, auch die Hauptsache, um die es ging, wurde mir erst nach und nach bekannt. Doch weiss ich, dass jede Woche zwei oder drei Briefe von Onkel Klemens kamen, von denen jeder meinen Vater aufs neue alterierte. Sein Bruder wünschte erst, forderte dann, befahl endlich, dass er die Geige ihm zur Verwahrung übergeben solle; sie sei bei ihm sicherer aufgehoben, und es verstehe sich von selbst, dass er als Repräsentant und Ältester der Familie die Befugnis habe, eine so kostbare Rarität unter seine Obhut zu nehmen, die meinem Vater all die Jahre her bloss aus dem Grund stillschweigend überlassen geblieben sei, weil man eben von ihrem eigentlichen Wert nichts geahnt hatte; jetzt aber müsse es als frivol und ungehörig bezeichnet werden, wenn er, ohne die möglichen Folgen, auch für seine Kinder, zu erwägen, das einzigartige Instrument den Zufällen und Widrigkeiten seines ruhelosen Lebens aussetze, von der Gefahr der Beraubung oder Verbrennung nicht zu reden.
Mein Vater weigerte sich standhaft. Es wurde ihm schwer, dem Bruder gegenüber Festigkeit zu bewahren, aber zunächst war die Sache stärker als die Person. Meine Mutter riet ihm, das Instrument aus dem Hause zu schaffen, es einem Freund zu übergeben und Onkel Klemens hinzuhalten. Ihre Meinung war, dass der Vater von seinem Bruder betrogen oder gar um die Geige gebracht werden solle, und sie hoffte, auf dem von ihr empfohlenen Weg den Verkauf zu erzwingen, denn an der Geige lag ihr nichts, das Geld aber war bei unseren Umständen eine beträchtliche Lockung. Mein Vater wollte nichts davon hören. Es schien, dass ihm die Geige immer lieber wurde, je umstrittener und bedrohter seine Eigentumsrechte waren. Da kam es zu nächtelangen, heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihm und der Mutter, und ich kann nicht verhehlen, dass sie ihn auf ihre Weise mehr als billig quälte und nichts unterliess, ihm das ohnehin schwere Leben noch schwerer zu machen. Dazu hatte er auf einmal Schwierigkeiten im Dienst, wurde durch allerlei Mahnungen und Reprimanden erbittert, was vordem nie geschehen war, und er musste seine Pensionierung befürchten, ein Gedanke, der ihn mit Verzweiflung erfüllte. Der Argwohn, dass Onkel Klemens dahinter steckte, war nicht abzuweisen, er hatte in gewissen Hof- und Militärzirkeln von früher her mächtigen Einfluss, und während mein Vater in seiner Gutmütigkeit noch schwankte, einem so hässlichen Verdacht Raum zu geben, erklärte ihm der Bruder in einem seiner Briefe ganz zynisch, dass er in der Tat der Urheber des Kesseltreibens sei. Gleich darauf kam er selbst, und zwar hatte er seinen Besuch auf einen Tag verlegt, wo er die Mutter abwesend wusste; sie fuhr sehr oft nach Krakau oder Pest.
Dieses Tages entsinne ich mich noch genau. Ich sehe Onkel Klemens noch vor mir, als wärs gestern gewesen, wie er zur Tür hereintrat in seiner hageren Länge, den Geierkopf vornübergebeugt, in der einen Hand den Stock mit der Elfenbeinkrücke und mit der andern sich beständig das Kinn reibend, wobei er seltsam lautlos lachte. Ich seh ihn in dem endlos langen, schäbigen Gehrock, den er heut noch trägt, und der hochgeschlossenen Samtweste. Der Vater war sehr bleich, als er ihn begrüsste; ich glaube, sie hatten einander seit einem Vierteljahrhundert nicht gesehen, denn mein Vater pflegte keine Reisen zu machen, und wie er vor ihm stand: es war ein Jammer; ich hätte ihm zurufen mögen: Mann, wo ist dein Rückgrat? Sie verschwanden dann in Vaters Zimmer, und es kam, wie es kommen musste. Der brieflichen Drangsal hatte der Vater widerstehen können, Aug in Aug mit dem Bruder war er wehrlos. Er lieferte ihm die Geige aus. Er hatte einen Revers gefordert und auch erhalten, aber das Papier ist auf rätselhafte Art in Verlust geraten. Onkel Klemens gab ihm auch dreitausendfünfhundert Gulden, als Abschlagszahlung hiess es; der Wert des Instruments belief sich, wie uns später Ribeny naiv versicherte und wie wir dann auch von anderer Seite erfuhren, mindestens auf das Zehnfache. In derselben Nacht noch verlor der Vater, der sonst nie eine Karte berührte, die ganzen dreitausendfünfhundert Gulden am Spieltisch, hauptsächlich an jenen Ribeny, was sonderbar genug ist. Danach ging es rasch bergab mit ihm; nach sechs Monaten starb er.
Die Mutter zog mit uns Töchtern nach Czernowitz, wo die Brüder lebten; sie kümmerte sich auch jetzt nicht viel um das Hauswesen, das nun in unverstellte Ärmlichkeit versank. Ich aber wollte in die Welt hinaus, ich hatte Vorsätze, den Wunsch vor allem, dass die Geschwister nicht ins Elend gerieten, und ausserdem liess mir die Geschichte mit der Guarneri-Geige keine Ruhe. Die Mutter und ich hatten oft darüber gesprochen, sie: erbittert und rachsüchtig, aber ohne Mittel und ohne Aussicht auf Entschädigung oder Wiedererstattung; wussten wir doch nicht einmal, was mit der Geige geschehen war und was der Vater mit Onkel Klemens vereinbart hatte, so dass ein Prozess zu nichts führen konnte; ich: entschlossen, nicht bloss den Hofrat aufzusuchen und ihn zu mahnen, dass sein Bruder vier unversorgte Kinder zurückgelassen hatte, sondern auch nachzuforschen, wo sich die Geige befand und unsere Rechte darauf geltend zu machen, sollte es mich gleich Jahre meines Lebens kosten. So ging ich also nach Wien.
Onkel Klemens war höchlichst verwundert, als ich ihm eines Novemberabends von seiner Smirczinska gemeldet wurde. Er fragte barsch, wozu ich gekommen sei, was ich bei ihm wolle. Ich antwortete, die Sehnsucht nach ihm hätte mich hergetrieben. Er merkte den Spott nicht und sagte, in seinem Hause sei kein Platz für landflüchtige Nichten, ich möge zusehen, wo ich einen Unterschlupf finden und mein Brot verdienen könne. Ich begriff, dass ich mich nicht einschüchtern lassen durfte; wenn ich als die zerknirschte Bittstellerin aus der Provinz zu ihm kam, die ihm für seine Fusstritte zitternd die Hand küsste, was er jedenfalls erwartete, war meine Sache keinen Schuss Pulver wert. Ich nahm mir also kein Blatt vor den Mund und schilderte ihm, in welchen Sorgen die Mutter steckte; dass Anastasia, Schmach für die Tochter eines Obersten und die Nichte eines k. k. Hofrats, sich als Küchenmagd oder Frisiermamsell verdingen müsse, wenn er sich ihrer nicht annehme; dass er in den Augen von aller Welt die Pflicht habe, meinen Brüdern fortzuhelfen, von denen der ältere weder Lust noch Neigung zum Soldatenberuf hätte, und die in ihrer Anstalt als mittellose Stipendiaten gerade noch geduldet seien; dass ich selber auf eine gnädige Unterstützung dankend verzichte und mich auf meine Manier durchschlagen würde, dass ich ihn aber aufgesucht hätte, um ihm den Standpunkt klarzumachen und ihn daran zu erinnern, dass es ausser ihm noch einige Woytichs gäbe, die vielleicht nicht ganz ohne sein Verschulden ins Unglück geraten seien, und ich nicht eher von seiner Schwelle weichen würde, bis ich die Gewähr und Sicherheit von ihm erhalten, er werde sich um die Bruderskinder gebührlich kümmern.
Das war ihm kurios zu hören. Er schaute mich an, als wolle er mich verschlingen oder zertreten. Er ging herum, die lange Pfeife im Mundwinkel, wie ein Gorilla im Käfig. Er werde kurzen Prozess mit mir machen, sagte er, und mich der Polizei übergeben. Ich lachte ihm ins Gesicht und antwortete ihm, er scheine zu vergessen, dass wir nicht mehr anno achtzehnhundertfünfzig lebten. Er ergrimmte und schrie: Kröte, scher dich fort, und die Smirczinska rang die Hände und schlug ein widriges Geheul auf. Ich lachte. Nachdem dies eine Weile gedauert hatte, änderte er den Ton. Er wolle sichs überlegen, wolle es beschlafen, sagte er. Die Smirczinska führte mich mit meinen Siebensachen in die Dachkammer. Am anderen Morgen schickte er mir einen altmodisch gefalteten Brief mit einer Zehnguldennote und der im umständlichsten Kanzleistil gehaltenen Aufforderung, mich ohne Zögern wieder nach Hause zu begeben. Ich strich den Zehnguldenschein glatt aufs Butterbrot und reichte es der vor Entsetzen sprachlosen Smirczinska. Onkel Klemens raste unten, ich lachte oben.
So fingen wir an. Er bekam Respekt. Widerwillig und Schritt für Schritt liess er sich zu Verhandlungen herbei. Das zog sich wochen- und monatelang hin. Er suchte mich einzufädeln, abzulenken, zu beschwichtigen, zu vertrösten. Ich gab nicht nach. Endlich erklärte er sich bereit, meinen Bruder Franz aufs Gymnasium zu schicken und ihm die Wege zum konsularischen Dienst zu öffnen; der Erfüllung von Franzens Wunsch, Musik zu studieren, wozu er grosse Begabung hatte, setzte er ein unüberwindliches Nein entgegen; er wolle keine Zigeuner in der Familie, sagte er; Severin, der jüngere, sollte bei den Kadetten bleiben; er wurde anständig ausstaffiert und erhielt ein monatliches Taschengeld; die Mutter bekam einen Zuschuss, so dass sie, rechnete man die Pension dazu, mit Anastasia standesgemäss leben konnte. Dies alles erreichte ich unter unablässiger Bemühung, täglichen stundenlangen Streitereien, unter Schimpfen, Geifern, Feilschen und Verwünschungen von seiner Seite und kaltblütiger Geduld von meiner, mit Listen, Bitten, Drohungen und Herumzanken überdies mit der Smirczinska, die an den Türen horchte, Ränke spann und vor Angst verging, ich könnte sie in der Gunst ihres Hofrats ausstechen.
Schwerlich hätte er sich so weit gefügig gezeigt, wenn er nicht aus meinem Benehmen den Verdacht geschöpft hätte, dass ich noch was anderes im Auge hielt, als was ich offen von ihm forderte. Es zeigte sich jetzt, wie klug ich daran getan, mit keiner Silbe von der Geige zu sprechen, obwohl sich die Versuchung oft genug geboten hatte. Er nun schien darauf zu warten. Er schien es zu fürchten. Er belauerte mich. Er witterte Unheil. Glaubte er mich arglos, so spürte ich, wie er frohlockte; meinte er mich nicht länger täuschen oder im ungewissen halten zu können, so wurde er wild und drohte wieder, mich auf die Strasse zu werfen. Aber ich verdiente mir nun durch Unterricht im Zeichnen und in Sprachen einiges Geld, so dass ich vor dem Schlimmsten nicht zu bangen brauchte; das wusste er und es imponierte ihm. Ausserdem las und lernte ich in meiner Dachkammer wie ein Student vor dem Examen; das vermehrte seine instinktive Furcht vor mir, denn im Grunde seiner Seele war ihm alles, was nach Buch und Bildung roch, ein ausgemachter Greuel.
Eines Tages nun war ich nicht wenig überrascht, als er selber auf einmal von der Geige zu reden anfing. Und zwar erst nach endlosen Umschweifen und anzüglichen Wendungen, die mir verbargen, worauf er hinauswollte. Er könne sich schon denken, was ich bei ihm suche, sagte er dann, aber damit sei es nichts, das möge ich mir aus dem Kopf schlagen, die Geige gebe er nicht her, die sei wohlverwahrt in seinem Hause, die lasse er nicht aus der Hand. Dabei streichelte er die Katze, die auf seinem Schoss sass, lachte in der gewohnten lautlosen Art und nickte mir schadenfroh zu. Er habe auch im Sinn, noch recht lang in ihrem Besitz zu bleiben, fuhr er fort, gering gerechnet noch fünfundzwanzig Jahre, denn auf fünfundneunzig werde ers bringen, das sei ihm geweissagt worden, des versicherten ihn auch Leibesbeschaffenheit und Blutkonsistenz, und daher könne es ihm niemand verargen, wenn er sich eines solchen Juwels nicht leichtsinnig entäussere, sondern es für die späten Tage in Reserve halte. Er habe das Ding von Fachleuten taxieren lassen, selbstverständlich unter Vorweis des Dokuments, und was die ausgesagt, habe seine kühnsten Erwartungen übertroffen, da könne sich die Familie dereinst gratulieren, in ferner Zukunft freilich erst, so um das Jahr neunzehnhundert herum. Und lachte wieder und schielte mich triumphierend von der Seite an.
Mir schien das alles kindisch-greisenhaftes Geschwätz, und ich glaubte, er habe einfach seine sonstige schlaue Überlegung eingebüsst. Nach und nach aber begriff ich, dass er eine Absicht dabei verfolgte, und die war, mir zu verstehen zu geben, dass er mein geheimes Streben durchschaut hatte und dass es zwecklos sei, ihn etwa überlisten zu wollen oder zu neuen Unterhandlungen zu verführen. Er wollte sich den steten Zwang zur Wachsamkeit und die Belästigung ersparen und mich durch das Unerwartete seiner Taktik verblüffen. Er wollte mich loswerden, da er ja spürte, dass mich kein anderes Interesse an seine Person fesselte. So entschloss er sich, wie die Diplomaten, wenn sie immer noch genug Hintertüren wissen, zu dieser trügerischen Offenheit.
Ich fragte mich nur: was soll ihm die Geige? Er legte keinen übermässigen Wert auf Geld und Lebensgenuss. Er war nicht geiziger und habsüchtiger als die meisten alten Männer. Er war nicht reich, vielleicht nicht einmal wohlhabend. Seine Bedürfnisse waren seit fünfzig Jahren die nämlichen, und dass er sie bis an sein seliges Ende würde befriedigen können, war ziemlich sicher. Warum also die Gier und Ungeduld zuerst, sich in den Besitz der kostbaren Geige zu setzen, und dann, als er sie hatte, das Sichgenügenlassen am blossen Haben? Er hatte sich daraufgestürzt wie eine Elster auf ein funkelndes Stück Metall und sie irgendwo in seinem Nest versteckt; denn dass sie sich wirklich im Haus und unter seinen Augen befand, bezweifelte ich keinen Moment. Weshalb zog er nicht greifbaren Nutzen daraus, wenn er schon den rechtmässigen Eigentümern verwehrte, ihre bedrängte Lage durch sie zu verbessern? Ich fand auf diese Fragen keine Antwort; es war ein Geisteszustand, den ich nicht enträtseln konnte, und ich sinne noch heute vergeblich dran herum. Aber einmal werd ichs schon erfahren.
Nun begann also ein neuer Kampf, sozusagen mit aufgedeckten Karten. Als er einsah, dass er seinen Zweck, mich zu entmutigen, nicht erreichte, wurde er wütend. Er verbot mir den Platz an seinem Tisch. Nichts konnte mir gleichgültiger sein. Ich verzehrte mein Wurstbrot in der Mansarde. Er schickte mir geharnischte Episteln herauf, alle wie mit Mönchsschrift gemalt; ich beantwortete sie nicht und liess die Smirczinska nicht mehr zur Türe herein. Dafür spionierte die hinter mir her, verbündete sich mit dem Hausmeister und hinterbrachte ihrem Herrn Botschaft von jedem meiner Schritte und jedem Gespräch, das ich mit Menschen führte. Da bekam der Alte Angst, dass ich etwas wider ihn anzettelte, und er befahl mich zu sich. Er verfluchte mein Leben und benahm sich wie ein leibhaftiger Teufel; fletschte die Zähne und schrie, dass die Leute auf der Gasse zusammenliefen. Meine Beherrschung und mein spöttisches Gesicht stachelten ihn noch mehr auf; er wollte mich nicht aus dem Zimmer lassen, versperrte die Tür und steckte den Schlüssel in die Tasche. Als er mich aber anpackte, da hatte ers zu bedauern und versuchte es nicht zum zweitenmal. Auch den Schlüssel musste er ausliefern. Am anderen Tag war er nicht wiederzuerkennen, so freundlich, dass mir bange wurde, und er sagte, dass er sich entschlossen habe, mir die Geige testamentarisch zu vermachen, bis jetzt habe er sie dem kaiserlichen Privatschatz zugedacht, doch knüpfe sich daran die Bedingung, dass die Smirczinska ein Legat von zehntausend Gulden erhalte; wenn ich mich dazu verstehen wolle, könne das Testament gleich aufgesetzt werden. Ich erwiderte, keinen roten Heller bekäme das Frauenzimmer von mir, und er meinte hämisch, das habe er ohnehin vermutet, und so müsse alles beim alten bleiben.
Es war, als ob man mit einem Werwolf rang, aber ich lernte menschliche Natur dabei kennen, das darf ich wohl behaupten, denn der eine Mann war ein Zusammengebrautes von vielen und ein Sinnbild für vieles. Eigentlich machte mir da eine ganze Zeit zu schaffen, eine Welt, die in Zersetzung war, etwas Finsteres, Tückisches und Gewalttätiges, dessen Griff ich bis ins Herz spürte. Ich sagte ihm einmal in aller Ruhe, seit ich mit ihm zu tun hätte, wüsste ich, was Österreich sei, seitdem verstünde ich erst unsere Geschichte und unser armes Volk. Den Blick, mit dem er mich danach anschaute, werd ich nicht vergessen; fast bereute ich das Wort. Es war das erstemal, wo ich die Empfindung hatte: du hast ihn getroffen.
Wie’s in der Bibel heisst: ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, so sprach ich zu ihm: erst gib mir mein Recht, dann wird dir deine Ruhe. Ich brach zu jeder Zeit des Tages und der Nacht bei ihm ein. Ich drohte ihm mit den Gerichten. Ich schickte ihm kleine Briefchen, die ihn in Schrecken versetzten. Ich beredete Leute, die zu ihm kamen und ihn fragten, ob er keine alten Geigen zu verkaufen habe. Ich legte Zeitungsausschnitte auf seinen Tisch, in denen von Mordanfällen auf hartherzige Greise berichtet wurde. Ich liess ihm sagen, dass ich um eine Audienz beim Kaiser angesucht hätte. Dieses letzte wirkte wie ein Zauber. Er kam und bat um Frieden. Wir schlossen endlich einen Pakt. Er sah, dass es kein anderes Mittel gab, sich von mir zu befreien, und ich wollte ja mein Leben nicht von ihm in Fetzen reissen lassen. Seine Forderung war, dass ich mir eine Stellung in der Welt machen solle; entweder durch Heirat oder sonstwie, die Art sei ihm gleichgültig, meinte er; aber Karriere sollte ich machen, ich hätte das Zeug dazu. Wenn mir dies klärlich und einwandfrei gelungen sei, wolle er mir nach zehn Jahren, nicht früher, nicht später, die Geige als unveräusserliches Eigentum überlassen, vorausgesetzt, dass ich dann auch die Sorge für seine Person und seinen Unterhalt auf mich nähme. Ausserdem erklärte er sich bereit, mir zum ersten Fortkommen dreihundert Gulden zu geben. Nun, ich hatte Zutrauen zu meinem Glück; dreihundert Gulden waren ein Vermögen für mich; ich willigte ein, die Bedingungen wurden schriftlich stipuliert, auch die, dass ich die Geige erben würde, falls ihn vor Ablauf der zehn Jahre der Tod ereilen sollte, und ich zog von dannen. So froh hatt ich ihn noch nie gesehen wie in der Stunde, wo ich ihm adieu sagte.
Es sind nun sechs Jahre von den zehn vergangen, aber meine Umstände haben sich bis heute nicht so geändert, dass der Vertrag zur Erfüllung reif wäre, und ich kann mir auch nicht denken, wie sie es je werden sollten. Hab ich auch nicht alle Hoffnung aufgegeben, von Karrieremachen ist weit und breit nichts zu sehen. Onkel Klemens aber lebt, bei trefflicher Gesundheit sogar, und ich meine, er wird recht behalten und ins neue Jahrhundert treten, von dem uns beinahe noch zwei Dezennien scheiden. Ich war drei Jahre in der Familie eines Grafen Lippa in Böhmen; schwere Jahre; dann ging ich in den Westen hinüber, bekam mit allerlei Sorten von Menschen zu tun, allerlei Narren, allerlei Bösewichtern, allerlei Dummköpfen, und wenn ich die Wahl habe, sind mir die Narren und die Bösewichter unbesehen lieber als die Dummköpfe. An denen geht die Menschheit nur nicht so geschwind zugrunde und ausserdem langweilen sie einen schon vorher zu Tod. Aber was ich in all den Jahren erlebte, das kann ich heut nicht mehr erzählen. Wie heisst es in ‚Tausend und eine Nacht‘? Schahrasad bemerkte das Grauen des Tages und hielt inne in der verstatteten Rede. Es graut nicht der Tag, sondern es wird Nacht, und das zwingt nicht weniger, Schluss zu machen.“
Ulrike erhob sich lächelnd und mit gravitätischer Verbeugung. Keiner ihrer Zuhörer stellte eine Frage oder sagte ein Wort, aber an den Augen, die erregt und verwundert auf sie gerichtet waren, erkannte sie, dass sie sie völlig gewonnen hatte, jeden in seiner Weise, auch Helmut Otto Mylius, der noch ganz wie zu Beginn am Türpfosten lehnte.